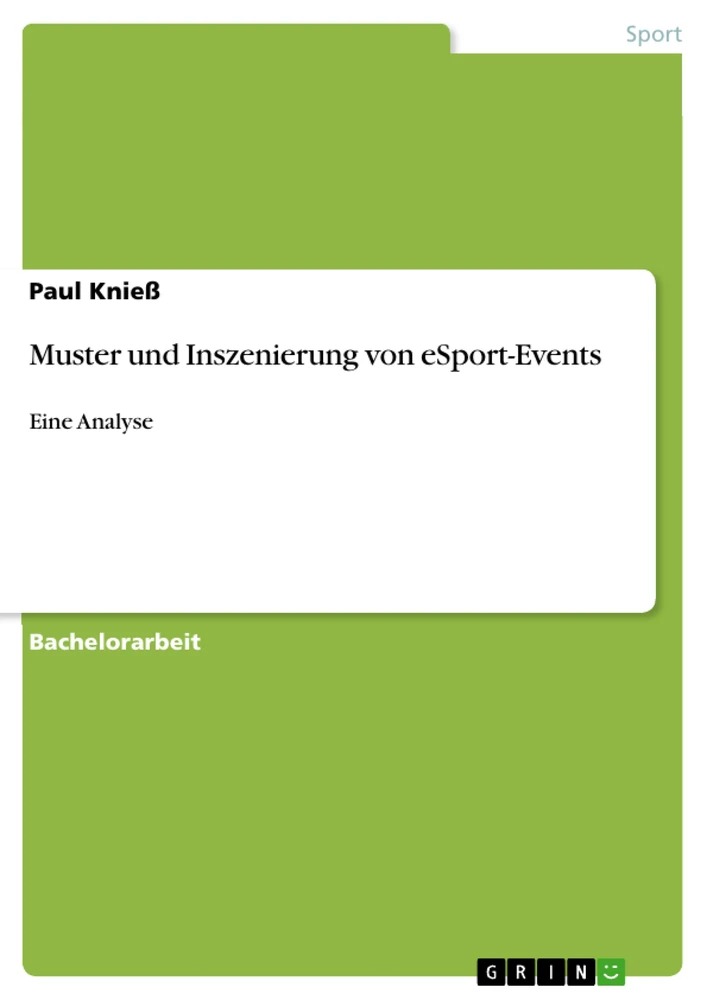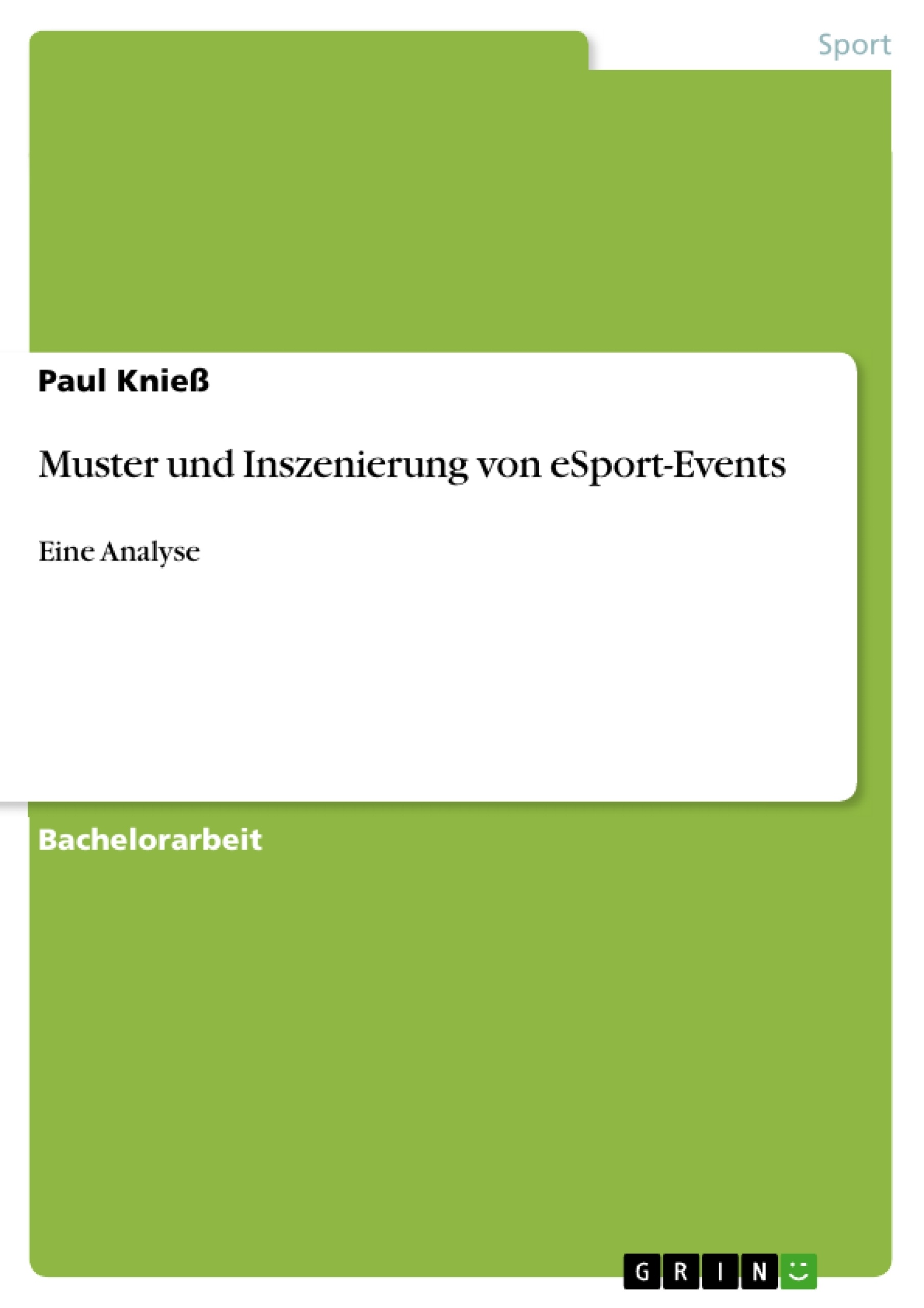Die Arbeit analysiert die eSport-Branche hinsichtlich ihres Eventcharakters. Eine umfangreiche Analyse ist derzeitig aufgrund spärlicher wissenschaftlicher Forschung schwierig, dennoch bildet die Aktualität die Grundlage für die Faszination, die dieser Sport mit sich bringt. Selbst konkurrierende Sportbranchen haben erkannt, dass eSport eine Branche mit einem hohen Wachstumspotential ist und die Tauglichkeit zum Volkssport aufweist.
Die Arbeit folgt einem dreigliedrigen Aufbau, wobei im ersten Teil die wissenschaftliche Grundlage dargelegt, im zweiten Teil in den Untersuchungsgegenstand eingeführt und schließlich im dritten Teil die Muster und Inszenierung von eSport Events analysiert werden.
Im ersten Teil wird der Begriff des Events aus soziologischer Perspektive dargestellt. Es wird zudem auf den stereotypen Ablauf eines Events eingegangen. Im zweiten Teil werden zunächst die Grundlagen des eSports vorgestellt, um Begrifflichkeiten, die für die spätere Analyse relevant sind, zu erläutern. Anschließend werden die Akteure, der Aufbau von Verbänden und deren Clans abgebildet.
Zum besseren Verständnis des eSports werden die populärsten Spielformate dargelegt und erläutert, wieso manche Spielformate erfolgreicher sind als andere. An-schließend werden relevante ökonomische Gesichtspunkte beschrieben, da die Kommerzialisierung des eSports mit dessen Wachstum zugenommen hat. Abschließend werden Probleme und Risiken der eSport-Branche aufgezeigt und diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Zum Begriff des Events in der Soziologie
- 1 Definition des Events
- 2 Abgrenzung zu anderen Gesellungsformen
- 3 Events, Publikum und Performance
- 4 Events im Sport
- II. Einführung in den eSport
- 1 Grundlagen des eSports
- 1.1 Historische Betrachtung
- 1.2 Definition eSport
- 1.3 Zur Demografie der Spieler*innen
- 1.4 eSport im internationalen Vergleich
- 1.5 Akteure im eSport
- 1.6 Leistung- und Breitensport
- 2 Anerkennungdiskurs in Deutschland
- 3 Clans
- 4 Verbände
- 4.1 Clan- und verbandsunabhängige Akteure
- 4.2 Spielformate
- 4.3 Ökonomische Gesichtspunkte
- 4.3.1 Sponsoring
- 4.3.2 Preisgelder
- 4.3.3 Wetten auf eSports
- 4.3.4 Virtuelle Währungen
- 1 Grundlagen des eSports
- III. Gesellschafts- und Gesellungsformen im eSport
- 1 Die eSport-Szene
- 2 eSport-Events und Publikum
- 3 Offline eSport-Events
- 4 Online eSport-Events
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorthesis analysiert die Muster und Inszenierung von eSport-Events. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der sozialen und kulturellen Aspekte von eSport-Events zu entwickeln und deren Besonderheiten im Vergleich zu traditionellen Sportveranstaltungen herauszuarbeiten.
- Definition und Abgrenzung von eSport-Events
- Analyse der Akteure und Strukturen im eSport
- Untersuchung der ökonomischen Aspekte des eSports
- Bedeutung von Publikum und Performance bei eSport-Events
- Vergleich von Online- und Offline-eSport-Events
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und skizziert den Forschungsansatz und die Methodik. Sie beschreibt den Fokus auf die Analyse der Muster und Inszenierung von eSport-Events und umreißt die Struktur der Arbeit.
I. Zum Begriff des Events in der Soziologie: Dieses Kapitel behandelt den soziologischen Begriff des Events und grenzt ihn von anderen Formen gesellschaftlicher Zusammenkünfte ab. Es werden zentrale Aspekte wie Definition, Publikum und Performance beleuchtet und die spezifischen Eigenschaften von Sport-Events im Kontext von eSport-Events eingeordnet. Das Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse der eSport-Events.
II. Einführung in den eSport: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in den eSport. Es beleuchtet die historische Entwicklung, definiert den Begriff und analysiert die Demografie der Spieler. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Akteuren des eSports, einschließlich Clans, Verbänden und den ökonomischen Aspekten wie Sponsoring, Preisgelder und Wetten. Die Bedeutung von virtuellen Währungen wird ebenfalls diskutiert.
III. Gesellschafts- und Gesellungsformen im eSport: Dieses Kapitel untersucht die sozialen und kulturellen Aspekte des eSports. Es analysiert die eSport-Szene, das Verhältnis zwischen eSport-Events und Publikum und unterscheidet zwischen Online- und Offline-Events. Der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Vergleich zu traditionellen Sportveranstaltungen.
Schlüsselwörter
eSport, Event, Soziologie, Performance, Publikum, Akteure, Clans, Verbände, Ökonomie, Sponsoring, Preisgelder, Wetten, Virtuelle Währungen, Online-Events, Offline-Events, Gaming, Demografie, Anerkennung.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Analyse von eSport-Events
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit analysiert die Muster und Inszenierung von eSport-Events. Sie untersucht die sozialen und kulturellen Aspekte von eSport-Events und vergleicht diese mit traditionellen Sportveranstaltungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von eSport-Events, Analyse der Akteure und Strukturen im eSport (inkl. Clans und Verbände), ökonomische Aspekte des eSports (Sponsoring, Preisgelder, Wetten, virtuelle Währungen), die Bedeutung von Publikum und Performance bei eSport-Events, sowie einen Vergleich von Online- und Offline-eSport-Events. Die Arbeit basiert auf einem soziologischen Verständnis des Begriffs "Event".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, I. Zum Begriff des Events in der Soziologie (inkl. Definition, Abgrenzung zu anderen Gesellungsformen, Events, Publikum und Performance, Events im Sport), II. Einführung in den eSport (inkl. historische Betrachtung, Definition, Demografie der Spieler*innen, internationaler Vergleich, Akteure, Leistung- und Breitensport, Anerkennungdiskurs in Deutschland, Clans, Verbände, ökonomische Gesichtspunkte wie Sponsoring, Preisgelder, Wetten auf eSports und virtuelle Währungen), III. Gesellschafts- und Gesellungsformen im eSport (inkl. eSport-Szene, eSport-Events und Publikum, Offline- und Online-eSport-Events) und Schlussbetrachtungen.
Welche soziologischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den soziologischen Begriff des Events, die Rolle des Publikums und der Performance bei eSport-Events, sowie die sozialen und kulturellen Aspekte der eSport-Szene und deren Akteure. Sie analysiert die verschiedenen Gesellschafts- und Gesellungsformen im Kontext des eSports.
Welche ökonomischen Aspekte werden untersucht?
Die ökonomischen Aspekte umfassen Sponsoring, Preisgelder, Wetten auf eSports und virtuelle Währungen. Die Arbeit beleuchtet die wirtschaftlichen Grundlagen und Strukturen des eSports.
Wie werden Online- und Offline-Events verglichen?
Die Arbeit vergleicht Online- und Offline-eSport-Events hinsichtlich ihrer sozialen und kulturellen Ausprägungen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu traditionellen Sportveranstaltungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: eSport, Event, Soziologie, Performance, Publikum, Akteure, Clans, Verbände, Ökonomie, Sponsoring, Preisgelder, Wetten, Virtuelle Währungen, Online-Events, Offline-Events, Gaming, Demografie, Anerkennung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis der sozialen und kulturellen Aspekte von eSport-Events zu entwickeln und deren Besonderheiten im Vergleich zu traditionellen Sportveranstaltungen herauszuarbeiten.
- Citar trabajo
- Paul Knieß (Autor), 2020, Muster und Inszenierung von eSport-Events, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/901963