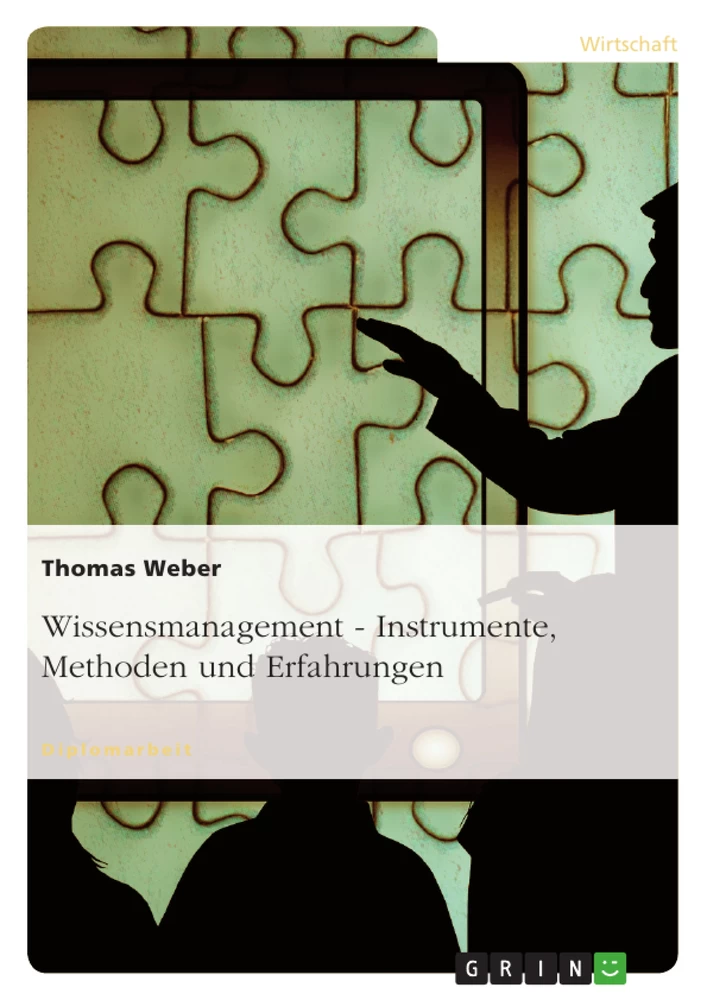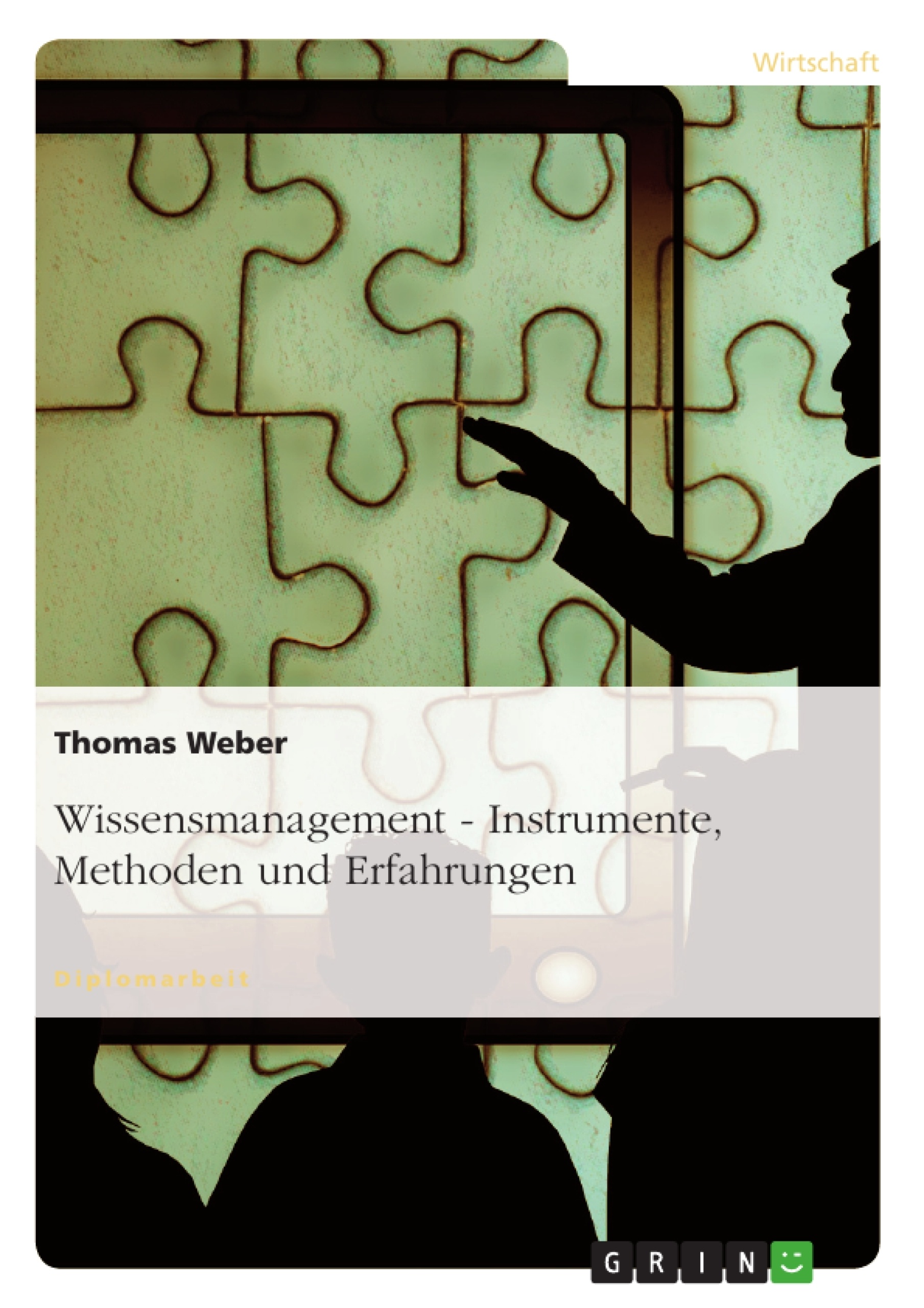Unternehmen werden immer mehr einem globalen Wettlauf mit Konkurrenten um Märkte, Kunden und Produkte ausgesetzt. Ein zunehmender Kosten- und Wettbewerbsdruck, dynamische Umweltentwicklungen sowie technologische Erfindungen, die diesen Wandel noch beschleunigen, stellen Wirtschaft und Gesellschaft permanent vor neue Herausforderungen, bieten aber auch eine Vielfalt an Chancen und Möglichkeiten. Die Globalisierung verändert traditionelle Strukturen und stellt bisher geltende Regeln und Normen in Frage.
Damit Unternehmen in solch einem dynamischen Umfeld bestehen können, sind Generierung, Erwerb, Nutzung sowie Erhalt wirtschaftlich relevanten Wissens zu den bestimmenden Wettbewerbsfaktoren geworden. Durch die Schaffung und Anwendung neuen Wissens müssen Unternehmen versuchen, stets innovative und einzigartige Produkte sowie Leistungen anzubieten um sich von der Konkurrenz absetzen zu können. Der Anteil von Wissen nimmt entlang der Wertschöpfungskette immer mehr zu und ist in vielen Wirtschaftszweigen mittlerweile nicht mehr wegzudenken.
In der Unternehmenspraxis wird auf breiter Basis anerkannt, dass das Wissen der Mitarbeiter dabei als nachhaltiger Wettbewerbsvorteil angesehen werden kann und es daher von essentieller Bedeutung ist, nicht nur neues Wissen zu schaffen, sondern dieses auch weiterzugeben und zu konservieren. Als problematisch gilt jedoch die Tatsache, dass oft enorme Wissenspotentiale von Mitarbeitern bzw. innerhalb der Organisation aufgrund unsachgemäßer Anwendung bzw. mangelnder Anwendbarkeit verloren gehen. In diesem Zusammenhang ist auch die Abwanderung von Mitarbeitern mit einem breiten Fach- und Spezialwissen zu nennen. An dieser Stelle setzt nun Wissensmanagement an, um die Ressource Wissen besser nutzbar zu machen und für das Unternehmen zu erhalten.
Wie Wissensmanagement im Einzelnen verstanden und gestaltet werden kann, wird im Rahmen dieser Arbeit untersucht und diskutiert. Dabei lassen sich unterschiedliche Methoden, Instrumente und Gestaltungsansätze unterscheiden, die zur Erschließung und Bewirtschaftung der Ressource Wissen geeignet sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen und Begriffsdefinitionen
- Wissen
- Wissensmanagement
- Organisatorisches Lernen
- Bausteine des Wissensmanagements
- Informations- und Kommunikationstechnologie im Rahmen des Wissensmanagements
- Instrumente und Gestaltungsvoraussetzungen des Personalwesens im Rahmen des Wissensmanagements
- Organisatorische Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen des Wissensmanagements
- Die Rolle der Unternehmenskultur im Wissensmanagement
- Geeignete Organisationsformen für das Wissensmanagement
- Stellenbildung im Rahmen von Wissensmanagement
- Communities of Practice in der Diskussion als geeignete Form der Arbeitsorganisation im Wissensmanagement
- Infrastrukturelle Gestaltungsansätze in der Büroorganisation
- Empirische Studie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Instrumente, Methoden und Erfahrungen im Wissensmanagement. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die relevanten Aspekte des Wissensmanagements zu geben und verschiedene Modelle und Ansätze zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung des Wissensbegriffs
- Analyse verschiedener Wissensmanagementmodelle
- Bedeutung von Informations- und Kommunikationstechnologie für das Wissensmanagement
- Rolle des Personalwesens im Wissensmanagement
- Organisatorische Gestaltungsmöglichkeiten im Wissensmanagement
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Wissensmanagements ein, beschreibt die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit sowie den Gang der Untersuchung. Sie legt den Fokus auf die Bedeutung des Wissensmanagements in der heutigen Informationsgesellschaft und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
Grundlagen und Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es definiert den Begriff „Wissen“ und differenziert zwischen verschiedenen Wissensarten. Darüber hinaus wird der Begriff „Wissensmanagement“ eingeordnet und diskutiert, seine Notwendigkeit begründet und die Erwartungen an ein effektives Wissensmanagement herausgearbeitet. Der Zusammenhang mit organisationalem Lernen wird ebenfalls beleuchtet.
Bausteine des Wissensmanagements: Dieses Kapitel beschreibt die wesentlichen Bausteine eines erfolgreichen Wissensmanagements. Es behandelt die Definition von Wissenszielen, die Identifikation, den Erwerb, die Entwicklung, die Verteilung, die Nutzung und die Bewahrung von Wissen. Darüber hinaus wird die Bewertung von Wissen erörtert und verschiedene Wissensmanagementmodelle werden im Überblick vorgestellt und kritisch gewürdigt.
Informations- und Kommunikationstechnologie im Rahmen des Wissensmanagements: Hier werden verschiedene Informations- und Kommunikationstechnologien im Kontext des Wissensmanagements untersucht. Es werden Internet, Intranet, Groupware, Wissenslandkarten, Unternehmensportale, Datenbanksysteme, Data Warehousing, Text- und Data Mining sowie weitere Technologien detailliert betrachtet und ihre jeweilige Rolle im Wissensmanagementprozess analysiert.
Instrumente und Gestaltungsvoraussetzungen des Personalwesens im Rahmen des Wissensmanagements: Dieses Kapitel beleuchtet die entscheidende Rolle des Personals im Wissensmanagement. Es untersucht den Menschen als wichtigste Wissensquelle, die Personalauswahl und die Anforderungen an Mitarbeiter. Es werden verschiedene Instrumente zur Wissensförderung wie Anreizsysteme (intrinsisch und extrinsisch), Job-Rotation, Weiterbildung, Coaching und Mentoring, Mitarbeiterveranstaltungen und -befragungen detailliert diskutiert und kritisch bewertet.
Organisatorische Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen des Wissensmanagements: Das Kapitel widmet sich der Bedeutung der Unternehmenskultur und geeigneter Organisationsformen für ein effektives Wissensmanagement. Es analysiert Anforderungen an die Unternehmenskultur und Ansätze zu deren Veränderung. Es untersucht verschiedene Organisationsformen, insbesondere die Rolle von Communities of Practice und präsentiert infrastrukturelle Gestaltungsansätze in der Büroorganisation, um den Wissenstransfer zu optimieren.
Empirische Studie: Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung einer empirischen Studie, die Erkenntnisse über Wissen und Wissensmanagement in Unternehmen liefern soll. Es wird die Methodik der Studie (einschließlich Fragebogenkonstruktion und -auswertung) detailliert erläutert und die Ergebnisse werden präsentiert und interpretiert. Die gewonnenen Daten werden analysiert um Zusammenhänge zwischen Wissen, Wissensmanagement und Belohnungssystemen zu identifizieren.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, Wissen, Informationsgesellschaft, Organisationslernen, Wissensmodelle, Informations- und Kommunikationstechnologie, Personalwesen, Unternehmenskultur, Organisationsformen, Communities of Practice, empirische Studie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wissensmanagement
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Wissensmanagement. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, und abschließend die Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf Instrumenten, Methoden und Erfahrungen im Wissensmanagement, mit dem Ziel, relevante Aspekte zu beleuchten und verschiedene Modelle und Ansätze zu präsentieren. Eine empirische Studie ist ebenfalls Teil des Dokuments.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die behandelten Themen umfassen die Grundlagen und Begriffsdefinitionen von Wissen und Wissensmanagement, die Bausteine des Wissensmanagements (Ziele, Erwerb, Verteilung etc.), die Rolle der Informations- und Kommunikationstechnologie, die Bedeutung des Personalwesens (Personalentwicklung, Anreizsysteme etc.), organisatorische Gestaltungsmöglichkeiten (Unternehmenskultur, Organisationsformen, Communities of Practice), und schließlich die Ergebnisse einer empirischen Studie zum Thema Wissen und Wissensmanagement in Unternehmen.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in die folgenden Kapitel: Einleitung, Grundlagen und Begriffsdefinitionen, Bausteine des Wissensmanagements, Informations- und Kommunikationstechnologie im Rahmen des Wissensmanagements, Instrumente und Gestaltungsvoraussetzungen des Personalwesens im Rahmen des Wissensmanagements, Organisatorische Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen des Wissensmanagements, und eine Empirische Studie.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Das Dokument zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über das Wissensmanagement zu geben und die relevanten Aspekte detailliert zu beleuchten. Es will verschiedene Modelle und Ansätze des Wissensmanagements vorstellen und kritisch würdigen. Die empirische Studie soll zusätzliche Erkenntnisse liefern.
Welche Methoden werden in der empirischen Studie verwendet?
Das Dokument beschreibt die Methodik der empirischen Studie, einschließlich der Fragebogenkonstruktion und -auswertung. Die gewonnenen Daten werden analysiert, um Zusammenhänge zwischen Wissen, Wissensmanagement und Belohnungssystemen zu identifizieren. Die genauen Methoden werden im Kapitel "Empirische Studie" detailliert dargestellt.
Welche Rolle spielt die Informations- und Kommunikationstechnologie im Wissensmanagement?
Das Dokument untersucht verschiedene Informations- und Kommunikationstechnologien (Internet, Intranet, Groupware, Wissenslandkarten etc.) und analysiert deren Rolle im Wissensmanagementprozess. Es wird gezeigt, wie diese Technologien den Wissenstransfer und die Wissensnutzung unterstützen können.
Welche Bedeutung hat das Personalwesen im Wissensmanagement?
Das Dokument betont die entscheidende Rolle des Personals als wichtigste Wissensquelle. Es untersucht die Personalauswahl, die Anforderungen an Mitarbeiter und verschiedene Instrumente zur Wissensförderung (Anreizsysteme, Weiterbildung, Coaching etc.).
Welche organisatorischen Gestaltungsmöglichkeiten werden betrachtet?
Das Dokument analysiert die Bedeutung der Unternehmenskultur und geeigneter Organisationsformen für ein effektives Wissensmanagement. Es untersucht verschiedene Organisationsformen, insbesondere die Rolle von Communities of Practice, und präsentiert infrastrukturelle Gestaltungsansätze in der Büroorganisation zur Optimierung des Wissenstransfers.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die Schlüsselwörter umfassen: Wissensmanagement, Wissen, Informationsgesellschaft, Organisationslernen, Wissensmodelle, Informations- und Kommunikationstechnologie, Personalwesen, Unternehmenskultur, Organisationsformen, Communities of Practice, empirische Studie.
- Citar trabajo
- Thomas Weber (Autor), 2007, Wissensmanagement - Instrumente, Methoden und Erfahrungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90197