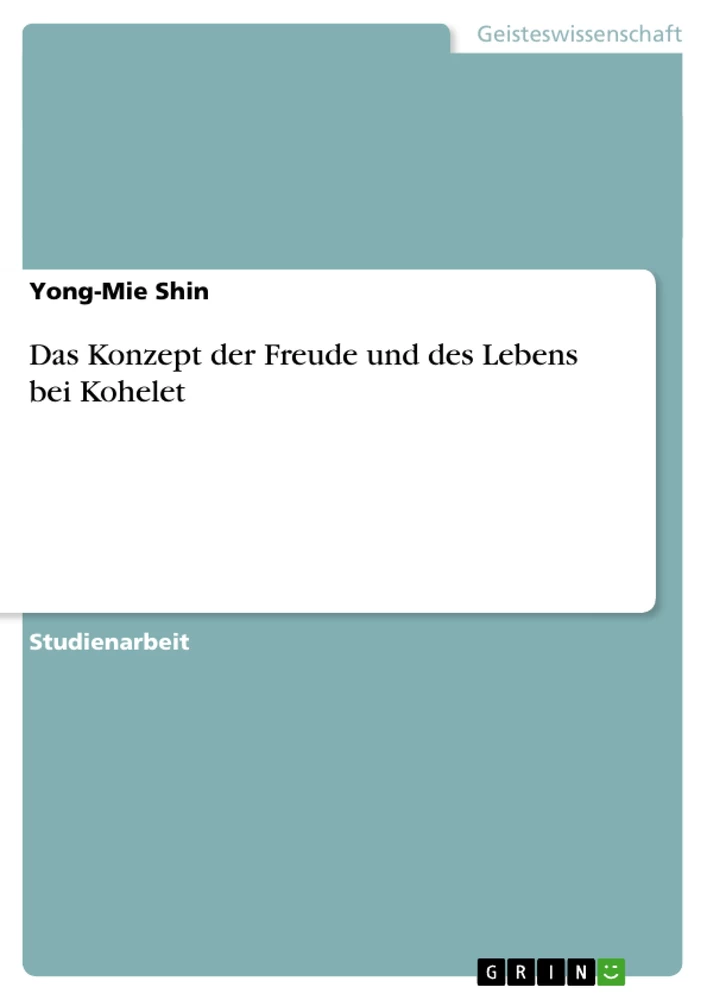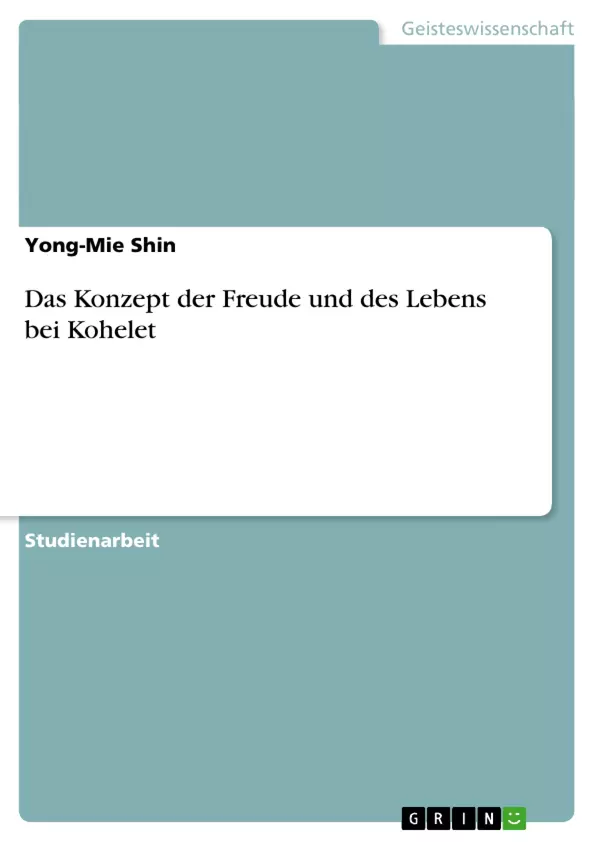Am Anfang dessen, was man heute Moralphilosophie nennt, steht der Verdacht, die Moral gehe auf Kosten des Glücks. Es waren die griechischen Sophisten, die Zweifel aufbrachten, ob sich das moralische Verhalten für den Einzelnen auch wirklich lohne. Sie lehrten die Standards der Moral als eine Konvention zu verstehen, die auch anders ausfallen könnte.
Aus dem Verlangen nach einer Begründung wurde nun festgestellt, dass das Wort „gut“ in diesem Zusammenhang mehrere Bedeutungen haben kann. Es kann z. B. für die Einzelnen das `Nützliche´ bedeuten, für eine soziale Gemeinschaft aber ein `Tugendhaftes´. Mit dieser Unterscheidung standen die griechischen Denker direkt vor dem Problem, ob das Gerechte überhaupt das Nützliche sei, ob das gute Leben notwendigerweise ein gerechtes Leben bzw. das Gerechte notwendigerweise ein gutes Leben sei, ob es denn überhaupt gut sei, sich den sozialen Regeln einer bestimmten Moral zu unterwerfen und ob sich die Moral für das Glücksstreben des Einzelnen überhaupt lohne.
Mit diesen Fragestellungen zwischen dem guten und gerechten Leben, zwischen Glück und Moral begann also ein bis heute andauerndes Verhängnis der Philosophie in ihrer kritischen Reflexion über die Grundlage der Moral einerseits und in der begrifflichen Begründung zwischen Glück und Moral andererseits.
Die moderne Ethik seit Kant hat sich weitgehend damit begnügt, Bedingungen eines guten Lebens zu markieren, die für alle geschaffen und von allen respektiert werden sollten. Sie wollte aber dabei mit einem Glücksbegriff, der oft gefährlich oder aussichtslos schien, möglichst auskommen: Die Idee des Richtigen sollte die sozial erlaubte Form des Glücksstrebens vorgeben aber der Rest sollte der Regie des Individuums überlassen werden.(2) Diese Zurückhaltung der modernen Ethik gegenüber einer Glückslehre führt dazu, dass sie auf einem Auge blind bleibt. Die gegenwärtige Ethik bemühte sich daher um die Aufhebung dieser Blindheit und will die tragende Stellung eines qualifizierten Glücksbegriffs für die gesamte Ethik und Sozialphilosophie deutlich machen. [...]
Um einen formalen Begriff des Glücks herzustellen, wäre es also absurd, wenn man eine rein formale Analyse des Glücks betreiben möchte. Es wäre inhaltlos. Sie muss für inhaltliche Konkretisierung offen sein. In diesem Sinne, wenn die antiken Hochkulturen inhaltliche Materiale dafür durchgearbeitet haben, dann könnten Sie bestimmt geistigen Schatz für einen inhaltvollen Glücksbegriff bieten. [...]
--
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Liber Ecclesiastes
- II. Thema, Stil und Struktur des Buches Qoh
- III. Glückslehre bei antiken Hochkulturen im Vergleich mit Kohelet
- III-1 Altorientalische und ägyptische Glückslehre und Kohelet
- III-2 Hellenistische Glückslehre und Kohelet
- III-3 Kohelet im israelischen- jüdischen Kontext
- III-4 Glückslehre bei Kohelet
- III-4-1 Freude als höchstes Gut
- III-4-2 Gottesfurcht
- III-4-3 Konzept der Freude bei Kohelet
- III-4-4 Carpe Diem
- III-4-4-1 Carpe-Diem bei Epikur und Kohelet
- IV. Konzept des Lebens bei Kohelet
- V. Resumee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Konzept der Freude und des Lebens im Buch Kohelet. Sie analysiert die Glückslehre Kohelets im Vergleich zu anderen antiken Hochkulturen, insbesondere dem Hellenismus, und beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Des Weiteren wird die Originalität Kohelets herauskristallisiert und seine Position innerhalb des israelisch-jüdischen Kontextes betrachtet.
- Das Konzept der Freude in Kohelet
- Der Vergleich der Glückslehre Kohelets mit anderen antiken Hochkulturen
- Die Position von Kohelet im israelisch-jüdischen Kontext
- Die Originalität des Buches Kohelet
- Die Rolle von Gottesfurcht im Konzept der Freude bei Kohelet
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Problematik des Glücks im Kontext der antiken griechischen Philosophie und die moderne ethische Diskussion. Sie führt in die Thematik der Hausarbeit ein und beschreibt die Rolle des Buches Kohelet in diesem Kontext.
Kapitel I gibt eine allgemeine Einführung in das Buch Kohelet, seine Stellung innerhalb der alttestamentarischen Weisheitsliteratur und seine hebräische und griechische Bezeichnung.
Kapitel II beschreibt das Thema, den Stil und die Struktur des Buches Kohelet.
Kapitel III setzt sich mit der Glückslehre in verschiedenen antiken Hochkulturen auseinander und vergleicht diese mit der Glückslehre Kohelets. Es werden die Glücksvorstellungen in altorientalischen und ägyptischen Kulturen, im Hellenismus und im israelisch-jüdischen Kontext beleuchtet. Des Weiteren wird die Glückslehre Kohelets im Detail analysiert, insbesondere die Rolle der Freude als höchstes Gut, die Bedeutung von Gottesfurcht und das Konzept von "Carpe Diem".
Kapitel IV untersucht das Konzept des Lebens im Buch Kohelet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Glückslehre des Buches Kohelet, die im Vergleich zu anderen antiken Hochkulturen, dem Hellenismus und dem israelisch-jüdischen Kontext betrachtet wird. Die Schlüsselwörter sind: Freude, Lebensfreude, Glückskonzepte, Gottesfurcht, Carpe Diem, Weisheit, alttestamentarische Weisheitsliteratur, antike Hochkulturen, Hellenismus, Kohelet, Ecclesiastes, Biblische Anthropologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema des Buches Kohelet in dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Konzepte von Freude und Leben im biblischen Buch Kohelet (Prediger) und vergleicht diese mit antiken Glückslehren.
Wie definiert Kohelet die Freude?
Freude wird bei Kohelet oft als „höchstes Gut“ und als Gabe Gottes verstanden, die der Mensch trotz der Vergänglichkeit des Lebens genießen soll.
Was bedeutet „Carpe Diem“ im Kontext von Kohelet?
Ähnlich wie bei Epikur betont Kohelet den Genuss des Augenblicks, verknüpft dies jedoch untrennbar mit der Gottesfurcht und der Anerkennung Gottes als Geber der Freude.
Wie unterscheidet sich Kohelets Glückslehre vom Hellenismus?
Während hellenistische Lehren oft auf Vernunft und Autarkie setzen, bleibt Kohelet im israelisch-jüdischen Kontext verwurzelt, in dem das Glück von der Beziehung zu Gott abhängt.
Welche Rolle spielt die Gottesfurcht?
Gottesfurcht ist bei Kohelet die Voraussetzung für wahre Freude. Sie ist kein lähmender Schrecken, sondern die Anerkennung der menschlichen Grenzen gegenüber dem Schöpfer.
- Quote paper
- Magister. FU Belin Yong-Mie Shin (Author), 2003, Das Konzept der Freude und des Lebens bei Kohelet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90233