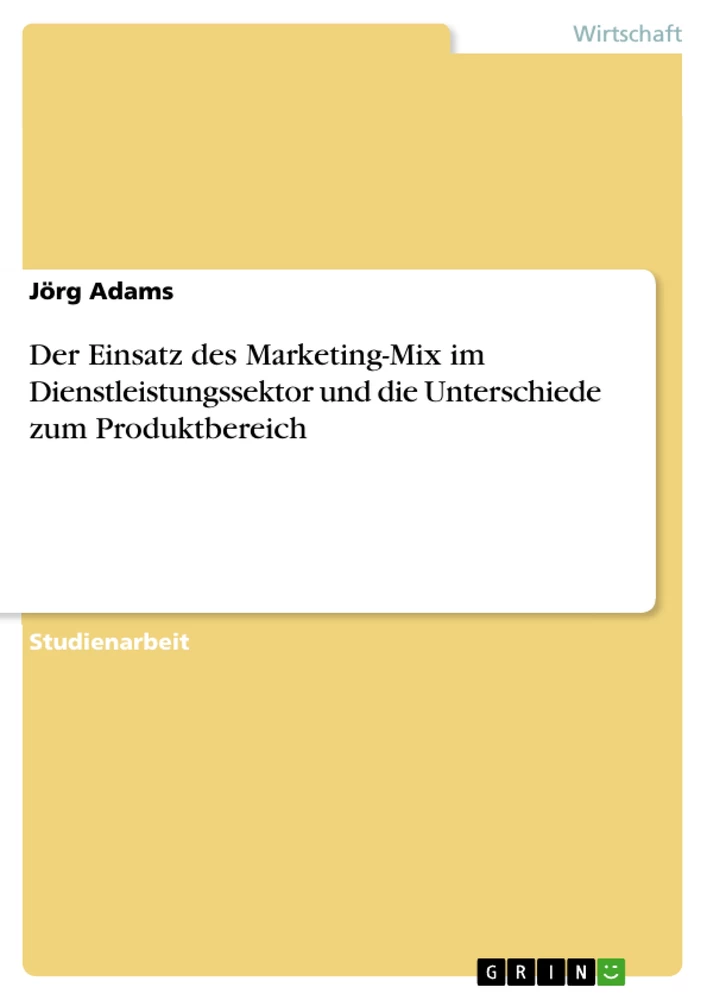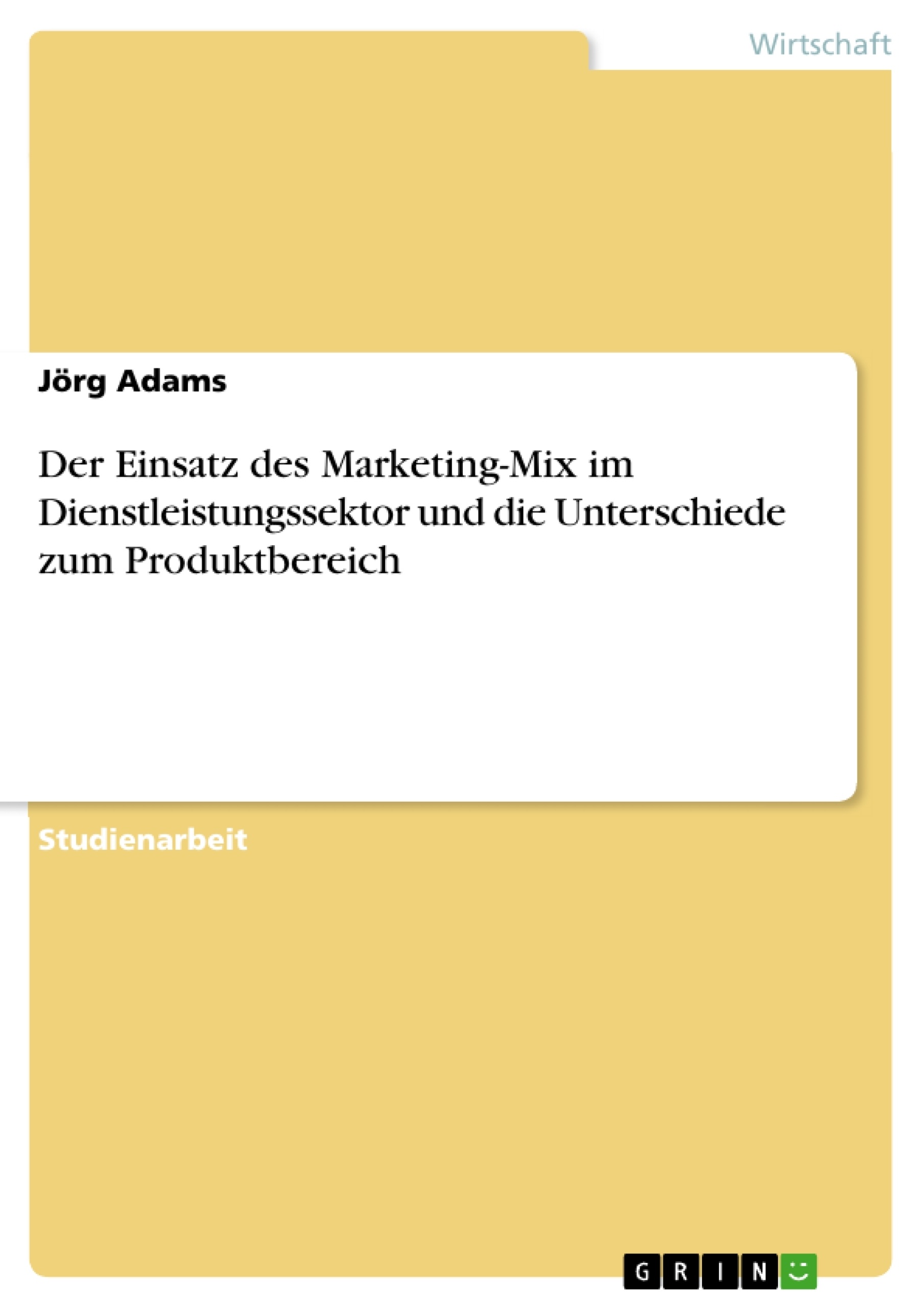„Wir haben in Deutschland keine Dienstleistungskultur; die Tugend des
Dienens fehlt uns weitgehend. Wir haben allerdings gelegentlich auch
Schwierigkeiten, uns bedienen zu lassen.“
(Roman Herzog, ehem. Bundespräsident)
„Deutschland ist im Service-Bereich zurückgeblieben.“
(Klaus Mangold, Vorsitzender des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft)
Diese und ähnliche Zitate verdeutlichen die Diskussion über den Dienstleistungssektor
in Deutschland. Begriffe wie „Service-Wüste“ und „Service-Oase“ fallen häufig in
Nachrichten oder Fachzeitschriften und beschäftigen somit Gesellschaft und Medien.
Dem Thema „Dienstleistungsmarketing“ wird in der Betriebswirtschaftslehre seit den
80er-Jahren immer mehr Bedeutung beigemessen, dies belegt die Anhäufung der
Publikationen zu diesem Thema. Die volkswirtschaftlichen Zahlen zeigen u. a., dass
der tertiäre Sektor1 von 1970 bis 2004 der „Job-Motor“ der deutschen Wirtschaft war
und somit die Wichtigkeit unterstreicht.2 Durch die außergewöhnlich heterogene
Branchenvielfalt des Dienstleistungssektors zeigen sich Probleme bei der Aufstellung
allgemeingültiger Theorien auf diesem Gebiet. In fast allen Bereichen des produzierenden
Sektors stellen Dienstleistungen einen großen Anteil der angebotenen Problemlösungen
dar. Absatzleistungen, die ausschließlich aus Dienstleistungen bestehen,
gibt es nur wenige. Im Gegensatz dazu, gibt es keine Sachleistung die keine
Dienstleistung beinhaltet, womit deutlich wird, dass es eine Vielzahl von Überschneidungen
im Konsumgüter-, Industriegüter- und Dienstleistungsmarketing gibt.3 Angesichts
dessen entstehen Fragen:
Wie definiert sich eine Dienstleistung? Gibt es einen Unterschied zu einer Sachleistung?
Wo sind marketingpolitisch Besonderheiten gegenüber dem Sachgüterbereich
festzustellen? Ziel dieser Ausarbeitung ist aufzuzeigen, wie wichtig der Dienstleistungssektor für
den Wirtschaftsstandort Deutschland geworden ist, wie Dienstleistungen definiert
werden und welche Besonderheiten Dienstleistungen besitzen. Des Weiteren sollen
die wichtigsten Unterschiede und die damit verbundenen Probleme in Bezug auf das
Sachgütermarketing erläutert werden. In dieser Arbeit wird überwiegend auf das operative Dienstleistungsmarketing eingegangen.
Dabei steht das marketingpolitische Instrumentarium im Vordergrund. Aus
Gründen der Übersicht wird auf die Marketingforschung und das strategische Marketing
verzichtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Grundlagen des Dienstleistungsmarketing
- Bedeutung von Dienstleistungen
- Definition des Dienstleistungs-Begriffs
- Die Eigenschaften von Dienstleistungen
- Der klassische Marketing-Mix im Dienstleistungsmarketing
- Angebots-/Leistungspolitik
- Preispolitik
- Kommunikationspolitik
- Distributionspolitik
- Die Erweiterung des Marketing-Mix im Dienstleistungsmarketing
- Personalpolitik
- Prozesspolitik
- Ausstattungspolitik
- Schlussbetrachtung und Zukunftstendenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des Dienstleistungssektors in der deutschen Wirtschaft, definiert Dienstleistungen im Vergleich zu Sachgütern und analysiert die Besonderheiten des Dienstleistungsmarketings. Das Hauptziel ist es, die Unterschiede zwischen dem Marketing von Dienstleistungen und Sachgütern aufzuzeigen und die Herausforderungen im Dienstleistungsmarketing zu beleuchten.
- Bedeutung des Dienstleistungssektors für die deutsche Wirtschaft
- Definition und Eigenschaften von Dienstleistungen
- Der klassische Marketing-Mix im Dienstleistungssektor
- Erweiterung des Marketing-Mix für Dienstleistungen
- Unterschiede zum Sachgütermarketing
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Diskussion um den Dienstleistungssektor in Deutschland, verdeutlicht durch Zitate von Roman Herzog und Klaus Mangold, die auf Defizite im deutschen Servicebereich hinweisen. Die zunehmende Bedeutung des Dienstleistungssektors wird anhand volkswirtschaftlicher Daten unterstrichen, gleichzeitig werden die Herausforderungen bei der Entwicklung allgemeingültiger Theorien aufgrund der Heterogenität der Branche hervorgehoben. Schließlich werden zentrale Forschungsfragen formuliert, die sich mit der Definition von Dienstleistungen, den Unterschieden zu Sachleistungen und den marketingpolitischen Besonderheiten befassen.
Grundlagen des Dienstleistungsmarketing: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung und Bedeutung von Dienstleistungen in Deutschland und international. Es liefert eine Definition des Dienstleistungsbegriffs und beschreibt dessen charakteristische Eigenschaften im Vergleich zu Sachgütern. Die enorme Zunahme der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor in den letzten 30 Jahren wird als Indikator für die wachsende Bedeutung der Branche dargestellt. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung von Dienstleistungen zu Sachgütern und den daraus resultierenden Implikationen für das Marketing.
Der klassische Marketing-Mix im Dienstleistungsmarketing: Dieser Abschnitt analysiert die klassischen Marketinginstrumente (Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik) und deren Anwendung im Dienstleistungsbereich. Hier werden die spezifischen Herausforderungen und Unterschiede zum Marketing von Sachgütern im Detail untersucht. Es wird aufgezeigt, wie die klassischen Instrumente angepasst und angewendet werden müssen, um die Besonderheiten von Dienstleistungen zu berücksichtigen.
Die Erweiterung des Marketing-Mix im Dienstleistungsmarketing: Dieses Kapitel erweitert den klassischen Marketing-Mix um die Faktoren Personal-, Prozess- und Ausstattungspolitik. Es wird argumentiert, dass diese zusätzlichen Faktoren im Dienstleistungsmarketing eine entscheidende Rolle spielen, da die immateriellen Aspekte von Dienstleistungen eine besondere Bedeutung haben. Die Interaktion zwischen Personal, Prozessen und Ausstattung wird als zentraler Erfolgsfaktor für die Dienstleistungsqualität herausgestellt.
Schlüsselwörter
Dienstleistungen, Dienstleistungsmarketing, Marketing-Mix, Sachgütermarketing, Deutschland, Wirtschaftsstandort, Heterogenität, Produktpolitik, Preispolitik, Kommunikationspolitik, Distributionspolitik, Personalpolitik, Prozesspolitik, Ausstattungspolitik, Servicequalität.
FAQ: Dienstleistungsmarketing in der deutschen Wirtschaft
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Dienstleistungsmarketing in der deutschen Wirtschaft. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf den Besonderheiten des Dienstleistungsmarketings im Vergleich zum Marketing von Sachgütern.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende zentrale Themen: Die Bedeutung des Dienstleistungssektors in Deutschland, die Definition und Eigenschaften von Dienstleistungen, der klassische Marketing-Mix (Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik) im Kontext von Dienstleistungen, die Erweiterung des Marketing-Mix um Personal-, Prozess- und Ausstattungspolitik, sowie die Herausforderungen und Unterschiede zum Sachgütermarketing.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (mit Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise), Grundlagen des Dienstleistungsmarketings, Der klassische Marketing-Mix im Dienstleistungsmarketing, Die Erweiterung des Marketing-Mix im Dienstleistungsmarketing und Schlussbetrachtung und Zukunftstendenzen.
Wie wird der Dienstleistungsbegriff definiert?
Das Dokument definiert den Dienstleistungsbegriff im Vergleich zu Sachgütern und beschreibt dessen charakteristische Eigenschaften. Es wird die Abgrenzung von Dienstleistungen zu Sachgütern und die daraus resultierenden Implikationen für das Marketing herausgearbeitet.
Welche Besonderheiten weist der Marketing-Mix im Dienstleistungsmarketing auf?
Der klassische Marketing-Mix wird im Kontext von Dienstleistungen analysiert, wobei die spezifischen Herausforderungen und Unterschiede zum Marketing von Sachgütern im Detail untersucht werden. Es wird aufgezeigt, wie die klassischen Instrumente angepasst werden müssen, um die Besonderheiten von Dienstleistungen zu berücksichtigen. Zusätzlich werden die wichtigen Erweiterungen des Marketing-Mix durch Personal-, Prozess- und Ausstattungspolitik behandelt.
Welche Rolle spielen Personal-, Prozess- und Ausstattungspolitik im Dienstleistungsmarketing?
Das Dokument argumentiert, dass Personal-, Prozess- und Ausstattungspolitik im Dienstleistungsmarketing eine entscheidende Rolle spielen, da die immateriellen Aspekte von Dienstleistungen eine besondere Bedeutung haben. Die Interaktion zwischen Personal, Prozessen und Ausstattung wird als zentraler Erfolgsfaktor für die Dienstleistungsqualität herausgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Dienstleistungen, Dienstleistungsmarketing, Marketing-Mix, Sachgütermarketing, Deutschland, Wirtschaftsstandort, Heterogenität, Produktpolitik, Preispolitik, Kommunikationspolitik, Distributionspolitik, Personalpolitik, Prozesspolitik, Ausstattungspolitik, Servicequalität.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Hauptziel des Dokuments ist es, die Unterschiede zwischen dem Marketing von Dienstleistungen und Sachgütern aufzuzeigen und die Herausforderungen im Dienstleistungsmarketing zu beleuchten. Es untersucht die Bedeutung des Dienstleistungssektors in der deutschen Wirtschaft und analysiert die Besonderheiten des Dienstleistungsmarketings.
- Quote paper
- Jörg Adams (Author), 2005, Der Einsatz des Marketing-Mix im Dienstleistungssektor und die Unterschiede zum Produktbereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90237