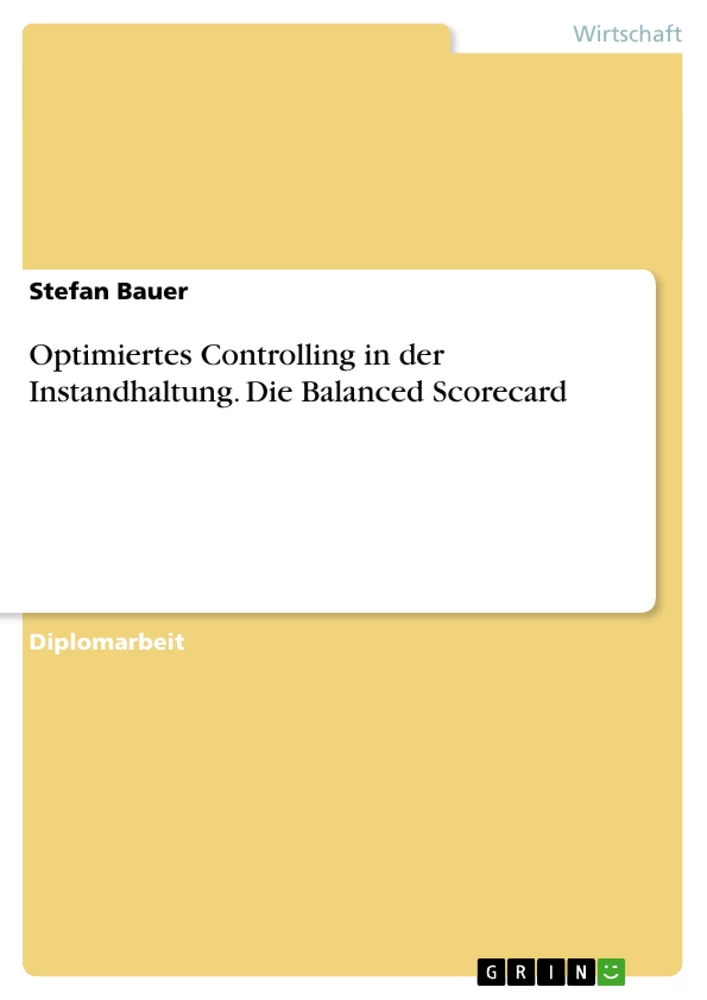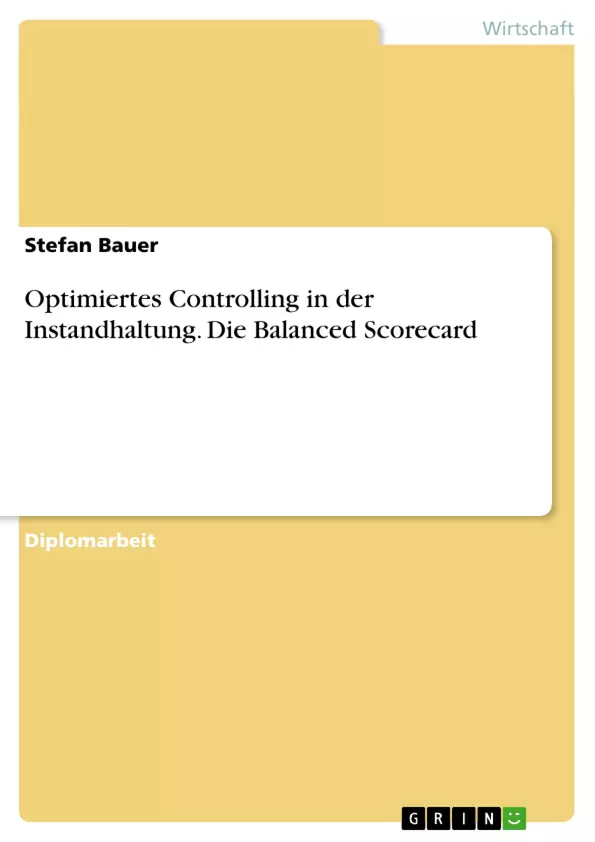Moderne Unternehmen sehen sich mit einem ständigen Strukturwandel und einer immer rascher wachsenden Dynamik konfrontiert. Verschärfte Wettbewerbsbedingungen, kürzere Produktlebenszyklen sowie eine globale Ausrichtung der Marktsituation verlangen eine fortwährend angepasste Kostenkontrolle sowie effektive Maßnahmen zur Erreichung eines optimalen Kostenniveaus und einer entsprechenden Kostenstruktur.
Das Management muss ausgehend von einer Vision Ziele festlegen und Strategien zu deren Erreichung entwickeln. Erst die zielführende Umsetzung der Strategien und Konzepte in operatives Handeln sichert den unternehmerischen Erfolg, der sich in den Finanzzahlen niederschlägt.
Im produzierenden Gewerbe wird das Ergebnis durch einen sehr großen Gemeinkostenblock geschmälert, nämlich durch die Instandhaltung. Dabei stellt aber gerade die Wartung, Inspektion und Reparatur von Betriebsmitteln eine tragende Säule im Gefüge eines modernen Industriebetriebs dar. Die Wichtigkeit wird über alle Ebenen dieser Abteilung bis zum einzelnen Mitarbeiter zwar erkannt, jedoch weichen die Zielvorstellungen des Managements und der Mitarbeiter je weiter man in der Hierarchie nach unten geht immer stärker voneinander ab.
Es stellt sich also die Frage, wie man die finanzwirtschaftlichen Oberziele des Top-Managements auf die operative Ebene herunterbrechen kann und jedem einzelnen Mitarbeiter einen Teil der Unternehmensstrategie mit auf den Weg geben kann. Die Anfang der 90er Jahre von Robert S. Kaplan und David P. Norton entwickelte Idee einer Balanced Scorecard versucht hier Antworten zu geben. Dieses Management-Tool wird u.a. „als derzeit wohl beste Möglichkeit, betriebswirtschaftliches Know-how an Nicht-…Betriebswirte zu verkaufen“ beschrieben (WEBER 1999, V).
Die Balanced Scorecard beschreibt ein Kennzahlensystem, das neben finanzwirtschaftlichen Zielen auch sog. Soft-Skills wie beispielsweise Kundenzufriedenheit, Effektivität interner Prozesse oder Mitarbeiterentwicklung mit einbezieht und so eine Brücke zwischen Unternehmensstrategie und operativem Geschäft zu schlagen versucht.
Nach den einleitenden Worten in Kapitel 1 dieser Arbeit folgt in Kapitel 2 zunächst eine grundlegende Betrachtung des Managementsystems Balanced Scorecard. Obwohl zu diesem Thema eine Fülle von Fachliteratur existiert, werden zum Allgemeinverständnis Aufbau, Anliegen und Elemente der Vorgehensweise beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Management-Tool Balanced Scorecard
- Konzeption und Anliegen der Balanced Scorecard
- Grundlagen
- Intention der Balanced Scorecard
- Struktur und Aufbau einer Balanced Scorecard
- Top-Down-Ansatz
- Die vier Grundperspektiven der Balanced Scorecard
- Weitere mögliche Perspektiven
- Berücksichtigung der gegenseitigen Abhängigkeiten
- Neuausrichtung des Controllings
- Der Funktionsbereich Instandhaltung
- Charakterisierung
- Definition
- Der Stellenwert der Instandhaltung
- Die Instandhaltung im Wandel der Zeit
- Kenngrößen im Instandhaltungsbereich
- Prozesse der Instandhaltung
- Kostenstrukturen
- Kennzahlen
- Instandhaltungsstrategien
- Zielvorgaben
- Grundtypen von Instandhaltungsstrategien
- Weiterentwicklung der Instandhaltungsstrategien
- Zusammenfassung des Kapitels
- Implementierung der Balanced Scorecard
- Basis für die Einführung
- Grundvoraussetzungen
- Verantwortlichkeiten und Aufgabenverteilung
- Ablauf der Implementierung
- Strategische Ziele bestimmen
- Ursache-Wirkungsbeziehungen aufbauen
- Kennzahlen auswählen
- Zielwerte festlegen
- Maßnahmen bestimmen
- Erfolgsfaktoren für die Balanced Scorecrad
- Zusammenfassung und Ausblick
- Stärken der Balanced Scorecard
- Schwächen der Balanced Scorecard
- Eine Instandhaltung der Zukunft?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Optimierung des Controllings im Bereich der Instandhaltung. Im Zentrum steht dabei das Management-Tool Balanced Scorecard (BSC). Die Arbeit analysiert die Konzeption und Anwendung der BSC im Kontext der Instandhaltung, um deren Potenzial zur Verbesserung der Steuerung und Performance in diesem Bereich aufzuzeigen.
- Analyse der Balanced Scorecard als Management-Tool
- Anwendung der BSC in der Instandhaltung
- Optimierung des Controllings in der Instandhaltung durch die BSC
- Bewertung der BSC-Implementierung in der Instandhaltung
- Perspektiven für die Zukunft der Instandhaltung
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel liefert eine Einführung in die Problemstellung und die Relevanz des Themas. Es beleuchtet die Herausforderungen, die sich im Bereich der Instandhaltung stellen, und skizziert die Bedeutung von effizientem Controlling.
- Das zweite Kapitel stellt die Balanced Scorecard als Management-Tool vor. Es beschreibt die Konzeption und die Intention der BSC sowie deren Struktur und Aufbau. Dabei werden die vier Grundperspektiven der BSC, die Berücksichtigung von Abhängigkeiten und die Neuausrichtung des Controllings durch die BSC diskutiert.
- Das dritte Kapitel widmet sich dem Funktionsbereich Instandhaltung. Es charakterisiert die Instandhaltung und deren Stellenwert, beleuchtet die Entwicklung der Instandhaltung über die Zeit und beschreibt die relevanten Kennzahlen, Prozesse und Kostenstrukturen. Darüber hinaus werden verschiedene Instandhaltungsstrategien und deren Zielvorgaben sowie Weiterentwicklungen vorgestellt.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit der Implementierung der Balanced Scorecard im Bereich der Instandhaltung. Es beschreibt die notwendigen Voraussetzungen und die Aufgabenverteilung, die für eine erfolgreiche Einführung notwendig sind. Der Ablauf der Implementierung wird Schritt für Schritt erläutert, von der Definition der strategischen Ziele bis zur Auswahl der Kennzahlen und Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Balanced Scorecard, Instandhaltung, Controlling, Management, Performance, Kennzahlen, Prozesse, Kosten, Strategie, Implementierung, Strategiekarte, Ursache-Wirkungsbeziehungen
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Balanced Scorecard (BSC)?
Die BSC ist ein Kennzahlensystem, das finanzielle Ziele mit Soft-Skills wie Kundenzufriedenheit und Prozess-Effektivität verbindet, um Strategien operativ umzusetzen.
Warum ist die BSC für die Instandhaltung relevant?
Sie hilft dabei, die finanzwirtschaftlichen Oberziele des Managements auf die operative Ebene der Instandhaltung herunterzubrechen und die Kostenstruktur zu optimieren.
Welche vier Grundperspektiven hat die Balanced Scorecard?
Die klassischen Perspektiven sind Finanzen, Kunden, interne Prozesse sowie Lernen und Entwicklung (Mitarbeiter).
Wie läuft die Implementierung der BSC ab?
Der Prozess umfasst die Bestimmung strategischer Ziele, den Aufbau von Ursache-Wirkungsbeziehungen, die Auswahl von Kennzahlen sowie die Festlegung von Zielwerten und Maßnahmen.
Was sind die Stärken und Schwächen der BSC?
Die Arbeit bewertet die BSC als Instrument zur Neuausrichtung des Controllings und diskutiert sowohl ihre Vorteile als auch potenzielle Herausforderungen in der Anwendung.
- Quote paper
- Stefan Bauer (Author), 2007, Optimiertes Controlling in der Instandhaltung. Die Balanced Scorecard, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90262