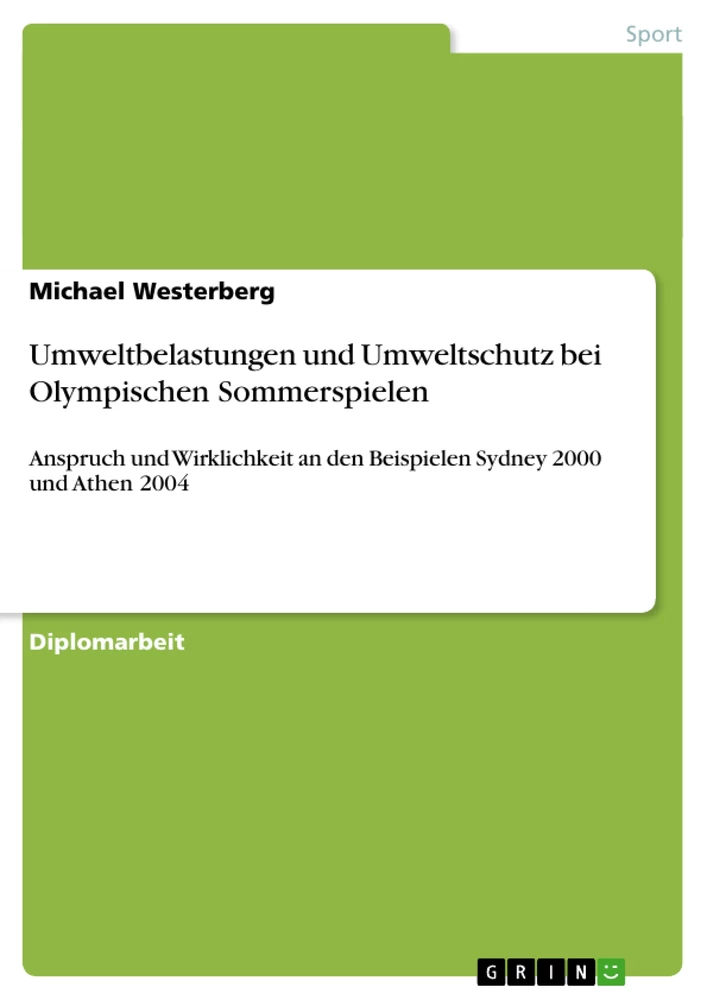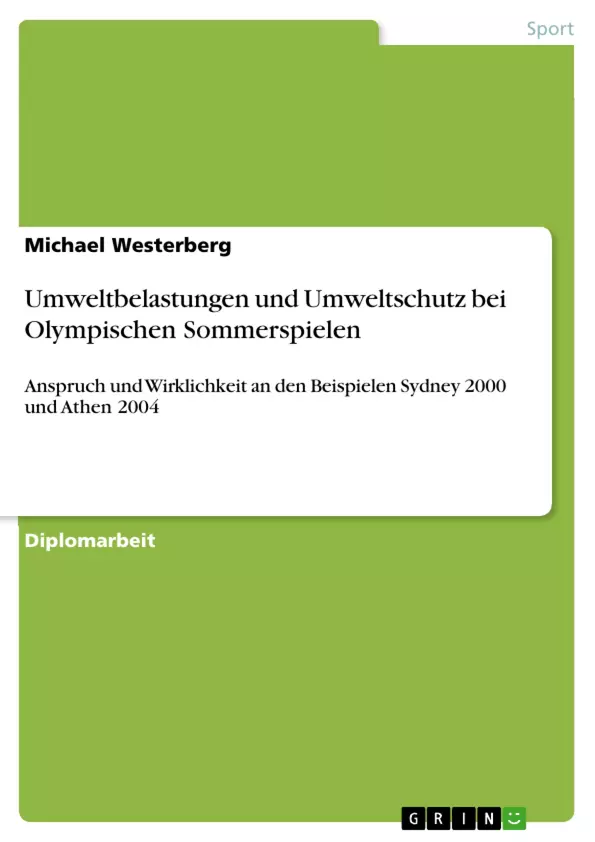Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, welche Umweltbelastungen Olympische Sommerspiele verursachen und welche Schutzmöglichkeiten dem entgegenwirken können. Die Wirklichkeit eines olympischen Umweltschutzes wurde an den Beispielen Sydney 2000 und Athen 2004 betrachtet und am Anspruch der Olympischen Bewegung gemessen. Die zentrale Frage, ob die Olympische Bewegung ihrem selbst auferlegten Umweltschutzanspruch gerecht wird, soll mit dieser Arbeit beantwortet werden.
Die direkten und indirekten Einwirkungen auf die natürliche Umwelt in der Vorbereitungs-, Durchführungs- und Nachnutzungsphase Olympischer Sommerspiele sind vielfältig. Die Ausrichtung der Spiele kann die Stadtentwicklung der Ausrichterstadt in kurzer Zeit um Jahre voranbringen oder auch zurückwerfen. Dies schließt den Umweltschutz mit ein, im positiven wie negativen Sinne. Maßnahmen, welche die Einwirkung Olympischer Spiele auf die Umwelt, reduzieren wie auch ausgleichen können, existieren und bieten nicht nur im Bereich des Umweltschutzes Vorteile.
Mit der Implementierung des Umweltschutzes als Dritte Säule der Olympischen Bewegung und der Ausdifferenzierung des olympischen Umweltschutzes in grundlegenden Schriftstücken hat sich die Bewegung eindeutig positioniert und zeigt sich der globalen Umweltlage und der Notwendigkeit einer nachhaltigen, umweltschützenden Sportentwicklung wie auch Sportdurchführung bewusst. Die Olympische Bewegung hat sich selbst verpflichtet überall wo es ihr möglich ist, die Umwelt zu schützen und zu fördern. Der adaptierte Leitspruch „Global denken und lokal handeln“ (IOC 1999, 21) soll dies zum Ausdruck bringen.
Naturschädigende Olympische Spiele sind in der heutigen Zeit ethisch und moralisch nicht mehr vertretbar. Das IOC trägt durch seine Übernahme des Umweltschutzes als fundamentales Prinzip eine Verantwortung, dass es selbst wie auch die Ausrichterstädte Olympischer Spiele dieses Prinzip beachten und umsetzen. Diesem muss die Olympische Bewegung nachkommen und den Umweltschutz ernsthaft vertreten und auch vorleben. Dann trägt sie zu einer dauerhaften Stärkung unserer Umwelt bei.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 3. Aufbau und Methodik der Arbeit
- 4. Terminologische Abgrenzungen
- 5. Umweltbewusstsein, umweltgerechtes Verhalten und ökologische Kommunikation
- 6. Entwicklung des Umweltschutzes und dessen Problemfelder
- 7. Der Umweltschutz der Olympischen Bewegung
- 7.1. Der Umweltschutz in der Olympischen Bewegung
- 7.2. Die Entwicklung des Umweltschutzes in der Olympischen Bewegung
- 7.3. Die Umsetzung des Umweltschutzanspruches in der Olympischen Bewegung
- 8. Umweltproblematik und Umweltschutzmöglichkeiten Olympischer Sommerspiele
- 8.1. Planung und Organisation
- 8.2. Bauliche Maßnahmen
- 8.3. Transport und Verkehr
- 8.4. Ressourcen- und Abfallmanagement
- 8.5. Zusammenfassung
- 9. Die Olympischen Spiele in Sydney 2000
- 9.1. Bewerbungs- und Vorbereitungsphase der XXVII. Olympischen Sommerspiele
- 9.2. Umweltschutz und Umweltbewusstsein in Australien
- 9.3. Das Sportstätten- und Umweltschutzkonzept in Sydney 2000
- 9.3.1. Bauliche Maßnahmen und die Umsetzung der Umweltschutzmaßnahmen
- 9.3.2. Transport und Verkehr
- 9.3.3. Ressourcen- und Abfallmanagement
- 9.3.4. Zentrale Umweltprojekte: Homebush Bay und das Olympische Dorf
- 9.3.5. Umweltbildungsmaßnahmen und -effekte der Spiele in Sydney
- 9.4. Die Zeit nach den Spielen – Nachhaltigkeit in Sydney
- 9.5. Beurteilung der Olympischen Spiele in Sydney
- 10. Die Olympischen Spiele in Athen 2004
- 10.1. Bewerbungs- und Vorbereitungsphase der XXVIII. Olympischen Sommerspiele
- 10.2. Umweltschutz und Umweltbewusstsein in Griechenland
- 10.3. Das Sportstätten- und Umweltschutzkonzept in Athen 2004
- 10.3.1. Bauliche Maßnahmen und die Umsetzung der Umweltschutzmaßnahmen
- 10.3.2. Transport und Verkehr
- 10.3.3. Ressourcen- und Abfallmanagement
- 10.3.4. Zentrale Umweltprojekte: Schinias und Markopoulo
- 10.3.5. Umweltbildungsmaßnahmen der Spiele in Athen
- 10.4. Die Zeit nach den Spielen – Nachhaltigkeit in Athen
- 10.5. Beurteilung der Olympischen Spiele in Athen
- 11. Umweltschutz in Sydney 2000 und Athen 2004 – Parallelen und Gegensätze
- 12. Umweltschutz – Dritte Säule der Olympischen Bewegung?
- 13. Ausblick
- 14. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Umweltbelastungen und Umweltschutzmaßnahmen bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney 2000 und Athen 2004. Ziel ist es, den ökologischen Anspruch der Olympischen Bewegung mit der Realität zu vergleichen und dessen Umsetzung zu beurteilen.
- Umweltbelastungen durch Olympische Sommerspiele
- Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen in Sydney und Athen
- Vergleich der Ergebnisse in Sydney und Athen
- Bewertung des Umweltschutzanspruchs der Olympischen Bewegung
- Möglichkeiten zur Verbesserung des Umweltschutzes bei zukünftigen Olympischen Spielen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht Umweltbelastungen und Umweltschutz bei den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney und 2004 in Athen. Sie fragt, inwieweit der ökologische Anspruch der Olympischen Bewegung mit der Realität übereinstimmt und beleuchtet die Notwendigkeit internationaler Umweltpolitik und sozialer Akzeptanz für effektive, nachhaltige Lösungen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Olympischen Sommerspiele aufgrund der weniger offensichtlichen ökologischen Aspekte im Vergleich zu Winterspielen.
2. Forschungsstand: Der Forschungsstand zum Thema Umweltschutz bei Olympischen Spielen ist spärlich. Die Literatur konzentriert sich hauptsächlich auf sportliche Ergebnisse. Sportwissenschaftliche Arbeiten behandeln die Sport-Umwelt-Problematik oft im Zusammenhang mit Sportarten in der Natur. Es gibt wenige Publikationen zum Umweltschutz der Olympischen Bewegung und insbesondere zu den Spielen in Sydney und Athen.
3. Aufbau und Methodik der Arbeit: Die Arbeit gliedert sich in einen Überblick über den Umweltschutz, die Darstellung des Umweltschutzgedankens im IOC, die Analyse der Olympischen Spiele in Sydney und Athen hinsichtlich Bauwesen, Verkehr, Ressourcenverbrauch und Nachhaltigkeit sowie einen Vergleich der beiden Spiele und einen Ausblick. Die Methodik umfasst Literaturrecherche, Experteninterviews und eigene Beobachtungen.
4. Terminologische Abgrenzungen: Die Arbeit klärt die Verwendung der Begriffe Umwelt, Natur, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Ökologie, die in der Literatur und Kommunikation oft unscharf verwendet werden. Es wird eine ökologische Perspektive eingenommen.
5. Umweltbewusstsein, umweltgerechtes Verhalten und ökologische Kommunikation: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Aspekte des Umweltbewusstseins, unterscheidet Umwelttypen und diskutiert die Bedeutung von Umweltwissen, -erleben, -einstellungen und -verhalten. Es wird die kulturelle Gebundenheit von Umweltwahrnehmung und -handlungsmustern und die Rolle von Umweltkommunikation und -bildung im Kontext der Verhaltensänderung hervorgehoben.
6. Entwicklung des Umweltschutzes und dessen Problemfelder: Die Entwicklung des Umweltschutzes wird von seinen Anfängen bis zur heutigen internationalen Umweltpolitik dargestellt. Die Arbeit thematisiert die Problemfelder des Umweltschutzes, wie den Zielkonflikt zwischen Ökologie und Ökonomie, die Schwierigkeit der internationalen Zusammenarbeit und das Problem öffentlicher Güter.
7. Der Umweltschutz der Olympischen Bewegung: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Umweltschutzgedankens innerhalb der Olympischen Bewegung, beginnend mit Coubertins Ideen bis zur aktuellen Verankerung des Umweltschutzes in der Olympischen Charta und der Agenda 21. Es werden die institutionellen Strukturen und Maßnahmen des IOC im Bereich Umweltschutz dargestellt.
8. Umweltproblematik und Umweltschutzmöglichkeiten Olympischer Sommerspiele: Dieses Kapitel beschreibt die Umweltbelastungen durch Olympische Sommerspiele in den Bereichen Planung und Organisation, Bauliche Maßnahmen, Transport und Verkehr, Ressourcen- und Abfallmanagement. Es werden verschiedene Möglichkeiten zur Minimierung dieser Belastungen aufgezeigt.
9. Die Olympischen Spiele in Sydney 2000: Das Kapitel analysiert die Olympischen Spiele in Sydney 2000, die als "Green Games" bekannt sind. Es wird die Bewerbungsphase, das Sportstättenkonzept, die Umweltschutzmaßnahmen, die Umweltbildung und die Nachhaltigkeit der Spiele untersucht. Die Zusammenarbeit mit Greenpeace und die Herausforderungen der Nachnutzung werden ebenfalls diskutiert.
10. Die Olympischen Spiele in Athen 2004: Analog zu Kapitel 9 wird hier die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2004 in Athen untersucht. Es werden die Bewerbungsphase, die Herausforderungen der Vorbereitung, das Sportstättenkonzept, die Umweltschutzmaßnahmen, die Umweltbildung und die Nachhaltigkeit der Spiele beleuchtet. Der Vergleich mit den Zielen und der Realität wird ebenfalls durchgeführt.
11. Umweltschutz in Sydney 2000 und Athen 2004 – Parallelen und Gegensätze: Dieser Abschnitt vergleicht die Umweltschutzmaßnahmen und deren Erfolge in Sydney und Athen. Die Unterschiede im Umweltbewusstsein und den politischen Rahmenbedingungen der beiden Länder werden analysiert. Der Begriff Greenwashing wird im Kontext beider Spiele diskutiert.
12. Umweltschutz – Dritte Säule der Olympischen Bewegung?: Das Kapitel bewertet kritisch, ob der Umweltschutz tatsächlich eine gleichberechtigte Säule der Olympischen Bewegung neben Sport und Kultur ist. Die Rolle des IOC, die Umsetzung der Umweltschutzmaßnahmen und die Glaubwürdigkeit der Olympischen Bewegung im Bereich Umweltschutz werden analysiert.
13. Ausblick: Der Ausblick formuliert Vorschläge zur Verbesserung des Umweltschutzes bei zukünftigen Olympischen Spielen. Es werden konkrete Maßnahmen zur Stärkung des Umweltschutzes im IOC, bei den OCOGs und in der Umweltkommunikation vorgeschlagen.
14. Zusammenfassung: Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und betont die Notwendigkeit eines stärker ausgeprägten und konsequent umgesetzten Umweltschutzes innerhalb der Olympischen Bewegung.
Schlüsselwörter
Olympische Spiele, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Sydney 2000, Athen 2004, IOC, Umweltbelastung, Ressourcenmanagement, Abfallmanagement, Umweltkommunikation, Umweltbildung, Greenwashing, Nachnutzung, Energieeffizienz, Verkehrskonzept, Biodiversität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Umweltschutz bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney 2000 und Athen 2004
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Umweltbelastungen und die getroffenen Umweltschutzmaßnahmen während der Olympischen Sommerspiele in Sydney 2000 und Athen 2004. Sie vergleicht den ökologischen Anspruch der Olympischen Bewegung mit der Realität und bewertet die Umsetzung der Umweltschutzmaßnahmen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den ökologischen Anspruch der Olympischen Bewegung kritisch zu hinterfragen und die Effektivität der umgesetzten Umweltschutzmaßnahmen zu beurteilen. Sie untersucht die Umweltbelastungen der Spiele, vergleicht die Ergebnisse in Sydney und Athen und entwickelt Vorschläge zur Verbesserung des Umweltschutzes bei zukünftigen Olympischen Spielen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie Umweltbelastungen durch Olympische Spiele (Planung, Bau, Transport, Ressourcenmanagement), die Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen in Sydney und Athen, ein detaillierter Vergleich beider Spiele hinsichtlich ihrer ökologischen Bilanz, die Bewertung des Umweltschutzanspruchs der Olympischen Bewegung und Möglichkeiten zur Verbesserung des Umweltschutzes bei zukünftigen Spielen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in 14 Kapitel: Einleitung, Forschungsstand, Methodik, terminologische Abgrenzungen, Umweltbewusstsein und -kommunikation, Entwicklung des Umweltschutzes, Umweltschutz in der Olympischen Bewegung, Umweltproblematik und -schutzmöglichkeiten bei Sommerspielen, detaillierte Analysen der Spiele in Sydney 2000 und Athen 2004, ein Vergleich beider Spiele, die Rolle des Umweltschutzes als „dritte Säule“ der Olympischen Bewegung, ein Ausblick und eine Zusammenfassung.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit basiert auf Literaturrecherche, Experteninterviews und eigenen Beobachtungen. Es wird eine ökologische Perspektive eingenommen und die verwendeten Begriffe (Umwelt, Nachhaltigkeit etc.) terminologisch abgegrenzt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine detaillierte Analyse der Umweltbelastungen und der Umweltschutzmaßnahmen in Sydney und Athen. Sie vergleicht die Erfolge und Misserfolge beider Spiele und bewertet kritisch den Umweltschutzanspruch der Olympischen Bewegung. Schließlich werden Vorschläge zur Verbesserung des Umweltschutzes bei zukünftigen Olympischen Spielen formuliert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der Umweltschutz in der Olympischen Bewegung zwar Fortschritte gemacht hat, aber weiterhin erhebliches Verbesserungspotenzial besteht. Es wird die Notwendigkeit eines stärker ausgeprägten und konsequent umgesetzten Umweltschutzes betont und konkrete Maßnahmen vorgeschlagen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Olympische Spiele, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Sydney 2000, Athen 2004, IOC, Umweltbelastung, Ressourcenmanagement, Abfallmanagement, Umweltkommunikation, Umweltbildung, Greenwashing, Nachnutzung, Energieeffizienz, Verkehrskonzept, Biodiversität.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende, Umweltorganisationen, das Internationale Olympische Komitee (IOC), Organisationskomitees der Olympischen Spiele und alle, die sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Sport interessieren.
- Arbeit zitieren
- Michael Westerberg (Autor:in), 2007, Umweltbelastungen und Umweltschutz bei Olympischen Sommerspielen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90264