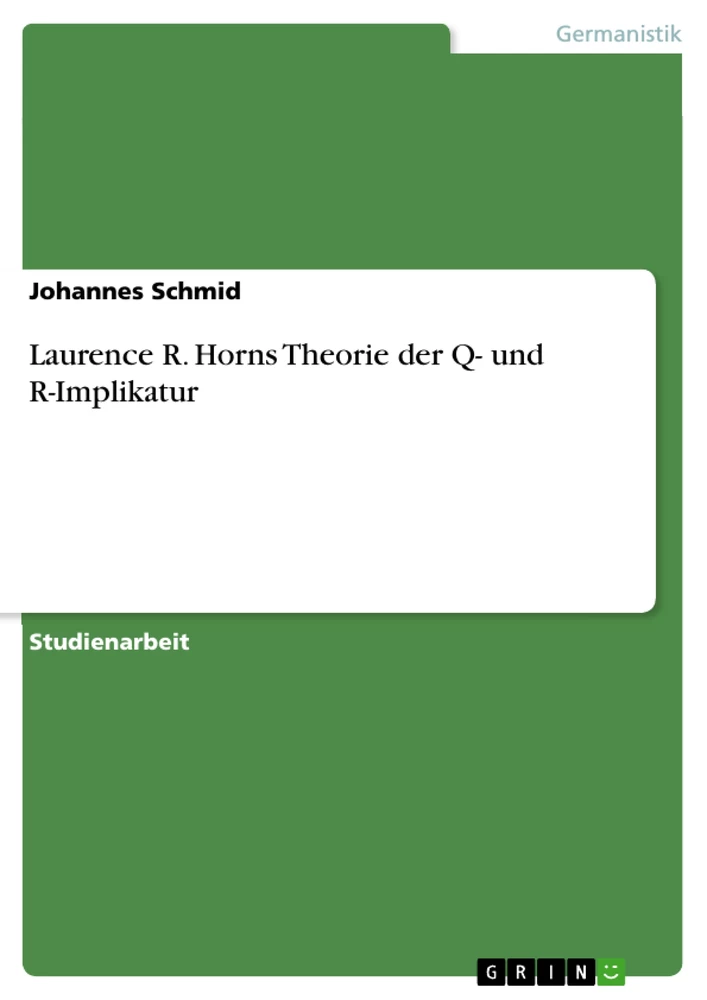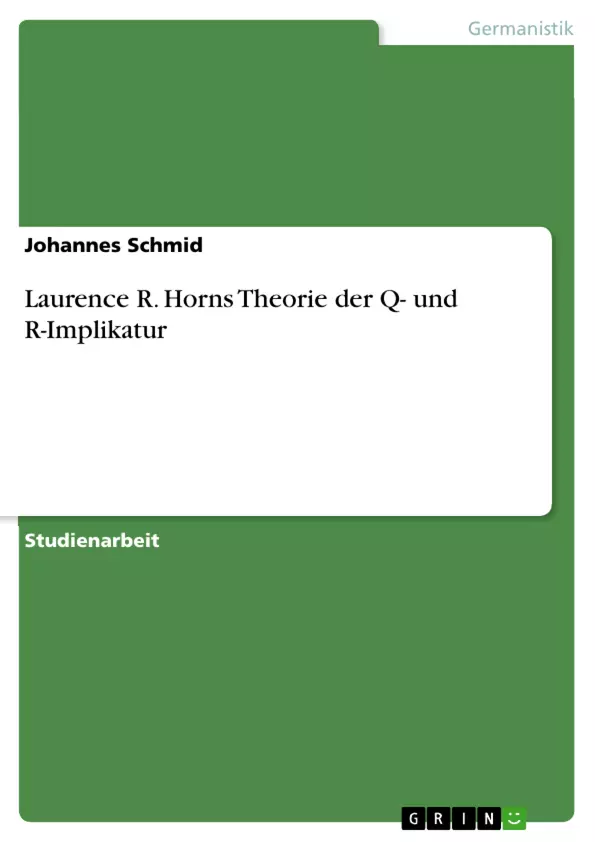In seinem Aufsatz „Logic and Conversation“ von 1975 beschäftigt sich H. Paul Grice mit dem Phänomen der Differenz zwischen Gesagtem und Gemeintem. Einen Teil solcher Fälle beschreibt er als sogenannte Implikaturen, wobei er sein Augenmerk v.a. auf die „conversational implicatures“ (Grice 1975, S.307) richtet. Er geht dabei von der Existenz eines Kooperationsprinzips und bestimmter Maximen für die Gesprächsführung aus, deren Beachtung durch den Sprecher der Hörer grundsätzlich voraussetzt. Falls eine Äußerung durch den Sprecher nun auf den ersten Blick gegen diese Prinzipien verstößt oder sie nur mäßig erfüllt, interpretiert der Hörer Grice zufolge diese Äußerung in einer Weise um, so dass zumindest das Gemeinte mit den Prinzipien in Einklang ist. Diese Uminterpretierung über das wörtlich Gesagte, die Semantik der Äußerung hinaus, ist das, was Grice als konversationelle Implikatur bezeichnet.
Grice und in seiner Nachfolge und Weiterführung auch Stephen Levinson (in dem Kapitel „Conversational implicature“ seines Grundlagenbuches „Pragmatics“ von 1983, deutsch 1994) teilen die konversationellen Implikaturen in dreierlei Hinsicht ein: Zum einen nehmen sie eine Einteilung der Implikaturen nach der jeweiligen Gesprächsmaxime vor, die für das Zustandekommen der Implikatur verantwortlich ist, d.h. also z. B. der Quantitätsmaxime, der Maxime der Art und Weise, etc.. Zum zweiten unterteilt Levinson die konversationellen Implikaturen in Standardimplikaturen, bei denen der Sprecher die Maximen grundsätzlich beachtet, und in Implikaturen, die entstehen, wenn der Sprecher eine oder mehrere der Maximen bewußt mißachtet, verletzt oder ausschöpft. Als dritte Einteilungskategorie dient Grice und Levinson die Frage, ob die entstandene konversationelle Implikatur von spezifischen Kontexten abhängig – also partikularisiert ist, oder ob sie generalisiert ist, d. h. „ohne einen bestimmten Kontext oder ein besonderes Szenario“ (Levinson 1994, S. 128) auskommt.
In seinem 1984 erschienen Aufsatz „Toward a new taxonomy for pragmatic inference: Q-based and R-based implicature“ versucht Laurence R. Horn nun, das Phänomen der konversationellen Implikatur mit Hilfe von nur zwei grundlegenden Prinzipien zu erklären, dem sogenannten Q-Prinzip und dem sogenannten R-Prinzip.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Laurence R. Horns Aufsatz „Toward a new taxonomy for pragmatic inference: Q-based and R-based implicature“:
- Zusammenfassung und kritische Kommentierung
- Diskussion von Problemen der R-Implikatur anhand einiger Beispiele
- Zitierte Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Laurence R. Horns Theorie der Q- und R-Implikatur und untersucht, wie diese Theorie die Grice'schen Maximen der Konversationslogik vereinfachen und erweitern kann.
- Zusammenfassung und kritische Analyse von Horns Theorie der Q- und R-Implikatur
- Beziehung zwischen Horns Theorie und dem Prinzip des geringsten Aufwands (Zipf)
- Diskussion der Probleme der R-Implikatur anhand von Beispielen
- Vergleich von Horns Theorie mit der klassischen Theorie der konversationellen Implikatur
- Anwendung der Q- und R-Implikatur auf verschiedene Kommunikationskontexte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der konversationellen Implikatur ein und stellt die grundlegenden Theorien von Grice und Levinson vor. Sie beschreibt den Unterschied zwischen Gesagtem und Gemeintem und erklärt das Konzept der Implikatur als Mittel zur Überbrückung dieser Differenz.
Laurence R. Horns Aufsatz „Toward a new taxonomy for pragmatic inference: Q-based and R-based implicature“ - Zusammenfassung und kritische Kommentierung
Dieser Abschnitt fasst die wichtigsten Punkte von Horns Aufsatz zusammen und stellt seine Theorie der Q- und R-Implikatur dar. Dabei wird auch auf die Kritik an Horns Theorie eingegangen, insbesondere die Frage, ob seine Reduktion der Grice'schen Maximen auf zwei Prinzipien gerechtfertigt ist.
Diskussion von Problemen der R-Implikatur anhand einiger Beispiele
Dieser Abschnitt analysiert die Probleme der R-Implikatur anhand konkreter Beispiele und zeigt, wie diese Theorie in bestimmten Fällen zu ungenauen oder irreführenden Interpretationen führen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der konversationellen Implikatur, insbesondere mit der Theorie von Laurence R. Horn, der die klassischen Grice'schen Maximen auf zwei grundlegende Prinzipien, das Q-Prinzip und das R-Prinzip, reduziert. Weitere Schlüsselbegriffe sind Sprecherökonomie, Hörerökonomie, Skalare Implikatur, Prinzip des geringsten Aufwands (Zipf) und Pragmatik.
- Quote paper
- M.A. Johannes Schmid (Author), 1999, Laurence R. Horns Theorie der Q- und R-Implikatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90278