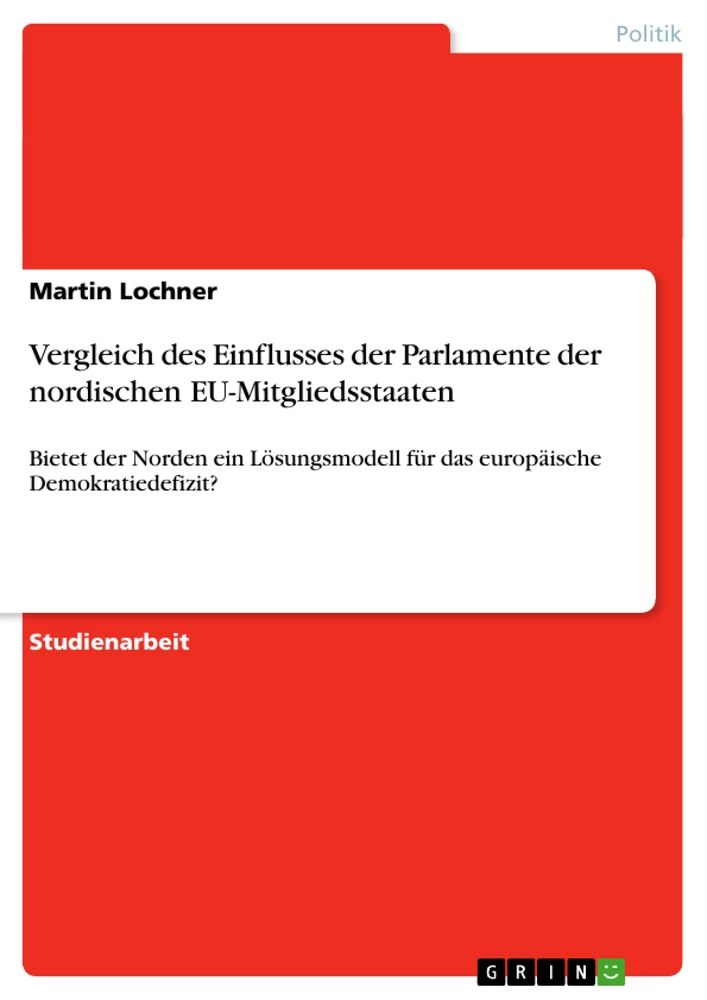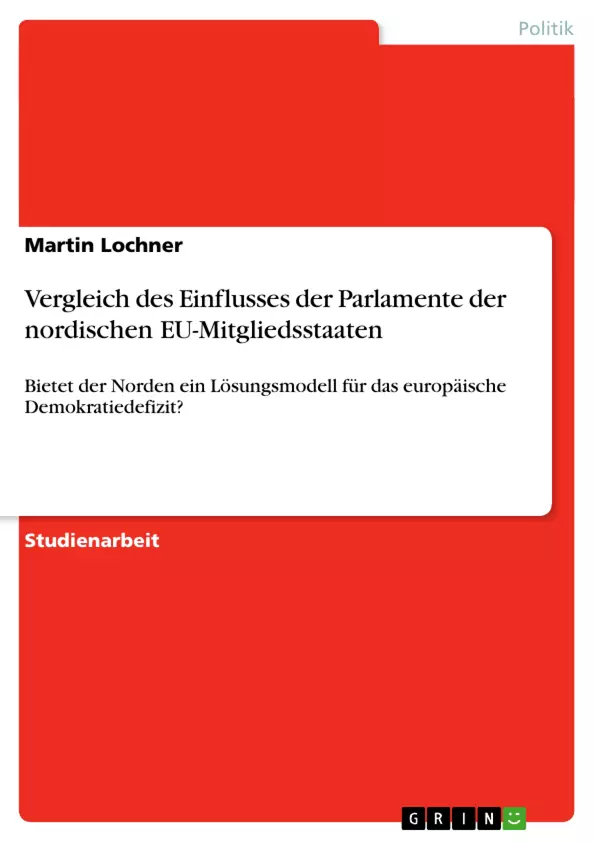Ein im Zusammenhang mit der Vertiefung der Europäischen Union häufig genanntes Problem ist das des Demokratiedefizits. In der Tat dürfte außer Frage stehen, dass im Verlauf der letzten Jahrzehnte der Rat der Europäischen Union bzw. der Europäische Rat zunehmend Machtbefugnisse im Bereich der Legislative akkumuliert hat, die damit umgekehrt den nationalen Parlamenten entzogen wurden (Maurer 2002a: 37). Zwar wurden gleichzeitig auch die Befugnisse des Europäischen Parlaments erheblich ausgeweitet, jedoch keineswegs so stark, dass es den Verlust an demokratischer Legitimation kompensieren könnte, der durch den Bedeutungsverlust der nationalen Parlamente entstand (Maurer 2002a: 368). Neben den offensichtlichen Handlungsoptionen wie einer Rückverlagerung von Politikfeldern von EU-Ebene auf
nationale Ebene oder einer weiteren massiven Aufwertung des Europäischen Parlaments gibt es grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass die nationalen Parlamente ihren Bedeutungsverlust in legislativer Hinsicht durch eine Verstärkung ihrer Kontrollfunktion gegenüber ihrer jeweiligen Regierung kompensieren (Maurer 2002a: 214). Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, sich der Frage zuzuwenden, wie es den Parlamenten der nordischen EU-Mitglieder, nämlich Schweden, Finnland und Dänemark, gelungen ist, durch entsprechende Ausweitung ihrer Kontrollfunktion gegenüber ihren Regierungen, ein demokratisches Defizit zu vermeiden oder doch zumindest vergleichsweise gering zu halten. Die folgende Arbeit wird zeigen, dass es den Parlamenten dieser drei Mitgliedsstaaten gelungen ist, erheblichen Einfluss auf Entscheidungsprozesse der Europäischen Union zu erreichen und zu erhalten. Nach einer Darstellung dieser starken Stellung werden die Gründe hierfür erörtert und schließlich ein Vergleich zwischen den untersuchten drei nordischen Parlamenten
gezogen. Obwohl die anderen beiden nordischen Staaten, Norwegen und Island, keine Mitglieder der
europäischen Union sind, wäre es durchaus naheliegend, diese in die vorliegende Arbeit mit
einzubeziehen, da beide Länder Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums sind. Norwegen
ist darüber hinaus auch dem Schengener Abkommen beigetreten und ist faktisch assoziiertes
Mitglied der GASP (Claes 2004: 264). Aus diesem Grund muss etwa Norwegen etwa 95%
des europäischen acquis communautaire übernehmen (Sverdrup 2004: 26). Zweifellos ist
daher auch Norwegen, und in geringerem Maße Island, vom Prozess der der Europäisierung
betroffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung der starken Stellung der nordischen Parlamente in EU-Angelegenheiten
- Dänemark als Vorreiter und Vorbild
- Antizipation als wesentliches Prinzip des nordischen Verfahrens
- Transparenz
- Gründe für die starke Stellung der nordischen Parlamente gegenüber ihrer Regierung
- Minderheitsregierungen als Grundlage für starke Parlamente
- Einbeziehung der Interessengruppen
- Konsenskultur
- Informationspolitik der Regierungen
- Zugriff auf regierungsunabhängige Informationsquellen
- Personelle Besetzung der EU-Ausschüsse
- Hohe Arbeitsleistung der EU-Ausschüsse
- Skepsis der Bevölkerung gegenüber der Europäischen Integration
- Unterschiede zwischen den nordischen Parlamenten in Hinsicht auf ihre Mitwirkung bei europäischen Entscheidungsprozessen
- Stellung der Ausschüsse im System
- Verbindlichkeit und Flexibilität der Mandate
- Probleme bei der parlamentarischen Kontrolle
- Arbeitsüberlastung der Parlamentarier
- Grenzen der Kontrollmöglichkeit durch das Parlament
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die starke Stellung der nordischen Parlamente in der Europäischen Union und untersucht, ob diese ein Modell für die Bewältigung des europäischen Demokratiedefizits darstellen. Sie beleuchtet insbesondere die Kontrollfunktion der Parlamente gegenüber ihren Regierungen in Bezug auf europäische Entscheidungen.
- Die Bedeutung der nationalen Parlamente in europäischen Entscheidungsprozessen
- Der Einfluss der nordischen Parlamente auf die Verhandlungspositionen ihrer Regierungen
- Die Rolle von Transparenz, Antizipation und Konsenskultur in der EU-Politik
- Mögliche Probleme und Grenzen der parlamentarischen Kontrolle in der EU
- Ein Vergleich der verschiedenen Ansätze und Praktiken in den nordischen Staaten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem des Demokratiedefizits in der Europäischen Union dar und erläutert die Relevanz der Untersuchung der Rolle der nordischen Parlamente. Die zweite Sektion präsentiert die starke Stellung der nordischen Parlamente in EU-Angelegenheiten, wobei Dänemark als Vorreiter für diese Entwicklung dargestellt wird. Das Prinzip der Antizipation und die Bedeutung von Transparenz werden ebenfalls diskutiert. Der dritte Abschnitt analysiert die Gründe für die starke Stellung der nordischen Parlamente, die sich aus Minderheitsregierungen, Einbeziehung von Interessengruppen, Konsenskultur und einer aktiven Informationspolitik der Regierungen sowie dem Zugang zu unabhängigen Informationsquellen und einer professionellen Besetzung der EU-Ausschüsse ergeben. Des Weiteren wird die Rolle der Skepsis der Bevölkerung gegenüber der Europäischen Integration behandelt. Der vierte Abschnitt beleuchtet die Unterschiede zwischen den nordischen Parlamenten in Bezug auf ihre Mitwirkung bei europäischen Entscheidungsprozessen, insbesondere im Hinblick auf die Stellung der Ausschüsse und die Verbindlichkeit von Mandaten. Im fünften Kapitel werden die Herausforderungen und Probleme im Bereich der parlamentarischen Kontrolle, wie Arbeitsüberlastung und Grenzen der Kontrollmöglichkeiten, thematisiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf das europäische Demokratiedefizit, die Rolle der nationalen Parlamente, die EU-Politik der nordischen Staaten, die Kontrollfunktion der Parlamente, die Prinzipien von Transparenz und Antizipation, die Einbeziehung von Interessengruppen, Konsenskultur und Minderheitsregierungen.
- Quote paper
- Martin Lochner (Author), 2006, Vergleich des Einflusses der Parlamente der nordischen EU-Mitgliedsstaaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90292