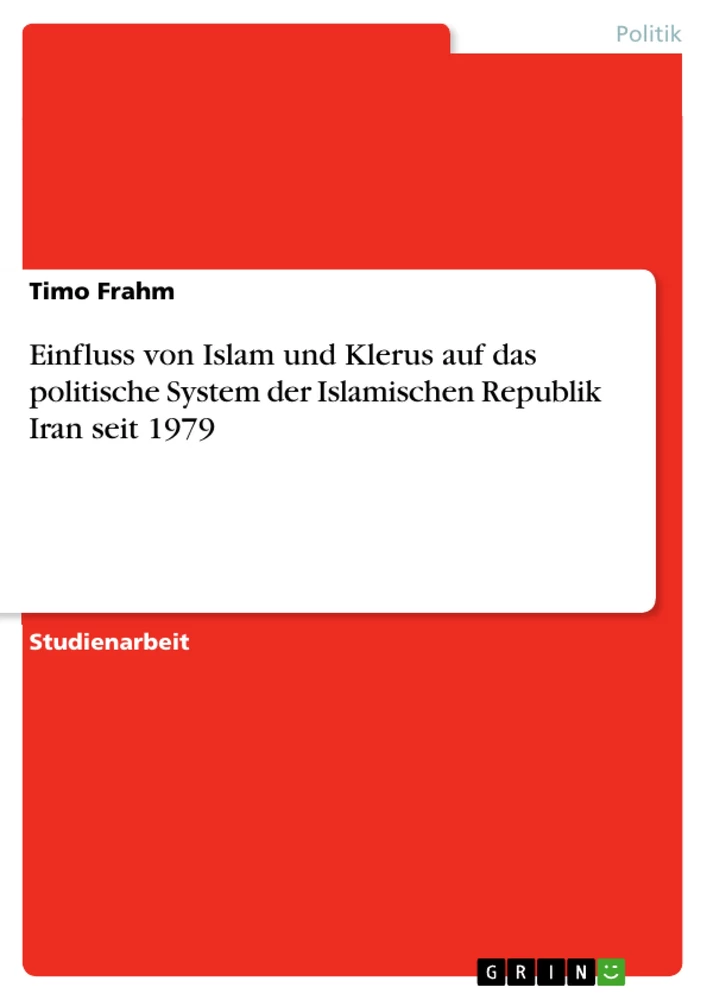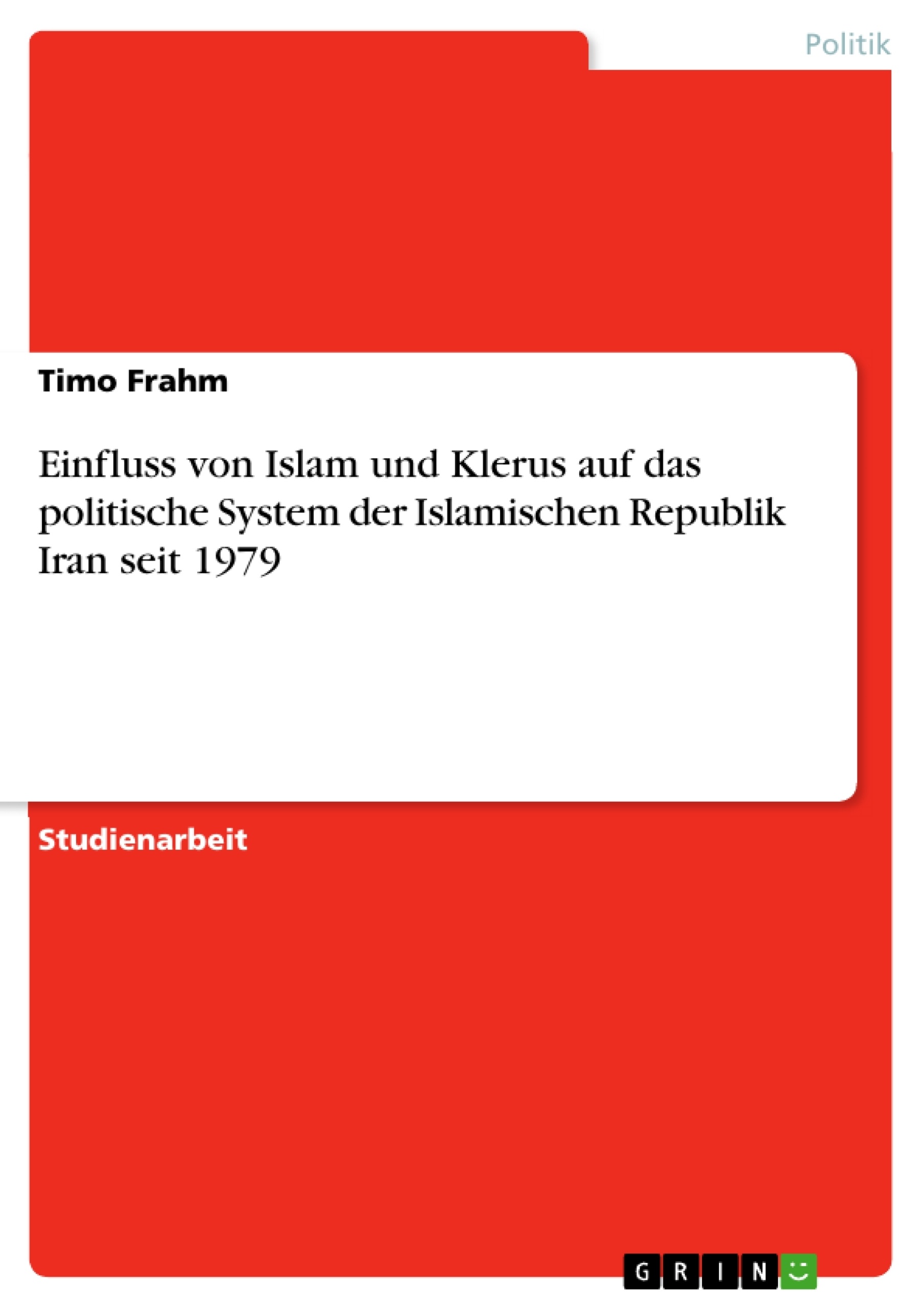Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage, wie sich der Einfluss von Islam und Klerus auf das politische System des Iran seit 1979 im Detail äußerte.
Im Zentrum der Analyse stehen nicht alle Details des schiitischen Islam, sondern sein Einfluss auf das politische System des Iran. Die Unterscheidung von Islam und Klerus ist hierbei notwendig. Der Islam im theoretischen Sinne umfasst vor allem seine religiösen Rechtsquellen. Die aus diesen Rechtsquellen hervorgehenden Prinzipien lassen sich teilweise auf den Aufbau eines politischen Systems übertragen, wie die Analyse zeigen wird. Der Klerus ist im Gegensatz dazu kein theoretisches Konstrukt, sondern eine Gruppe von geistlichen Amtsträgern. Ihr Einfluss und der des Islam auf das politische System des Iran sind nicht gleichzusetzen, da nicht garantiert ist, dass Mitglieder des Klerus einzig und allein von den islamischen Rechtsquellen geleitet werden. Stattdessen ist es möglich, dass auch andere Interessen ihr Handeln beeinflussen.
Nach der Einordnung der Arbeit in den fachlichen Kontext der Politikwissenschaft wird der Begriff des politischen Systems definiert. Anschließend wird die Historie von Islam und Klerus in den Gebieten des heutigen Iran bis 1979 dargestellt. Dies soll eine fundierte Basis für die Analyse des Einflusses von Islam und Klerus auf das politische System der Islamischen Republik Iran seit 1979 bieten. Mit seit 1979 ist jenes politische System gemeint, das sich durch das Referendum über die Verfassung der Islamischen Republik Iran 1979 und die darauffolgende Verfassungsänderung im Jahr 1989 etablierte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verortung dieser Hausarbeit im politikwissenschaftlichen Kontext
- Definition des politischen Systems
- Historie von Islam und Klerus in den Gebieten des heutigen Iran bis 1979
- Islamisierung
- Mongolische Fremdherrschaft
- Schiismus wird Staatsreligion
- Tendenzen der Säkularisierung
- Islamische Revolution 1978/1979
- Ursachen der Revolution
- Klerikale Revolutionsführung
- Einfluss von Islam und Klerus auf das politische System der Islamischen Republik
- Einfluss von Islam und Klerus auf die Grundlagen des Staates
- Einfluss von Islam und Klerus auf die Gewaltenteilung
- Einfluss von Islam und Klerus auf die Legislative
- Einfluss von Islam und Klerus auf die Exekutive
- Einfluss von Islam und Klerus auf die Judikative
- Einfluss von Islam und Klerus auf die vertikale Gewaltenteilung und die Macht der Bürger*innen
- Einfluss von Islam und Klerus auf die außen- und sicherheitspolitische Entscheidungsfindung und -implementation
- Einfluss von Islam und Klerus auf die Medien
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den Einfluss von Islam und Klerus auf das politische System der Islamischen Republik Iran seit 1979. Dabei werden die wesentlichen Auswirkungen des Islam und des Klerus auf die Staatsgrundlagen, die Gewaltenteilung, die Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Medien beleuchtet.
- Die Rolle des Islam und des Klerus in der Gestaltung des politischen Systems der Islamischen Republik Iran
- Die Auswirkungen des Islam und des Klerus auf die Gewaltenteilung und die Machtverhältnisse im Iran
- Die Bedeutung des Islam und des Klerus für die Außen- und Sicherheitspolitik des Iran
- Der Einfluss des Islam und des Klerus auf die iranischen Medien
- Die historische Entwicklung des Verhältnisses von Islam und Klerus zum politischen System im Iran
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein, beleuchtet die Bedeutung von Islam und Klerus für das politische System des Iran und erläutert die Methodik der Analyse.
- Verortung dieser Hausarbeit im politikwissenschaftlichen Kontext: Dieses Kapitel ordnet die Hausarbeit in den Kontext der Politikwissenschaft ein und definiert die relevanten Disziplinen.
- Definition des politischen Systems: In diesem Kapitel wird der Begriff des politischen Systems definiert und anhand der Islamischen Republik Iran beispielhaft erläutert.
- Historie von Islam und Klerus in den Gebieten des heutigen Iran bis 1979: Die Kapitel 4.1 bis 4.4 beschreiben die historische Entwicklung des Verhältnisses von Islam und Klerus in den Gebieten des heutigen Iran, wobei insbesondere die Islamisierung, die mongolische Fremdherrschaft und die Einführung des Schiismus als Staatsreligion im 16. Jahrhundert beleuchtet werden.
- Islamische Revolution 1978/1979: Die Kapitel 5.1 und 5.2 befassen sich mit den Ursachen der Islamischen Revolution von 1979 und der Rolle des Klerus in der Revolutionsführung.
- Einfluss von Islam und Klerus auf das politische System der Islamischen Republik: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Islam und Klerus auf die Staatsgrundlagen, die Gewaltenteilung (Legislative, Exekutive, Judikative), die Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Medien.
Schlüsselwörter
Islamische Republik Iran, Islam, Klerus, Politik, Staatsgrundlagen, Gewaltenteilung, Außen- und Sicherheitspolitik, Medien, Islamische Revolution, Schiismus, Geschichte, Politikwissenschaft.
- Quote paper
- Timo Frahm (Author), 2020, Einfluss von Islam und Klerus auf das politische System der Islamischen Republik Iran seit 1979, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/903376