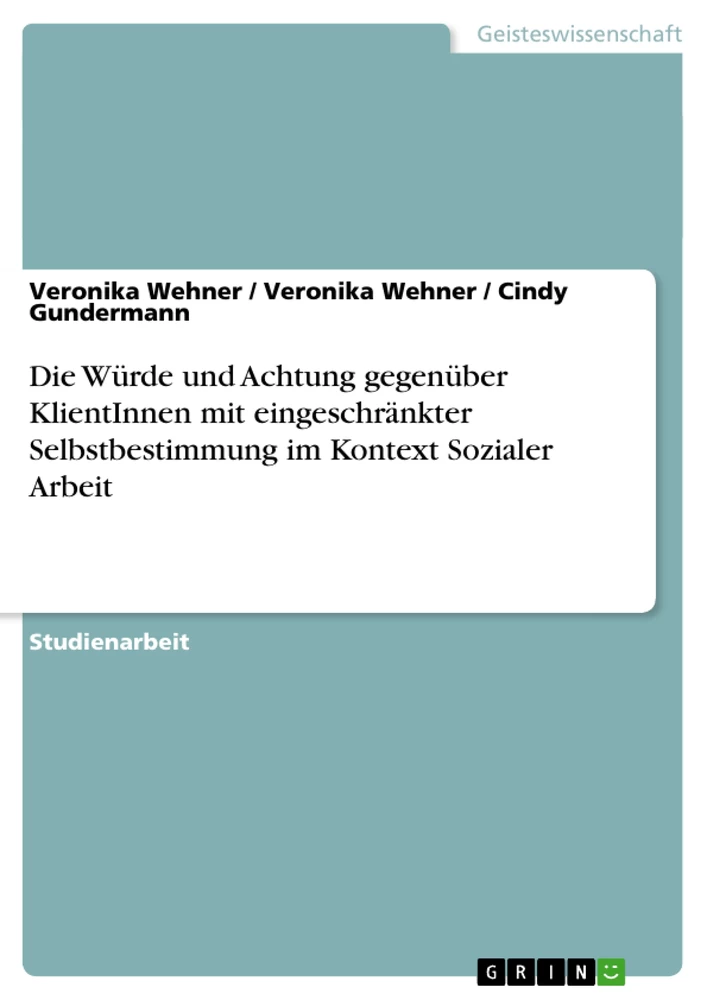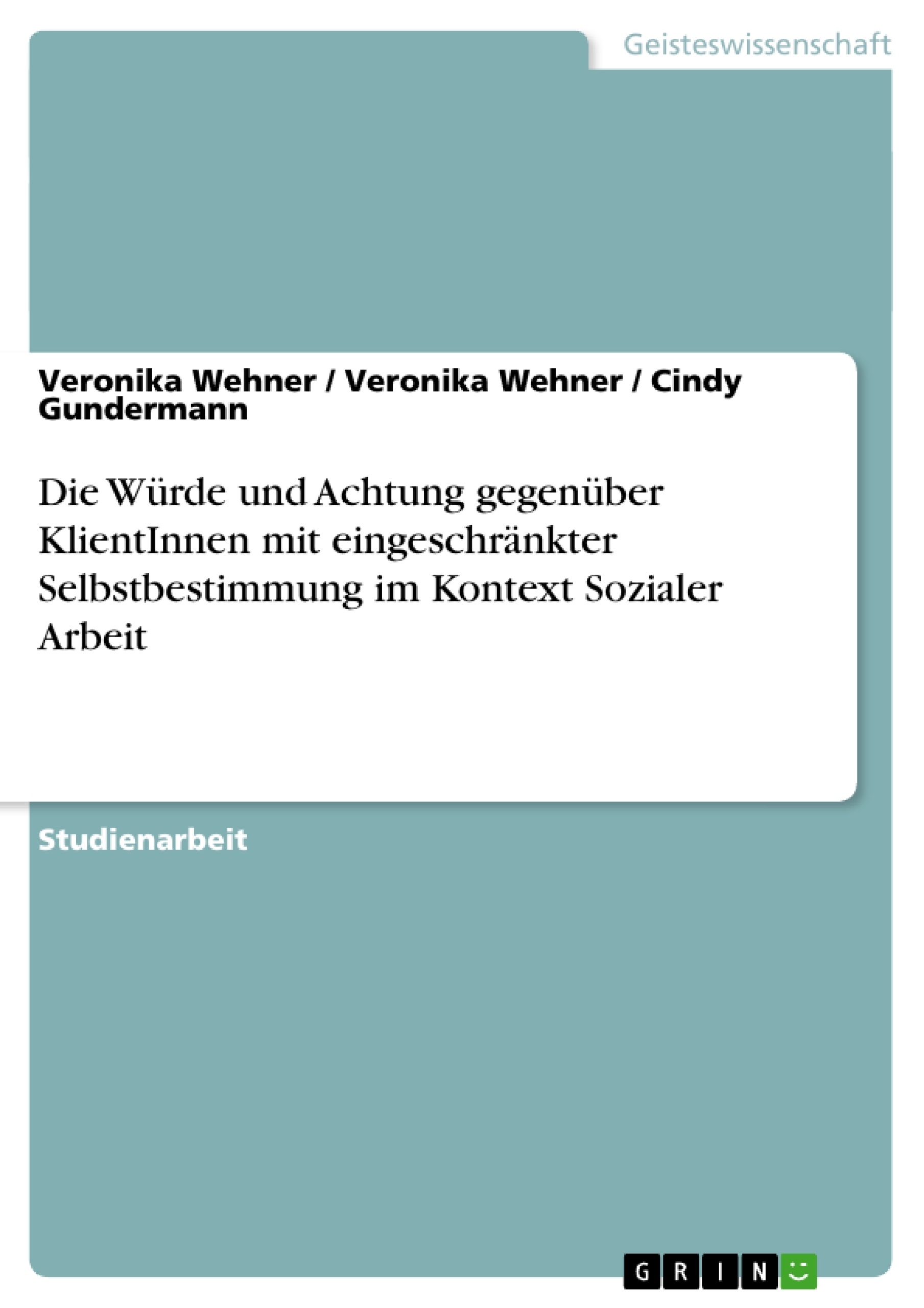Nach unseren Recherchen, sind wir der Ansicht, dass es schwierig ist, im Kontext Sozialer Arbeit, die Würde und Achtung von Menschen mit eingeschränkter Selbstbestimmung immer gerecht zu wahren. Oftmals fehlt uns als SozialarbeiterInnen im Umgang mit diesen Klienten das erforderliche Hintergrundwissen was diesen Menschen geprägt hat und welche Auffassungen dieser hieraus trägt, um explizit die Wünsche bzw. Bedürfnisse zu erfassen und umzusetzen. Aus diesem Grund sollte sich ein Sozialarbeiter/ eine Sozialarbeiterin immer die Frage stellen, ob er/ sie in der Situation des z.B. vergreisten oder behinderten Menschen, mit den Gegebenheiten um ihn herum zufrieden wäre. Tut er dies, handelt er mit besten Wissen und Gewissen und kann hierdurch seinem gegenüber die größtmögliche Achtung und Würde seiner Person entgegenbringen. Wir als SozialarbeiterInnen sind in den meisten Kontexten gezwungen, Entscheidungen vollkommen autonom zu treffen. Dies bedeutet, dass wir als Sozialarbeiter bei Fehlentscheidungen damit rechnen müssen, die vollen Konsequenzen aus unserem Handeln vertreten zu haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 1.1 Problemaufriss
- 1.2 Zentrale Fragestellung
- 2.0 Begriffsdefinitionen
- 2.1 Definition „Noch - Nicht - Personen“
- 2.2 Definition „Niemals - Personen“
- 2.3 Definition „Nicht - Mehr - Personen“
- 2.4 Definition von Personen nach Peter Singer
- 3.0 Vorstellung von Peter Singer und seiner Auffassung über die utilitaristische Ethik
- 4.0 Fallbeispiele aus der Praxis Sozialer Arbeit in Bezug auf KlientInnen mit eingeschränkter Selbstbestimmung
- 4.1 Fallbeispiel „Niemals – Personen“
- 4.2 Fallbeispiel „Nicht - Mehr - Personen“
- 4.3 Gesamteindruck zur Diskussionsrunde
- 4.4 Fazit geschilderter Fallbeispiele
- 5.0 Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung untersucht ethische Konflikte in der Sozialen Arbeit im Umgang mit Klienten, deren Selbstbestimmung eingeschränkt ist. Ziel ist es, die Verwirklichung von Würde und Achtung gegenüber diesen Personen im professionellen Kontext zu hinterfragen.
- Würde und Achtung im Kontext eingeschränkter Selbstbestimmung
- Definition und Abgrenzung verschiedener Personengruppen („Noch-Nicht-Personen“, „Niemals-Personen“, „Nicht-Mehr-Personen“)
- Anwendung utilitaristischer Ethik in der Sozialen Arbeit
- Fallbeispiele aus der Praxis Sozialer Arbeit
- Ethische Herausforderungen im professionellen Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der berufsethischen Konflikte in der Sozialen Arbeit ein und begründet die Wahl des Themas „Die Würde und Achtung gegenüber KlientInnen mit eingeschränkter Selbstbestimmung“. Die Autoren erläutern, warum andere ethisch relevante Bereiche, wie Organspende oder Sterbehilfe, im Kontext ihrer Tätigkeit eine untergeordnete Rolle spielen, da sie hauptsächlich beratend tätig sind. Die Verankerung der Menschenwürde im Grundgesetz wird hervorgehoben und die Bedeutung der Achtung der Klienten im berufsethischen Kodex des DBSH betont. Der Einleitungsteil unterstreicht die Notwendigkeit, sich mit den Herausforderungen im Umgang mit Klienten mit eingeschränkter Selbstbestimmung auseinanderzusetzen.
1.1 Problemaufriss: Dieser Abschnitt beleuchtet die grundlegenden ethischen Prinzipien, insbesondere die Unantastbarkeit der Menschenwürde und das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung. Die Autoren diskutieren die fehlende allgemeingültige Definition von „Würde“ und „Achtung“ und greifen auf Definitionen aus Wikipedia zurück. Es wird auf die möglichen Konflikte im Umgang mit Klienten unterschiedlicher Herkunft, Fähigkeiten und Voraussetzungen eingegangen, wobei die Gefahr einer unbewussten oder bewussten Missachtung der Würde besonders bei Menschen mit geistigen Behinderungen oder Demenz hervorgehoben wird. Der Abschnitt bereitet den Boden für die zentrale Fragestellung der Arbeit.
1.2 Zentrale Fragestellung: Die zentrale Fragestellung formuliert die Kernaufgabe der Ausarbeitung: Kann die Würde und Achtung gegenüber „Noch-Nicht-Personen“, „Niemals-Personen“ und „Nicht-Mehr-Personen“ im Kontext professioneller Sozialer Arbeit stets verwirklicht werden? Dieser prägnante Satz fokussiert das Hauptanliegen der Arbeit und leitet direkt in die Begriffsdefinitionen über.
2.0 Begriffsdefinitionen: Dieser Abschnitt liefert Definitionen für die zentralen Begriffe „Noch-Nicht-Personen“, „Niemals-Personen“ und „Nicht-Mehr-Personen“. Die Autoren betonen, dass jeder Mensch mit der Geburt rechtlich als Person gilt, jedoch gesetzliche Einschränkungen der Geschäftsfähigkeit existieren. Der Bezug auf §1 und §104 ff. BGB verdeutlicht die rechtliche Perspektive und legt den Grundstein für eine differenzierte ethische Betrachtung der jeweiligen Personengruppen.
Schlüsselwörter
Würde, Achtung, Selbstbestimmung, eingeschränkte Selbstbestimmung, Soziale Arbeit, Berufsethik, utilitaristische Ethik, „Noch-Nicht-Personen“, „Niemals-Personen“, „Nicht-Mehr-Personen“, Menschenrechte, professionelles Handeln, Fallbeispiele, geistige Behinderung, Altersdemenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ethische Konflikte in der Sozialen Arbeit im Umgang mit Klienten mit eingeschränkter Selbstbestimmung
Was ist der Gegenstand dieser Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung untersucht ethische Konflikte in der Sozialen Arbeit, insbesondere im Umgang mit Klienten, deren Selbstbestimmung eingeschränkt ist. Der Fokus liegt auf der Verwirklichung von Würde und Achtung gegenüber diesen Personen im professionellen Kontext.
Welche Personengruppen werden betrachtet?
Die Ausarbeitung differenziert zwischen drei Personengruppen: „Noch-Nicht-Personen“, „Niemals-Personen“ und „Nicht-Mehr-Personen“. Diese Kategorien werden definiert und im Hinblick auf ihre ethische Bedeutung im Kontext Sozialer Arbeit analysiert.
Welche ethische Perspektive wird eingenommen?
Die Arbeit bezieht sich auf die utilitaristische Ethik, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung der Prinzipien von Peter Singer. Sie untersucht, wie diese ethische Perspektive auf den Umgang mit Personen mit eingeschränkter Selbstbestimmung angewendet werden kann.
Welche Rolle spielt die Selbstbestimmung?
Die eingeschränkte Selbstbestimmung der Klienten bildet den zentralen Konfliktpunkt der Arbeit. Es wird untersucht, wie Würde und Achtung trotz dieser Einschränkung gewährleistet werden können. Die Arbeit hinterfragt die Verwirklichung von Würde und Achtung gegenüber diesen Personen im professionellen Kontext.
Welche Fallbeispiele werden präsentiert?
Die Ausarbeitung enthält Fallbeispiele aus der Praxis Sozialer Arbeit, die die ethischen Herausforderungen im Umgang mit Klienten mit eingeschränkter Selbstbestimmung veranschaulichen. Konkret werden Fälle von „Niemals-Personen“ und „Nicht-Mehr-Personen“ analysiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Schlüsselbegriffe sind Würde, Achtung, Selbstbestimmung, eingeschränkte Selbstbestimmung, Soziale Arbeit, Berufsethik, utilitaristische Ethik, „Noch-Nicht-Personen“, „Niemals-Personen“, „Nicht-Mehr-Personen“, Menschenrechte, professionelles Handeln, Fallbeispiele, geistige Behinderung und Altersdemenz.
Wie ist die Ausarbeitung strukturiert?
Die Ausarbeitung ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die den Problemaufriss und die zentrale Fragestellung formuliert. Es folgen Begriffsdefinitionen, die Vorstellung von Peter Singers utilitaristischer Ethik, die Präsentation von Fallbeispielen und schließlich die Schlussfolgerungen.
Welche rechtlichen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit beruft sich auf das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), insbesondere §1 und §104 ff., um die rechtliche Perspektive auf die Definition von Personen und deren Geschäftsfähigkeit zu verdeutlichen.
Welche Ziele werden verfolgt?
Das Ziel der Ausarbeitung ist es, ethische Konflikte im Umgang mit Klienten mit eingeschränkter Selbstbestimmung zu untersuchen und Wege zur Gewährleistung von Würde und Achtung aufzuzeigen. Es geht darum, die ethischen Herausforderungen im professionellen Handeln zu beleuchten.
Wo finde ich Zusammenfassungen der Kapitel?
Die Ausarbeitung enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die die Kernaussagen und Ergebnisse jedes Abschnitts kurz und prägnant darstellen.
- Citation du texte
- Veronika Wehner (Auteur), Veronika Wehner (Auteur), Cindy Gundermann (Auteur), 2007, Die Würde und Achtung gegenüber KlientInnen mit eingeschränkter Selbstbestimmung im Kontext Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90352