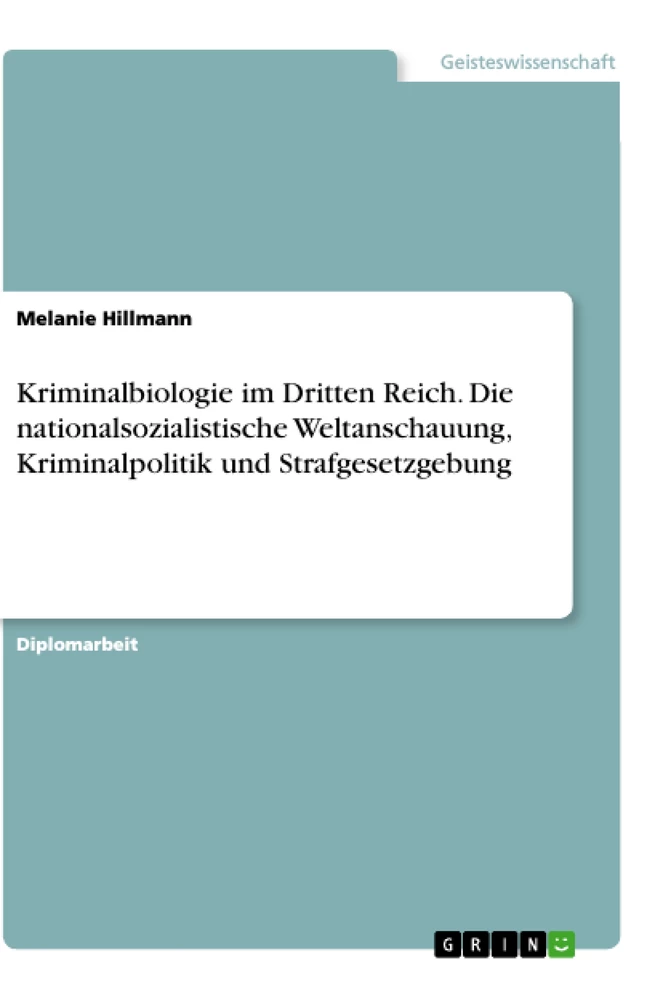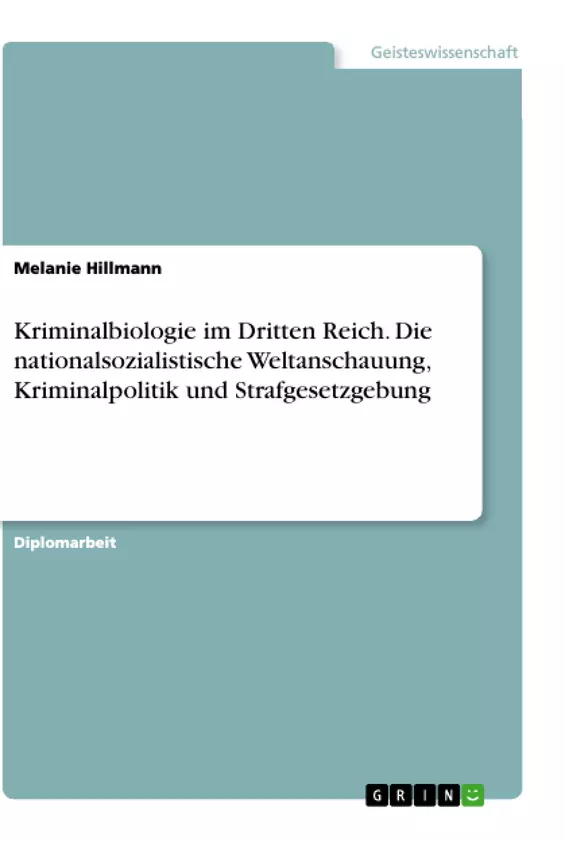Die Arbeit beschäftigt sich mit Kriminalpolitik und der Analyse der Position der Wissenschaft – insbesondere der Kriminologie - im Dritten Reich. Gerade die Auseinandersetzung mit einer Phase der totalitären Herrschaft und politischen Ideologie liefert tiefere Einsichten über die Auswirkungen und auch über die Risiken wissenschaftlicher Forschung. Die zentrale Frage hierbei soll lauten, welche Rolle die kriminologische Forschung bei der Durchsetzung nationalsozialistischer Kriminalpolitik im NS-Staat gespielt hat. D.h., kann man von einer missbrauchten und instrumentalisierten Wissenschaft reden, oder haben nicht vielmehr die Akteure ihre Chance gesehen und wahrgenommen, mit Hilfe ihrer wissenschaftlichen Aktivitäten Einfluss auf kriminalpolitische Entscheidungen zu nehmen?
Im ersten Kapitel wird zu fragen sein, aus welcher politischen Anfangssituation heraus und auf welche Weise die Nationalsozialisten bestehendes Recht für ihre Ziele genutzt und bewusst umgedeutet haben. Unter dem Mantel der Wissenschaftlichkeit wurde eine vollständige Umwertung der Rechtsordnung als "völkische Rechtserneuerung" betrieben. Dies führte zu einer regelrechten Literaturschwemme aus der damaligen Wissenschaft zu diesem Thema.
Im zweiten Kapitel wird es dann zunächst um die nähere Betrachtung der Wissenschaft gehen. Dabei werde ich zu Beginn kurz auf die Entwicklung der Kriminalbiologie eingehen. Weder in begrifflicher noch in programmatischer Hinsicht ist die Kriminalbiologie eine Erfindung des Nationalsozialismus. Ihr Ursprung findet sich vielmehr im Aufschwung der Naturwissenschaften im späten 19. Jahrhundert. Als Reaktion auf vermeintliche und tatsächliche Krisenerscheinungen der Industriellen Revolution entstand der Versuch, menschliches – und somit auch delinquentes – Verhalten mit wissenschaftlichen Methoden zu erfassen und zu prognostizieren.
In der abschließenden Analyse soll schließlich die schon eingangs formulierte Frage nach der Beziehung zwischen Wissenschaft und Politik untersucht werden. Teilweise werden sich Hinweise auf diese Beziehung auch schon in der Darstellung ergeben. Im Interesse der heutigen, zunehmend verantwortungsbewussten kriminologischen Forschung ist die Auseinandersetzung mit diesem Thema geboten, da sie spezifische Hinweise über Folgen und auch über Risiken wissenschaftlicher Forschung liefern kann.
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die völkische Rechtserneuerung und die Leitgedanken der nationalsozialistischen Weltanschauung.
- 1.1 Die Ausgangslage 1933
- 1.2 Die völkische Rechtserneuerung.
- 1.2.1 Instrumente zur Umgestaltung der Rechtsordnung.
- 1.2.2 Die Rechtsidee
- 1.2.3 Die neue Rechtsquellenlehre
- 1.2.4 Die neue Auslegung
- 1.3 Führerprinzip, Volksgemeinschaft und Parteiprogramm als Grundlage der NS-Weltanschauung.
- 1.3.1 Das Führerprinzip
- 1.3.2 Die Volksgemeinschaft
- 1.3.3 Das Prinzip der Einheitspartei
- 1.4 Schlussfolgerung
- 2. Die Wissenschaft
- 2.1 Die Kriminalbiologie
- 2.1.1 Zur Entwicklung und Begriffsbestimmung der Kriminalbiologie bis 1933
- 2.1.2 Die Etablierung der Kriminalbiologie als eigenständige Wissenschaft
- 2.2 Die Gründung der Kriminalbiologischen Gesellschaft
- 2.2.1 Die Institutionalisierung der Kriminalbiologie
- 2.2.2 Das Konzept des Stufenstrafvollzuges – das Beispiel Bayern
- 2.2.3 Die erbbiologische Kartei als Instrument der Bevölkerungskontrolle – das Beispiel Sachsen
- 2.2.4 Die Behandlung von Schwerverbrechern im Strafvollzug – das Beispiel Preußen
- 2.2.5 Vom therapeutischen Konzept zur Volkserneuerung – das Beispiel Hamburg
- 2.2.6 Die Schaffung eines reichseinheitlichen Kriminalbiologischen Dienstes
- 2.3 Schlussfolgerung
- 2.4 Schwerpunkte der kriminalbiologischen Forschung – ein Überblick
- 2.4.1 Die Vererbungs- und Sippenforschung.
- 2.4.2 Die Zwillingsforschung.
- 2.5 Zum Verhältnis von Kriminalbiologie und Strafrecht – Die Tätertypen-Lehre
- 2.6 Die Konsequenzen
- 3. Die Politik
- 3.1 Die Kriminalpolitik
- 3.2 Die Entwicklung des Strafrechts im Dritten Reich
- 3.2.1 Der Schulenstreit zum Ende des 19. Jahrhunderts.
- 3.2.2 Die Reformbewegungen in der Weimarer Republik
- 3.2.3 Die Leitgedanken des nationalsozialistischen Strafrechts
- 3.2.4 Die Entwürfe für ein nationalsozialistisches Strafrecht
- 3.2.5 Gründe für das Scheitern der Reformversuche
- 3.3 Die nationalsozialistische Strafgesetzgebung – ein Überblick
- 3.3.1 Vorgeschichte und Inhalt des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“
- 3.3.2 Das Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung.
- 4. Zusammenfassende Betrachtung
- 4.1 Zum Verhältnis von Kriminalbiologie und Kriminalpolitik im Dritten Reich
- 4.1.1 Der Beitrag der Kriminalbiologie zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Strafrechtspolitik.
- 4.2 Allgemeine Lehren aus der Vergangenheit
- 4.3 Schlussbemerkung
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Kriminalpolitik im Dritten Reich und untersucht dabei insbesondere den Einfluss der Kriminalbiologie auf die nationalsozialistische Strafrechtspolitik. Die Arbeit analysiert die Entwicklung und Etablierung der Kriminalbiologie als eigenständige Wissenschaft im Kontext der völkischen Rechtserneuerung und die Rolle dieser Disziplin in der Durchsetzung der nationalsozialistischen Strafrechtspolitik.
- Die völkische Rechtserneuerung im Kontext der NS-Weltanschauung
- Die Entwicklung und Etablierung der Kriminalbiologie als eigenständige Wissenschaft im nationalsozialistischen Kontext
- Die Rolle der Kriminalbiologie in der Durchsetzung der nationalsozialistischen Strafrechtspolitik
- Die Konsequenzen der kriminalbiologischen Forschung für die Strafgesetzgebung und den Strafvollzug im Dritten Reich
- Die kritische Analyse der Rolle der Wissenschaft in der Verfolgung und Diskriminierung von Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit darlegt. Anschließend wird die völkische Rechtserneuerung im Kontext der nationalsozialistischen Weltanschauung beleuchtet, wobei die Ausgangslage im Jahr 1933, die Instrumente der Rechtsumgestaltung und die Leitgedanken der NS-Weltanschauung, insbesondere das Führerprinzip, die Volksgemeinschaft und die Einheitspartei, behandelt werden.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Kriminalbiologie als eigenständige Wissenschaft. Hier wird ihre Entwicklung bis 1933, ihre Etablierung im nationalsozialistischen Kontext und ihre Institutionalisierung durch die Gründung der Kriminalbiologischen Gesellschaft beleuchtet. Es werden zudem konkrete Beispiele für die Anwendung der Kriminalbiologie im Strafvollzug und in der Bevölkerungskontrolle in Bayern, Sachsen, Preußen und Hamburg dargestellt.
Das dritte Kapitel analysiert die Kriminalpolitik des Dritten Reiches und die Entwicklung des Strafrechts. Hier werden der Schulenstreit im späten 19. Jahrhundert, die Reformbewegungen in der Weimarer Republik und die Leitgedanken des nationalsozialistischen Strafrechts behandelt. Zudem werden die Entwürfe für ein nationalsozialistisches Strafrecht und die Gründe für das Scheitern dieser Reformversuche untersucht. Die Arbeit betrachtet auch die nationalsozialistische Strafgesetzgebung, insbesondere das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" und das "Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung".
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe Kriminalpolitik, Kriminalbiologie, Strafrecht, nationalsozialistische Weltanschauung, völkische Rechtserneuerung, Führerprinzip, Volksgemeinschaft, Einheitspartei, Bevölkerungskontrolle, Strafvollzug, erbbiologische Kartei, Tätertypen-Lehre, erbkranker Nachwuchs, Gewohnheitsverbrecher und „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“. Diese Begriffe spiegeln die zentralen Themen und Fragestellungen der Arbeit wider, die sich mit dem Einfluss der Kriminalbiologie auf die Kriminalpolitik im Dritten Reich auseinandersetzt.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Rolle der Kriminalbiologie im Nationalsozialismus?
Die Kriminalbiologie lieferte unter dem Deckmantel der Wissenschaft die Rechtfertigung für die rassenpolitische Verfolgung und Ausgrenzung von „Gemeinschaftsfremden“.
Ist die Kriminalbiologie eine Erfindung der Nationalsozialisten?
Nein, ihre Ursprünge liegen im späten 19. Jahrhundert im Versuch, delinquentes Verhalten naturwissenschaftlich zu erfassen und zu prognostizieren.
Was versteht man unter der „völkischen Rechtserneuerung“?
Es war die Umgestaltung der Rechtsordnung nach NS-Idealen, weg von objektivem Recht hin zu Führerprinzip und Volksgemeinschaft als Rechtsquellen.
Welche Konsequenzen hatte die Sippenforschung für Strafgefangene?
Durch erbbiologische Karteien wurden nicht nur Täter, sondern ganze Familien erfasst, was oft zu Zwangssterilisationen oder lebenslanger Sicherungsverwahrung führte.
Was besagte das „Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher“?
Dieses Gesetz von 1933 ermöglichte die zeitlich unbefristete Unterbringung von Tätern in der Sicherungsverwahrung basierend auf kriminalbiologischen Prognosen.
- Quote paper
- Melanie Hillmann (Author), 2002, Kriminalbiologie im Dritten Reich. Die nationalsozialistische Weltanschauung, Kriminalpolitik und Strafgesetzgebung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/903889