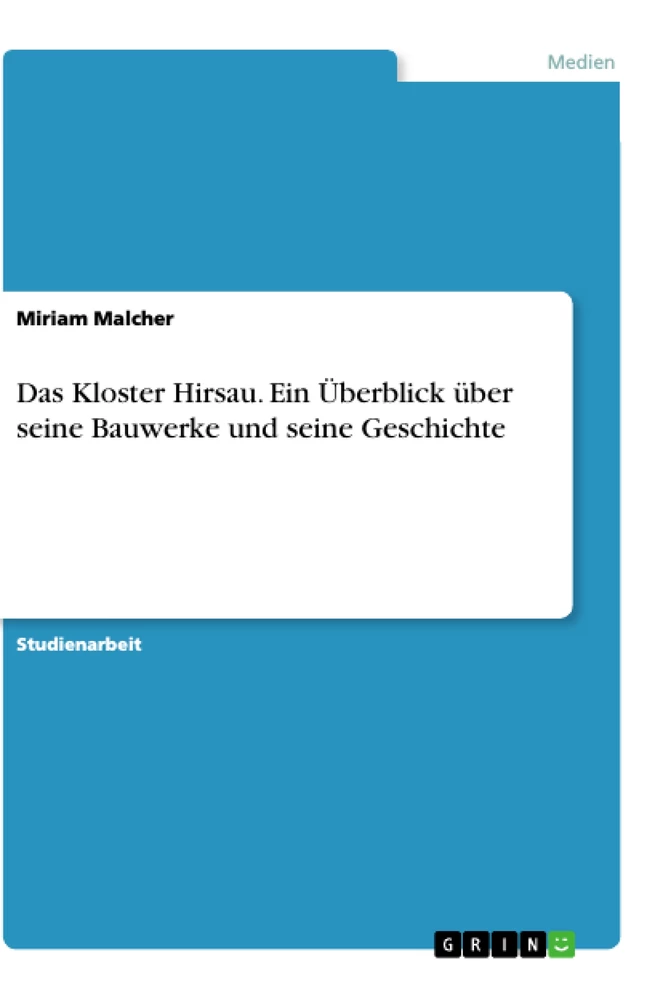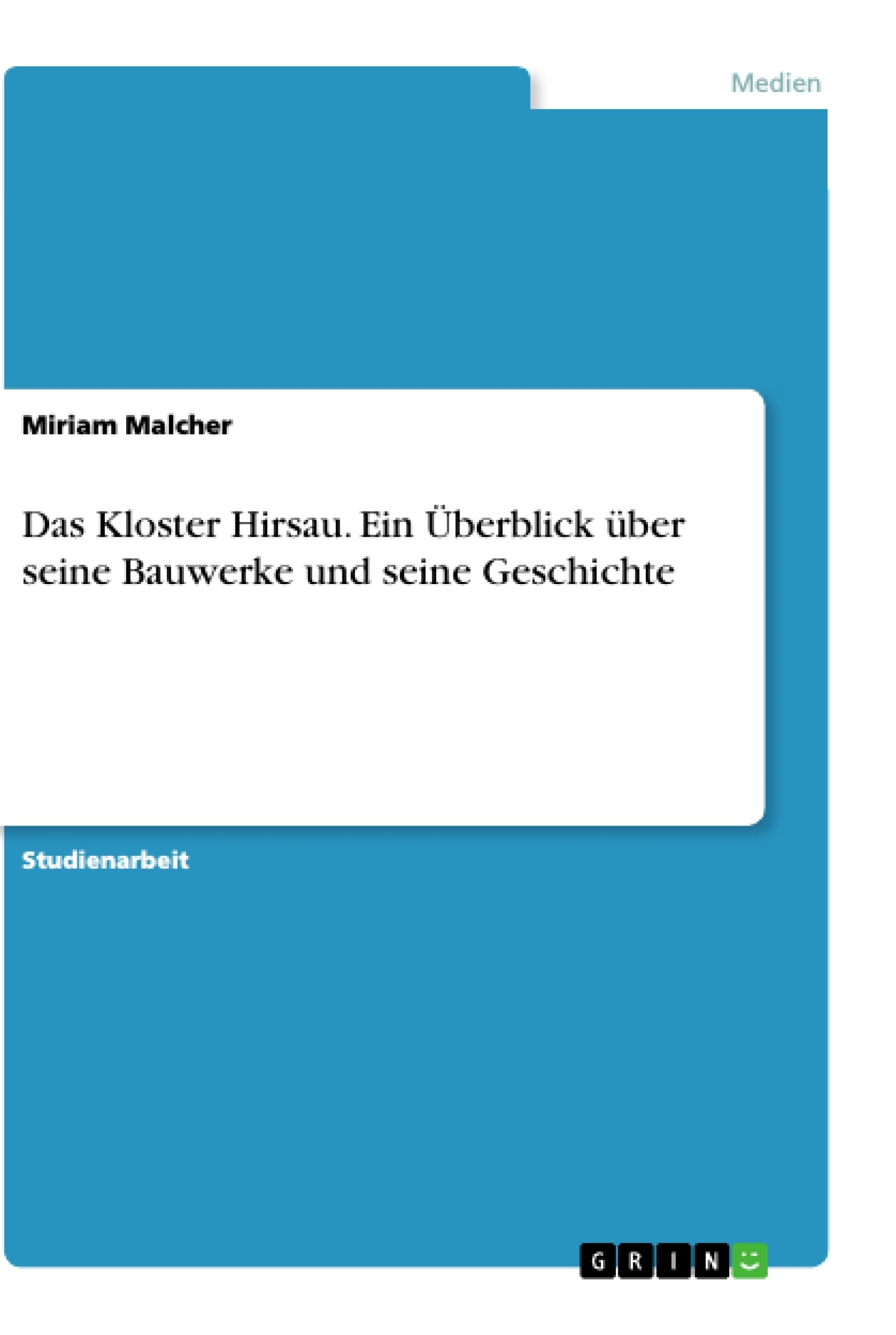Diese Arbeit gibt eine Übersicht über die Geschichte des Benediktinerklosters Hirsau, von der die bedeutende Hirsauer Reform ausging, unter besonderer Berücksichtigung der Bauwerke. Neben dem Kloster Maulbronn stellte Hirsau eines der bedeutendsten Klöster im Mittelalter dar.
Die Entstehungslegende von Sankt Aurelius berichtet, dass in Hirsau einst ein Kirchlein, welches dem heiligen Nazarius geweiht war, gestanden haben soll. Das Errichtungsdatum wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen 765 und 768 angesetzt – was allgemein anerkannt ist. Nazarius wurde als Märtyrer in Lorsch an der Bergstraße verehrt, weshalb frühe Beziehungen dorthin vermutet werden.
Die Reliquien ruhen seit 765 an der Bergstraße, bei 768 handelt es sich um das Todesjahr von König Pippin dem Kurzen, zu dessen Regierungszeit soll die Stiftung durchgeführt worden sein. Die Legende berichtet, dass "eine edle und reiche Wittib, gräflichen Geschlechts von Calw, mit Namen Helizena, die um das Jahr anno 645 ein Kapell zu S. Nazarius genannt…zum Gottesdienst, unten an dem Ottenbronner Berg, ehe das alt Kloster (= erstes Aureliuskloster) aufgangen, gebauet habe." Man geht heute davon aus, dass die Legende die Jahreszahl falsch überliefert hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtlicher Überblick über die Sakralbauten Hirsaus
- vom Nazariuskirchlein zum Aureliuskloster
- St. Bartholomäuskirche
- Abt Wilhelm und der Bau von St. Peter und Paul
- vom 11. Jahrhundert bis heute
- Blütezeit Hirsaus unter Abt Wilhelm
- Abt Wilhelm - Vita
- Investiturstreit unter Heinrich IV.
- Die Hirsauer Reform
- Moderne Hirsauer Reform?
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Geschichte der Abtei Hirsau und ihren sakralen Bauwerken. Sie analysiert die Entwicklung der Abtei vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart und beleuchtet die Bedeutung der Hirsauer Reform für das Klosterleben und die Kirchenlandschaft Europas.
- Die Entstehung und Entwicklung der Abtei Hirsau
- Die Bedeutung der Hirsauer Reform
- Die Architektur der Sakralbauten in Hirsau
- Die Rolle der Abtei Hirsau im Investiturstreit
- Die Bedeutung von Hirsau in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und schildert die persönliche Motivation des Autors, sich mit Hirsau auseinanderzusetzen. Sie beleuchtet die Besonderheiten der Forschungslandschaft rund um Hirsau und die Schwierigkeiten, umfassende Informationen zu erhalten.
Das Kapitel „Geschichtlicher Überblick über die Sakralbauten Hirsaus“ widmet sich der Entwicklung der sakralen Gebäude in Hirsau vom Nazariuskirchlein bis zur Aureliuskirche. Es beleuchtet die Legende der Gründung des Klosters, die verschiedenen Bauphasen und die stilistische Einordnung der Architektur.
Das Kapitel „Blütezeit Hirsaus unter Abt Wilhelm“ fokussiert auf die Zeit des Abt Wilhelm, der als einer der wichtigsten Figuren der Hirsauer Reform gilt. Es beleuchtet seine Lebensgeschichte, seine Rolle im Investiturstreit und die Bedeutung der Hirsauer Reform für die Kirchenlandschaft Europas.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Hirsau, Abtei, Kloster, Aurelius, Nazarius, Hirsauer Reform, Investiturstreit, sakrale Architektur, Geschichte, Mittelalter, Benedictinerorden, Kirche, Mönche, Baugeschichte, Grabungsergebnisse, Kunstgeschichte, Landesamt für Denkmalschutz, Quellenkritik, Literaturverzeichnis, Codex Hirsaugiensis.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Hirsauer Reform?
Die Hirsauer Reform war eine bedeutende Erneuerungsbewegung des Klosterlebens im Mittelalter, die vom Kloster Hirsau ausging und zahlreiche Klöster in ganz Europa beeinflusste.
Wer war Abt Wilhelm von Hirsau?
Abt Wilhelm (1069–1091) war die prägende Figur Hirsaus. Er führte die Reformen ein, baute die gewaltige Klosteranlage St. Peter und Paul und war ein wichtiger Akteur im Investiturstreit.
Welche Bedeutung hat das Kloster Hirsau architektonisch?
Hirsau war im Mittelalter eines der größten Klöster Deutschlands. Die Architektur der sakralen Bauten war wegweisend für den romanischen Baustil in der Region.
Was ist der „Codex Hirsaugiensis“?
Es ist ein bedeutendes Dokument (Traditionsbuch), das Schenkungen und die Geschichte des Klosters aufzeichnet und eine wichtige Quelle für die Mittelalterforschung darstellt.
Welche Rolle spielte Hirsau im Investiturstreit?
Unter Abt Wilhelm stand Hirsau fest auf der Seite des Papstes gegen Kaiser Heinrich IV. und wurde so zu einem Zentrum des kirchlichen Widerstands gegen die kaiserliche Laieninvestitur.
- Arbeit zitieren
- Miriam Malcher (Autor:in), 2010, Das Kloster Hirsau. Ein Überblick über seine Bauwerke und seine Geschichte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/903901