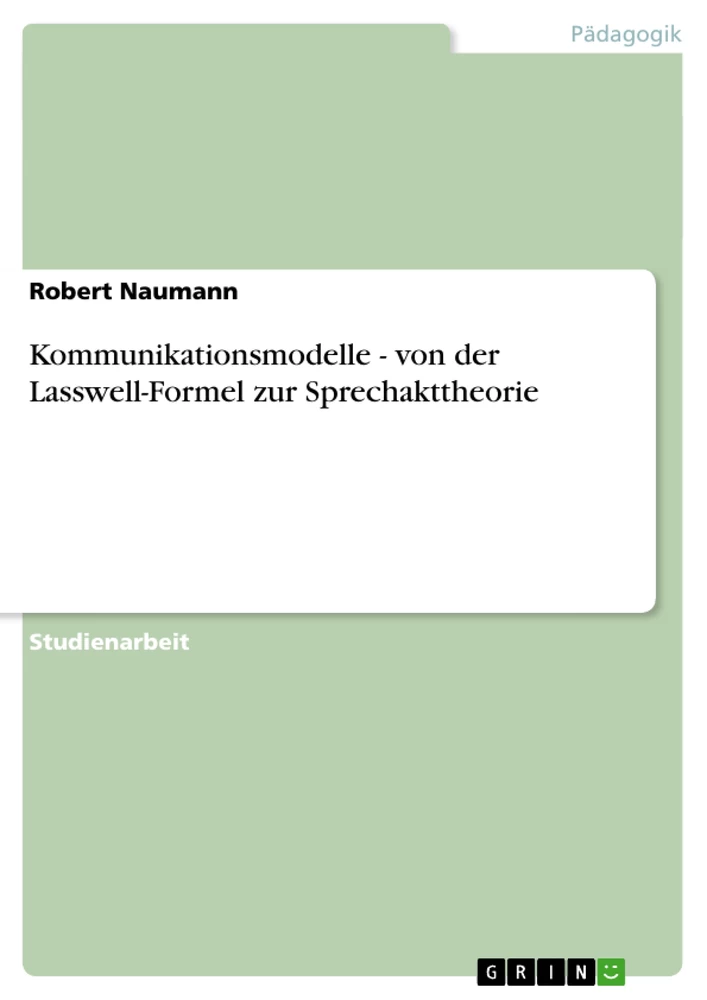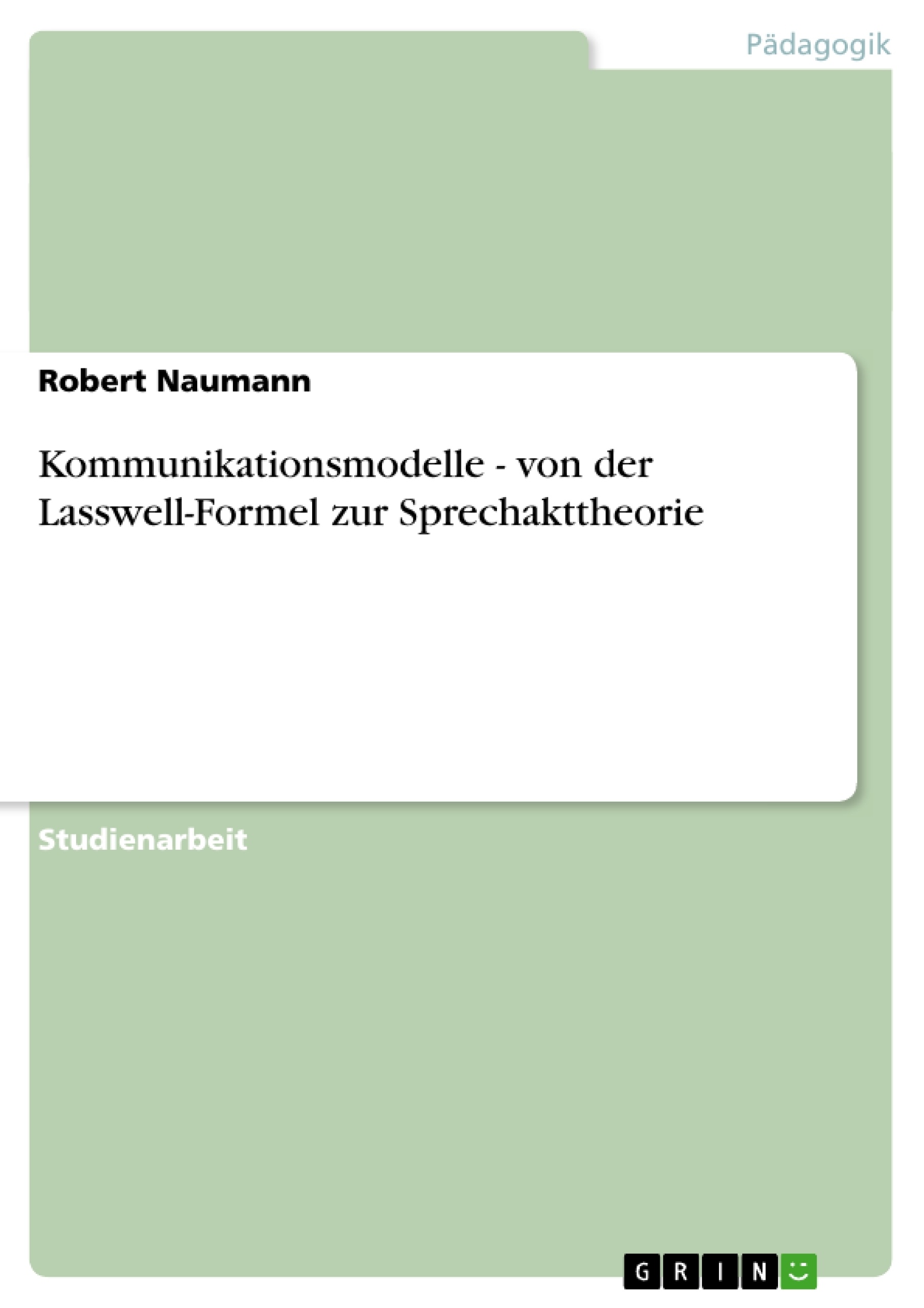Kommunikation umgibt uns in ihrer Vielfältigkeit jeden Tag und wird von uns häufig nicht mehr bewusst wahr genommen. Wissenschaftler aus den verschiedensten Bereichen, von Geistes- und Sozialwissenschaften über die Naturwissenschaften bis hin zur Philosophie, haben versucht „Kommunikation“ zu erklären und zu schematisieren.
Die Geschichte der Kommunikationsmodelle lässt sich bis in die Antike zurück verfolgen. Platon spricht in seinem "Kratylos" von Sprache als ein Organon (Werkzeug), mit Hilfe dessen eine Person der anderen etwas über die Dinge mitteilt. Die heute üblichen Kommunikationsmodelle und damit etablierten Begriffsbestimmungen finden sich aber erst Ende der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Die vorliegende Arbeit soll einen Einblick in den Aufbau und die Entwicklung einiger, ausgewählter Kommunikationsmodelle ermöglichen. Außerdem sollen die Unterschiede und Diskussionsansätze zwischen den einzelnen Modellen aufgezeigt werden, um auf diesem Weg klar zu machen, welche Aspekte der Kommunikation jedes einzelne berücksichtigt und wozu es hilfreich sein kann.
Dazu wird zunächst kurz auf die Begriffe „Kommunikation“ und „Kommunikationsmodell“ eingegangen. Es soll deutlich werden, warum es überhaupt verschiede Modelle gibt und geben muss.
Betrachtete Modelle:
-Lasswell-Formel
-Organon-Modell
-Mathematische Theorie der Kommunikation
-Sprechakttheorie
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Eine Begriffsbestimmung für Kommunikation und Kommunikationsmodell
- Kommunikationsmodelle
- Die Lasswell-Formel
- Das Organon-Modell
- Mathematische Theorie der Kommunikation
- Die Sprechakttheorie
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet eine umfassende Betrachtung verschiedener Kommunikationsmodelle, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Ziel ist es, den Aufbau und die Entwicklung dieser Modelle aufzuzeigen, ihre Unterschiede und Diskussionsansätze zu beleuchten und so die besonderen Aspekte der Kommunikation hervorzuheben, die in jedem Modell berücksichtigt werden.
- Die Entwicklung und Geschichte von Kommunikationsmodellen
- Die verschiedenen Ansätze und Perspektiven auf Kommunikation
- Die Stärken und Schwächen einzelner Kommunikationsmodelle
- Die Bedeutung von Kommunikationsmodellen für die Analyse und das Verständnis von Kommunikationsprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema „Kommunikation“ ein und betont ihre omnipräsente Präsenz im Alltag. Es wird außerdem auf die Geschichte der Kommunikationsmodelle und ihre Bedeutung für die Wissenschaft eingegangen.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition von „Kommunikation“ und „Kommunikationsmodell“. Es werden verschiedene Perspektiven auf den Kommunikationsbegriff vorgestellt und die Vielfältigkeit der Ansätze beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich der Darstellung und Diskussion ausgewählter Kommunikationsmodelle, darunter die Lasswell-Formel, das Organon-Modell, die Mathematische Theorie der Kommunikation und die Sprechakttheorie. Der Fokus liegt auf der Vorstellung der jeweiligen Modellstruktur, ihren Vor- und Nachteilen sowie den zentralen Diskussionspunkten.
Kapitel 4 bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln und stellt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in der Kommunikationsforschung dar.
Schlüsselwörter
Kommunikation, Kommunikationsmodell, Lasswell-Formel, Organon-Modell, Mathematische Theorie der Kommunikation, Sprechakttheorie, Massenkommunikation, Medientheorie, Kommunikationswissenschaft.
- Citation du texte
- Robert Naumann (Auteur), 2008, Kommunikationsmodelle - von der Lasswell-Formel zur Sprechakttheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90391