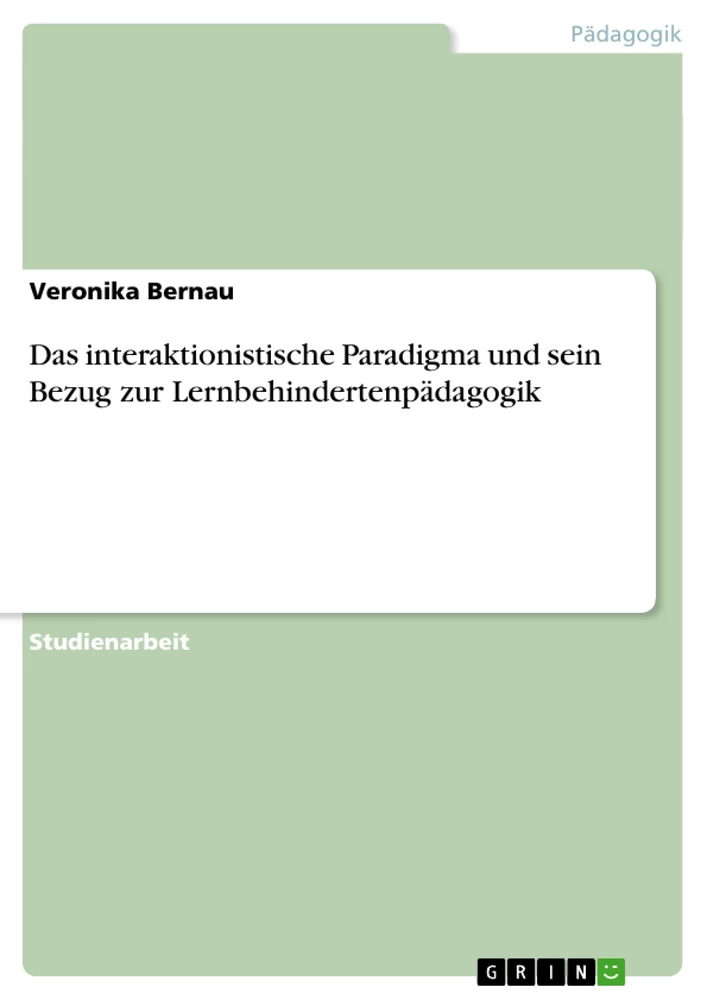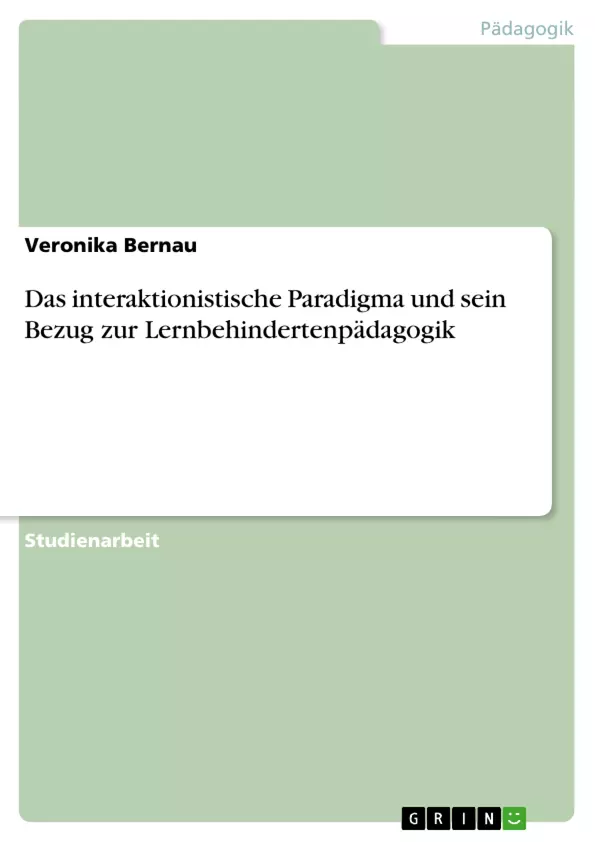Der Interaktionismus versteht „Lernbehinderung“ nicht als eine individuelle Störung des Menschen. Der Begriff „Lernbehinderung“ wird nach interaktionistischem Denken eher als Ergebnis eines Prozesses gesehen, der von einer gesellschaftlichen Norm differiert. Bei der Entwicklung von Etikettierungen können sozial-psychologisch erforschte Einseitigkeiten bei der Beobachtung des Anderen bei dem Zuschreibungsprozess mit hineinspielen.
Lernschwierigkeiten und Leistungsversagen können nicht nur als ein individuelles Persönlichkeitsmerkmal begriffen werden; sie sind vor allem Ursache eines charakteristischen Gesellschafts-, Schul- und Interaktionssystems. Es gibt keine „Lernbehinderung“ an sich. Sie ist keine universelle Größe, sondern eine schulorganisatorische, interaktionistische Bestimmungsvariable. Lehren und Lernen hängen über den Prozess der Interaktion voneinander ab. „Lernbehinderung“ kann man somit nicht im/in der Schüler/in selbst suchen, sondern nur in der Lehrer-Schüler-Beziehung. Der/die „lernbehinderte“ Schüler/in hat sein/ihr Gegenüber im „lernbehinderten“ Lehrer. Bezogen auf eine wechselseitige Interaktion ist „Lernbehinderung“ das Resultat eines Wechselspiels inmitten schulischer Organisations-, Kommunikations- und Inhaltsstrukturen einerseits und den möglichen Reaktionen des Lernenden andererseits. Inter-aktionen sind zirkuläre Entwicklungsvorgänge, in der jedes Verhalten sowohl der Beweggrund als auch dessen Auswirkung sein kann.
Auf diese Weise kehrt man von einer einseitig, personalistischen Sicht ab und wendet sich einer mehrdimensionalen Betrachtungsweise zu.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Erziehungswissenschaftlicher Bezug
- 1.1 Etikettierungsansatz
- 1.2 Sozialer Interaktionismus - eine Kurzzusammenfassung
- 1.3 Definition des „labeling approach“
- 2. Geschichtlicher Hintergrund
- 3. Grundbegriffe
- 3.1 Symbol
- 3.2 Interaktion
- 3.3 Kommunikation
- 3.4 Situation
- 3.5 Identität
- 3.6 Rolle
- 3.7 Stigma
- 4. Kernaussagen
- 4.1 Sozialisation bei Mead
- 4.1.1 Kindliches Spiel
- 4.1.2 „Me“, „I“ und „Self“
- 4.2 Sozialisation bei Habermas
- 4.3 Rollenkompetenzen und Interaktion
- 5. Kritik und Chancen des symbolischen Interaktionismus
- 5.1 Kritik am symbolischen Interaktionismus
- 5.2 Chancen des symbolischen Interaktionismus
- 6. Bezug zur Lernbehinderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem interaktionistischen Paradigma und dessen Bezug zur Lernbehindertenpädagogik. Das Ziel ist es, die zentralen Elemente des symbolischen Interaktionismus darzustellen und dessen Relevanz für das Verständnis von Lernbehinderung zu beleuchten.
- Der Etikettierungsansatz und seine Bedeutung für die Erklärung von Lernbehinderung
- Die zentralen Konzepte des symbolischen Interaktionismus wie Symbol, Interaktion, Kommunikation und Identität
- Die Rolle von Sozialisation und Interaktion im Entstehungsprozess von Lernbehinderung
- Kritikpunkte und Chancen des symbolischen Interaktionismus im Hinblick auf die Lernbehindertenpädagogik
- Die Anwendung des interaktionistischen Paradigmas in der pädagogischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem erziehungswissenschaftlichen Bezug des Etikettierungsansatzes, der den Interaktionsprozess in den Mittelpunkt stellt. Dabei wird der soziale Interaktionismus, insbesondere der „labeling approach“, als wichtiger Erklärungsansatz für das Entstehen von Lernbehinderung vorgestellt.
Das zweite Kapitel bietet einen geschichtlichen Überblick über den symbolischen Interaktionismus. Die Arbeit von Herbert Blumer sowie die Einflüsse von Mead, Pierce und Cooley werden beleuchtet.
Das dritte Kapitel erläutert die wichtigsten Grundbegriffe des symbolischen Interaktionismus, wie Symbol, Interaktion, Kommunikation, Situation, Identität, Rolle und Stigma.
Das vierte Kapitel behandelt die Kernaussagen des symbolischen Interaktionismus, insbesondere die Sozialisationstheorien von Mead und Habermas. Hier werden die Konzepte des „Me“, „I“ und „Self“ sowie die Bedeutung von Rollenkompetenzen und Interaktion für die Entwicklung der Persönlichkeit betrachtet.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Kritik und den Chancen des symbolischen Interaktionismus. Die Arbeit diskutiert die Kritikpunkte, die an diesem Ansatz geäußert werden, und zeigt gleichzeitig die potenziellen Vorteile für die Lernbehindertenpädagogik auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem symbolischen Interaktionismus, dem Etikettierungsansatz, der Lernbehinderung, der Sozialisation, der Interaktion, der Kommunikation, der Identität und der Stigmatisierung.
- Quote paper
- Veronika Bernau (Author), 2007, Das interaktionistische Paradigma und sein Bezug zur Lernbehindertenpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90399