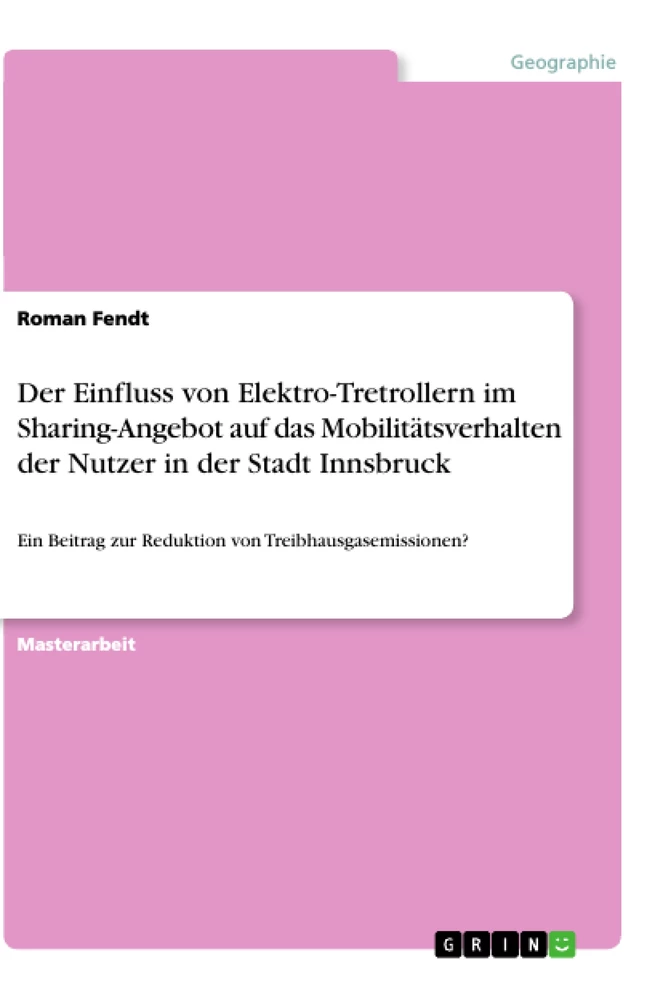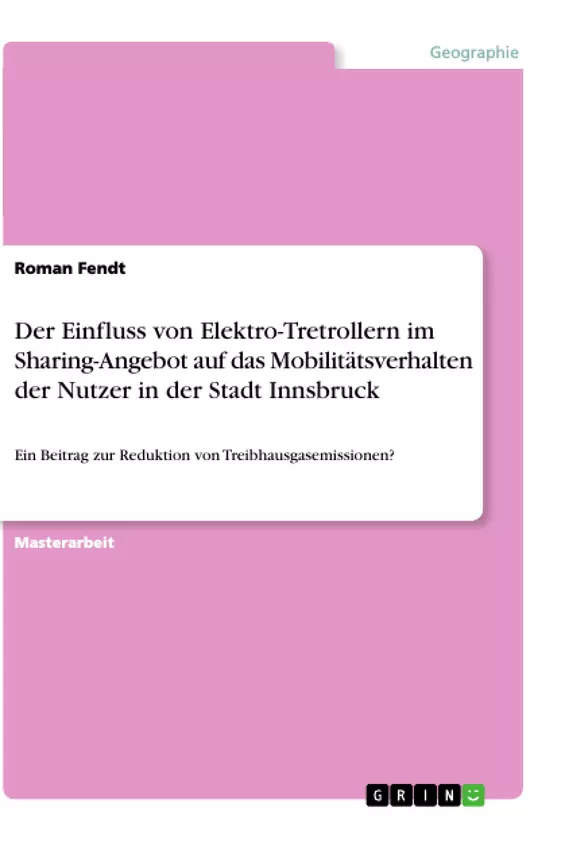Um den Sinngehalt der E-Scooter im Sharing-Angebot zu erfassen, ist eine Untersuchung des Mobilitätsverhaltens der Nutzer erforderlich. Es soll untersucht werden, wie sich der Zugang zu E-Scootern auf die Verkehrsmittelwahl auswirkt und wie diese genutzt werden. Aufschlussreich ist auch die Frage, inwieweit die Nutzung von E-Scootern einen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen leistet. Zur Generierung dieser Daten werden quantitative Methoden in Form eines Fragebogens angewandt sowie qualitative Methoden in Form von teilstrukturierten Leitfadeninterviews mit Nutzern durchgeführt.
Das Erreichen der Klimaziele, zu welchen sich die Vereinten Nationen, die Europäische Union und Österreich verpflichtet haben, ist eine der wichtigsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Sie ist essenziell um eine hohe Lebensqualität sowie eine lebenswerte Zukunft für künftige Generationen zu schaffen. Als einer der größten Emittenten von Treibhausgasen weltweit ist dem Verkehrssektor besondere Aufmerksamkeit zuzuteilen. In diesem Zusammenhang wird die Elektrifizierung des Transportwesens als mögliches Werkzeug zur Reduktion der Emissionen angesehen. Ein neues Phänomen in dieser Entwicklung ist der Elektro-Tretroller oder E-Scooter. Es ist anzunehmen, dass diese junge Form der Mikromobilität in Verbindung mit dem Trend zu Sharing-Angeboten vor allem in Ballungsgebieten einen wichtigen Beitrag zur notwendigen Verkehrswende leisten kann. Vorliegende Studie untersucht den Einsatz von E-Scootern in Innsbruck und deren Auswirkungen auf die Verkehrsmittelwahl ihrer Nutzer. Die Studie versucht insbesondere die Voraussetzungen einer möglichen Reduktion von Treibhausgasen infolge des Einsatzes von E-Scootern zu ermitteln. Durch einen mixed-methods Ansatz wurde mithilfe von 185 Fragebögen und teilstrukturierten Interviews mit zehn E-Scooter-Nutzern Daten über deren Mobilitätsverhalten gesammelt.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hintergrund und Relevanz
- 3. Verkehr in Österreich
- 4. Stadtverkehr in Österreich
- 5. E-Scooter in Österreich
- 5.1 Definition und Komponenten eines E-Scooters
- 5.2 Rechtliche Grundlage in Österreich
- 5.3 Das Sharing-System
- 5.4 Vorteile der E-Scooter
- 5.5 Kritik an E-Scootern
- 5.6 E-Scooter in Innsbruck
- 6. Fragestellung
- 7. Spezielle Methodik
- 7.1 Die quantitative Untersuchung
- 7.1.1 Gütekriterien der quantitativen Forschung
- 7.1.2 Beschreibung der Stichprobe
- 7.2 Das qualitative teilstrukturierte Interview
- 7.2.1 Gütekriterien qualitativer Forschung
- 7.2.2 Entwicklung des Interviewleitfadens
- 7.2.3 Beschreibung der Stichprobe
- 7.2.3 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
- 7.2.4 Ethische Aspekte der Untersuchung
- 7.1 Die quantitative Untersuchung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Einfluss von Elektro-Tretrollern im Sharing-Angebot auf das Mobilitätsverhalten der Nutzer in der Stadt Innsbruck. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob E-Scooter einen Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasemissionen leisten können.
- E-Scooter als neue Form der Mikromobilität im urbanen Raum
- Analyse des Einflusses von E-Scootern auf das Verkehrsverhalten der Nutzer
- Bewertung des Potenzials von E-Scootern zur Reduktion von Treibhausgasemissionen
- Untersuchung der Nutzung von E-Scootern im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln
- Auswirkungen der E-Scooter-Nutzung auf die Verkehrssicherheit und -infrastruktur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Masterarbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas im Kontext der Verkehrswende und des Klimaschutzes erläutert. Im Anschluss werden die Entwicklungen im Verkehrssektor in Österreich sowie die spezifischen Herausforderungen im städtischen Verkehr beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf dem Einsatz von E-Scootern und deren Bedeutung für die Verkehrswende.
Die Arbeit analysiert die verschiedenen Komponenten von E-Scootern und beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich. Die Funktionsweise des Sharing-Systems wird erklärt und die Vorteile sowie Kritikpunkte des Einsatzes von E-Scootern werden dargelegt. Das Kapitel beinhaltet auch eine spezifische Analyse der Situation in Innsbruck.
Die Methodik der Arbeit wird im Anschluss vorgestellt. Dabei werden sowohl die quantitative als auch die qualitative Datenerhebung und -auswertung detailliert beschrieben. Die Gütekriterien der jeweiligen Methoden werden erläutert und die Stichprobenselektion wird dargelegt. Der Fokus liegt dabei auf der Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen E-Scooter, Sharing-Angebot, Mobilitätsverhalten, Verkehrswende, Treibhausgasemissionen, Klimaschutz, Verkehrsinfrastruktur, Stadtentwicklung, qualitative und quantitative Forschungsmethoden, Innsbruck.
Häufig gestellte Fragen
Leisten E-Scooter einen Beitrag zum Klimaschutz?
Die Studie untersucht, ob E-Scooter Autofahrten ersetzen oder eher Fußwege und ÖPNV-Nutzer abwerben, was entscheidend für die tatsächliche Reduktion von Treibhausgasen ist.
Wie ist die rechtliche Lage für E-Scooter in Österreich?
E-Scooter sind in Österreich rechtlich meist Fahrrädern gleichgestellt, was bestimmte Regeln für die Nutzung von Radwegen und Gehwegen sowie technische Anforderungen impliziert.
Welche Vorteile bietet das E-Scooter-Sharing in Innsbruck?
Es bietet eine flexible Ergänzung für die „letzte Meile“, fördert die Mikromobilität in Ballungsgebieten und ermöglicht eine unkomplizierte Nutzung ohne eigenen Besitz.
Was sind die Hauptkritikpunkte an E-Scootern?
Kritisiert werden oft die kurze Lebensdauer der Geräte, das ungeordnete Abstellen im öffentlichen Raum sowie Sicherheitsrisiken für Fußgänger.
Welche Forschungsmethoden wurden in der Innsbruck-Studie genutzt?
Es wurde ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt, bestehend aus 185 quantitativen Fragebögen und zehn qualitativen Leitfadeninterviews mit Nutzern.
- Quote paper
- Roman Fendt (Author), 2020, Der Einfluss von Elektro-Tretrollern im Sharing-Angebot auf das Mobilitätsverhalten der Nutzer in der Stadt Innsbruck, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/904059