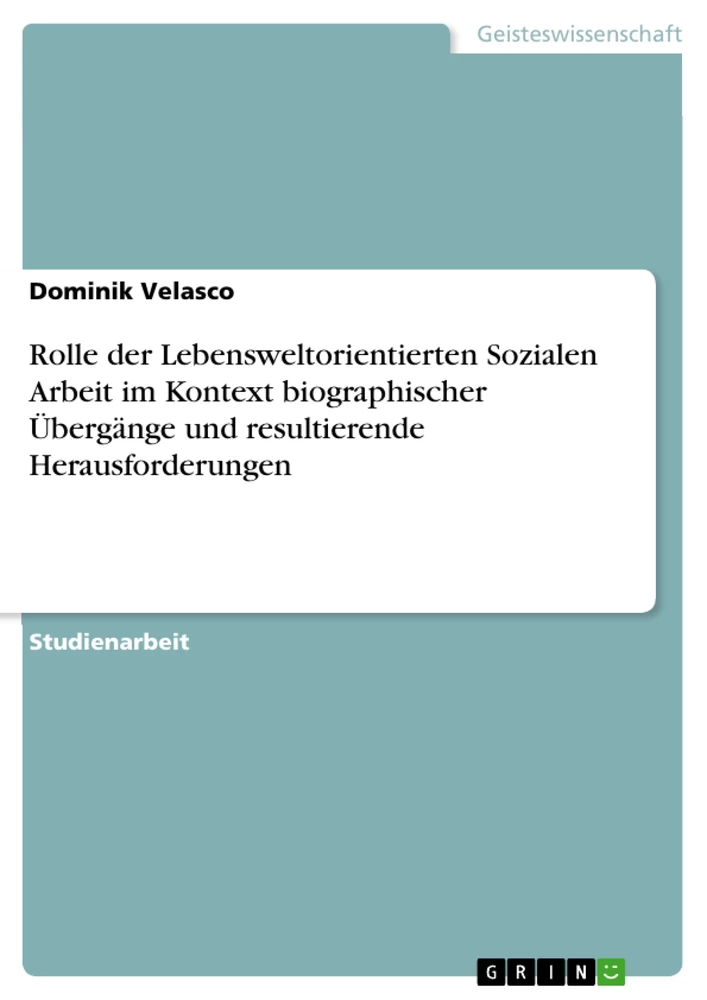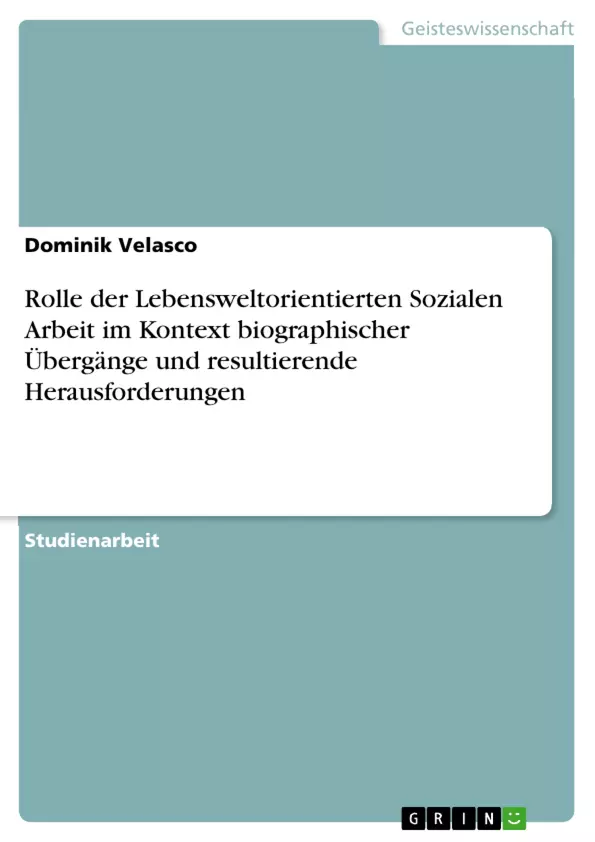Im Zuge dieser Arbeit sollen zunächst der Übergangsbegriff und Übergangsformen beschrieben und in Zusammenhang zur Ambivalenz von Lebenslauf & Biografie gesetzt werden. Darauf aufbauend sollen die Rolle als auch der Aufgabenbereich einer Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit im Hinblick einer Gestaltung biographischer Übergange herausgearbeitet werden, um im Anschluss die resultierenden Herausforderungen für die Lebensweltorientierte Soziale Arbeit auszumachen. Abschließend soll ein (fiktives) Fallbeispiel einen Einblick in ein mögliches, praktisches Szenario bieten.
Im Zuge der postmodernen „Multioptionsgesellschaft“ (Grunwald & Thiersch, 2016) und resultierender Differenzierungs-, Pluralisierungs- also Individualisierungsformen (bzw. -optionen) ergeben sich ausgehend von der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes unter neoliberaler Flagge der ‚freien‘ Marktwirtschaft und einer reflexiven, vermeintlichen Trendwende des standardisierten Lebenslaufs ab der zweiten Hälfte des 20. Jhdt. neue gesellschaftliche Phänomene bzw. Probleme. Die Zustandswechsel respektive Zustandsänderungen zwischen den Lebensaltern bzw. -abschnitten treten vermehrt problematischer als auch unvorhersehbarer – d.h. potentiell riskanter und fragiler - in Erscheinung und münden in einer Ambivalenz aus ehemals bevormundendem Versorgungsstaat und nun aktivierendem Wohlfahrtsstaat, welcher im Zuge der Individualisierung die einst hegemoniale Verantwortung zur sozialen Rationalität auf das Individuum abgewälzt hat (Walther, 2013). Bisherige Betrachtungsweisen von problematischen Zustandswechseln (im Folgenden als Übergänge bezeichnet) bis etwa zur Jahrtausendwende hin, fokussierten hauptsächlich Übergangsthematiken Jugendlicher mit Problemen im Übergang von Schule zu Beruf, wohingegen sich das gegenwärtige Spektrum von Übergängen aufgrund bereits angedeuteter postmoderner Vielfalt von Möglichkeiten und resultierender (postmoderner) Vielfalt von Problemen erheblich erweitert hat (Walther, 2013).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung / Problemstellung
- Übergänge – Versuch einer Begriffsbestimmung
- Übergangsbegriff & Übergangsformen
- Ambivalenz von Lebenslauf und Biographie
- Entstandardisierung
- Individualisierung
- Entstandardisierung und Individualisierung im Bildungssystem
- Lebensweltorientierte Soziale Arbeit im Kontext biographischer Übergänge
- Rolle der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- Aufgabe der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- Herausforderungen
- Praxisbeispiel
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit im Kontext biographischer Übergänge und resultierender Herausforderungen. Sie analysiert die Ambivalenz von Lebenslauf und Biografie im Spannungsfeld zwischen Entstandardisierung und Individualisierung, insbesondere im Bildungssystem. Ziel ist es, die Bedeutung der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit bei der Gestaltung biographischer Übergänge herauszuarbeiten und die damit verbundenen Herausforderungen zu beleuchten.
- Entstandardisierung und Individualisierung von Lebensläufen in der postmodernen Gesellschaft
- Der Einfluss der neoliberalen Marktwirtschaft auf die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes
- Die Rolle der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit bei der Gestaltung biographischer Übergänge
- Herausforderungen für die Lebensweltorientierte Soziale Arbeit im Kontext von Übergängen
- Praxisbeispiele für die Anwendung Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit in biographischen Übergangsprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Problemstellung der Arbeit und führt in die Thematik der biographischen Übergänge im Kontext der postmodernen Gesellschaft ein. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Übergangsbegriff und den verschiedenen Übergangsformen. Es analysiert die Ambivalenz von Lebenslauf und Biografie und beleuchtet die Prozesse der Entstandardisierung und Individualisierung. Das dritte Kapitel untersucht die Rolle der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit im Kontext biographischer Übergänge und analysiert die Aufgaben und Herausforderungen, die sich daraus ergeben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: biographische Übergänge, Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, Entstandardisierung, Individualisierung, Lebenslauf, Biografie, Wohlfahrtsstaat, Bildungssystem, Arbeitsmarkt, neoliberale Marktwirtschaft, Flexibilisierung, postmoderne Gesellschaft, Multioptionsgesellschaft, Planungs- und Orientierungsparadoxon.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter biographischen Übergängen?
Biographische Übergänge sind Zustandswechsel zwischen Lebensphasen, wie der Übergang von der Schule in den Beruf, die in der Postmoderne oft fragiler und unvorhersehbarer werden.
Welche Rolle spielt die lebensweltorientierte Soziale Arbeit dabei?
Sie unterstützt Individuen bei der Gestaltung dieser Übergänge, indem sie deren konkrete Lebensumstände und die Anforderungen der "Multioptionsgesellschaft" berücksichtigt.
Was bedeutet Entstandardisierung von Lebensläufen?
Es beschreibt den Trend weg vom klassischen, linearen Lebenslauf hin zu individuellen, oft gebrochenen oder flexiblen Biographien aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen.
Welche Herausforderungen ergeben sich durch die Individualisierung?
Die Verantwortung für soziale Risiken wird zunehmend vom Staat auf das Individuum abgewälzt, was zu einem erhöhten Planungs- und Orientierungsdruck führt.
Wie wirkt sich der Neoliberalismus auf biographische Übergänge aus?
Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und der Wandel zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat machen Übergänge riskanter und erfordern von den Betroffenen mehr Eigenverantwortung.
- Quote paper
- Dominik Velasco (Author), 2020, Rolle der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit im Kontext biographischer Übergänge und resultierende Herausforderungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/904060