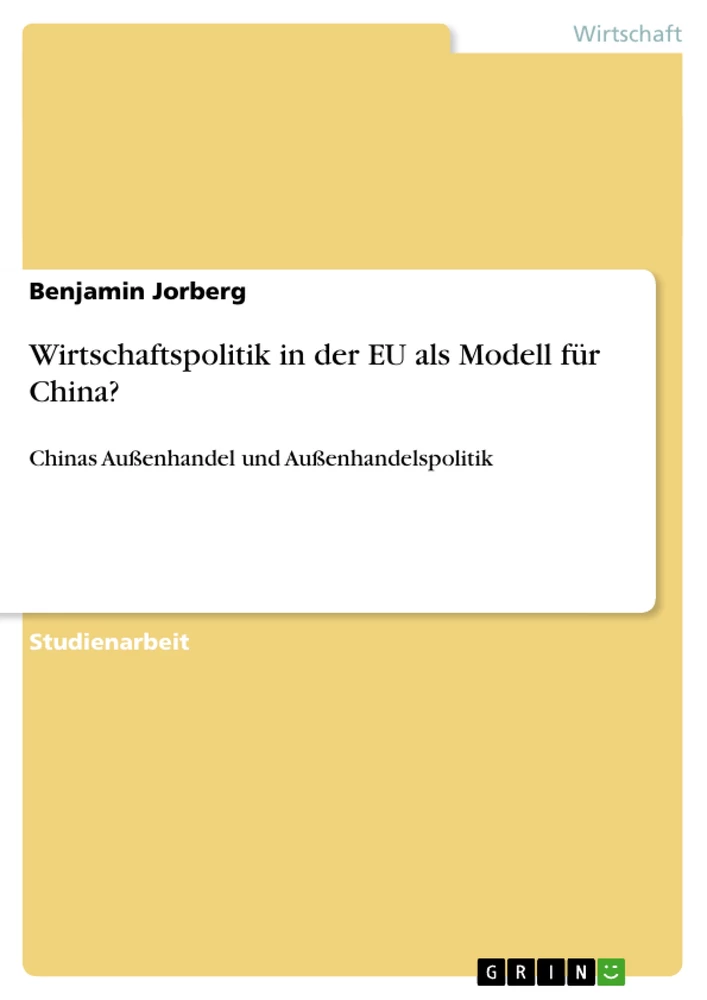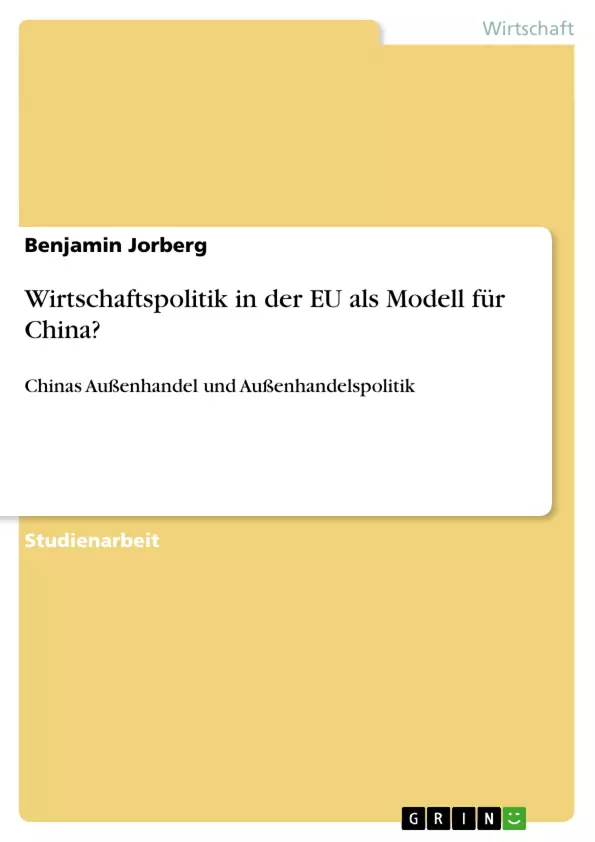Ein Wirtschaftswachstum, wie es in China in den vergangenen 25 Jahren zu beobachten war, ist weltgeschichtlich eine Besonderheit.
Die Volksrepublik China (VRC), die mit 1,3 Milliarden (Mrd.) Menschen das bevölkerungsreichste Land der Welt darstellt, hat bis vor kurzem in der Weltwirtschaft kaum eine Rolle gespielt. Erst nach dem Tod Mao Zhedongs übernahm eine Gruppe pragmatisch orientierter Funktionäre um Deng Xiaoping die Macht und leitete im Jahre 1978 mit der Kampagne „Befreiung des Denkens“ die Abkehr der VRC von der kommunistischen Ideologie hin zu einer pragmatischen Reformpolitik ein. In den letzten drei Reform-Jahrzehnten seit 1978 hat sich die VRC kontinuierlich den internationalen Märkten geöffnet und konnte in diesem Zuge umfangreiche Auslandsinvestitionen sowie Technologien und Managementwissen ins eigene Land holen. Aufgrund der massiven Investitionen in die eigene Infrastruktur und dem nahezu grenzenlosen Angebot an billigen Arbeitskräften hat sich die VRC zu einem der wettbewerbsfähigsten Produktionsstandorte für internationale Unternehmen entwickelt. Die jährliche reale Wachstumsrate der letzten 25 Jahre betrug durchschnittlich nahezu 10%. Die VRC ist mittlerweile nach den USA, Japan und Deutschland die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt in absoluten Größen. Wenn man das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf die Kaufkraftparität bezieht, liegt China sogar an zweiter Stelle hinter den USA. Dieses enorme Wirtschaftswachstum ist nicht nur auf die demographische und geographische Größe des „Reichs der Mitte“ zurückzuführen, sondern auch auf die hohe Dynamik des Außenhandels, die nationale Sparquote (rund 30% des BIP) und die ausländischen Direktinvestitionen (FDI).
Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich mich mit der Darstellung und Analyse des chinesischen Außenhandelssektors befassen und ferner darauf eingehen, welche Branchen zum chinesischen Wirtschaftswunder beigetragen haben und in Zukunft das Wachstum weiter stützen werden. Die vorliegende Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Das folgende Kapitel 2 stellt in aller Kürze die grundlegenden Außenhandelstheorien dar. In Kapitel 3 werden die elementaren Faktoren beschrieben, die den Außenhandel zum Motor des chinesischen Wirtschaftswachstums machten. Darauf aufbauend wird im 4. Kapitel die Branchenstruktur des chinesischen Außenhandels untersucht. Da die Leistungsbilanzüberschüsse Chinas auf den Überschüssen der Handelsbilanz basieren, wird in dieser Arbeit nicht auf den Dienstleistungssektor eingegangen. Der Schwerpunkt in diesem Kapitel liegt auf der Textil- und Bekleidungsindustrie, sowie auf der Informations- und Telekommunikationsindustrie, da sich die Exportdynamik auf diese beiden Branchen stützt. Im 5. Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein kurzer Ausblick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen des internationalen Handels
- Der chinesische Außenhandel
- Chinas Beitritt zur WTO
- Die Bedeutung der Auslandsdirektinvestitionen
- Entwicklung und Charakteristika der FDI Zuflüsse nach China
- Investitionen chinesischer Firmen im Ausland
- Chinas Handelsüberschuss auf Rekordhoch
- Die Entwicklung der Im- und Exporte
- Der Einfluss der Währungspolitik auf den Außenhandel
- Die Branchenstruktur des chinesischen Außenhandels
- Die Analyse ausgewählter Branchen
- Die Textil- und Bekleidungsindustrie
- Die Informations- und Telekommunikationsindustrie
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den chinesischen Außenhandelssektor und beleuchtet die Faktoren, die zum Wirtschaftswachstum Chinas beigetragen haben und dieses in Zukunft weiterhin stützen könnten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Außenhandels, der Rolle der Auslandsdirektinvestitionen und der Bedeutung ausgewählter Branchen für das chinesische Wirtschaftswunder.
- Die Bedeutung des Außenhandels für das Wirtschaftswachstum Chinas
- Die Rolle von Auslandsdirektinvestitionen (FDI) für die Entwicklung Chinas
- Die Branchenstruktur des chinesischen Außenhandels und die Bedeutung ausgewählter Sektoren
- Der Einfluss der Währungspolitik auf den Außenhandel Chinas
- Die Bedeutung von Chinas Beitritt zur WTO für den Außenhandelssektor
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen des internationalen Handels. Kapitel 2 konzentriert sich auf den chinesischen Außenhandel und analysiert die Entwicklung des Außenhandels, die Rolle der Auslandsdirektinvestitionen und den Einfluss der Währungspolitik. Kapitel 3 widmet sich der Branchenstruktur des chinesischen Außenhandels und betrachtet insbesondere die Textil- und Bekleidungsindustrie sowie die Informations- und Telekommunikationsindustrie.
Schlüsselwörter
Chinesischer Außenhandel, Wirtschaftswachstum, Auslandsdirektinvestitionen (FDI), WTO, Branchenstruktur, Textil- und Bekleidungsindustrie, Informations- und Telekommunikationsindustrie, Währungspolitik, Handelsüberschuss, Import, Export.
Häufig gestellte Fragen
Wie erreichte China sein enormes Wirtschaftswachstum?
Das Wachstum basierte auf der Öffnung der Märkte ab 1978, massiven Auslandsdirektinvestitionen (FDI), einer hohen Sparquote und dem Export von Industriegütern.
Welche Rolle spielte der WTO-Beitritt für China?
Der Beitritt im Jahr 2001 war der Motor für die Integration Chinas in den Weltmarkt und führte zu einem massiven Anstieg der Exporte und Handelsüberschüsse.
Welche Branchen stützen das chinesische „Wirtschaftswunder“?
Besonders die Textil- und Bekleidungsindustrie sowie die Informations- und Telekommunikationsindustrie sind zentrale Treiber der chinesischen Exportdynamik.
Wie beeinflusst die Währungspolitik den Außenhandel?
Durch eine gezielte Steuerung des Wechselkurses hält China seine Exporte auf dem Weltmarkt preislich wettbewerbsfähig, was jedoch international oft kritisiert wird.
Warum investieren so viele Firmen in China?
Ausschlaggebend sind das nahezu grenzenlose Angebot an billigen Arbeitskräften, die massiv ausgebaute Infrastruktur und der Zugang zu einem riesigen Binnenmarkt.
- Quote paper
- Benjamin Jorberg (Author), 2008, Wirtschaftspolitik in der EU als Modell für China?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90445