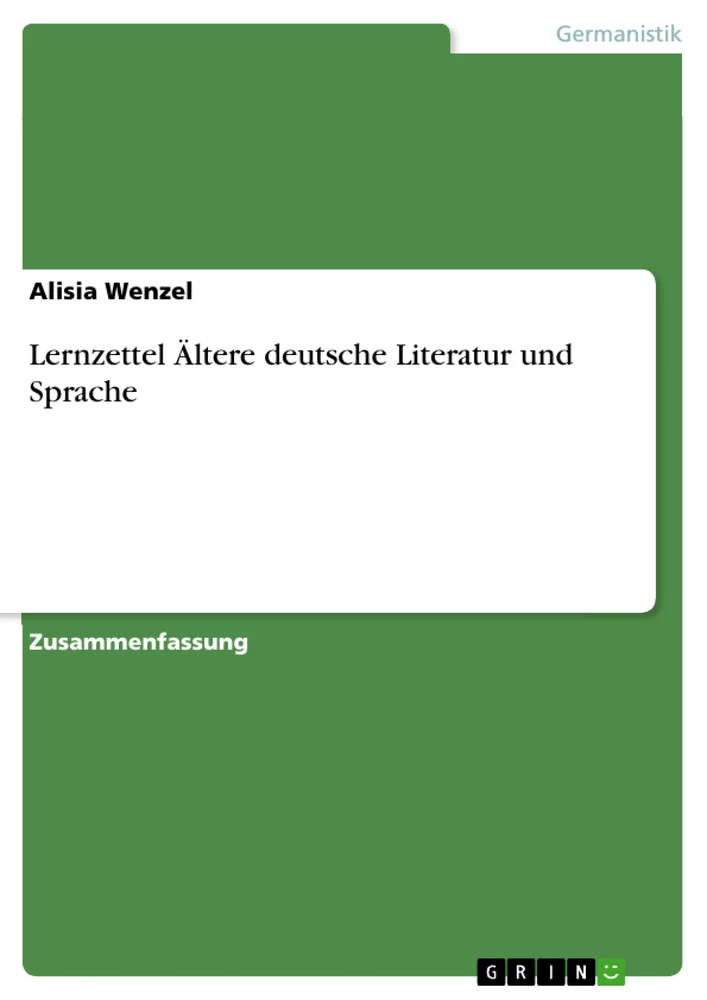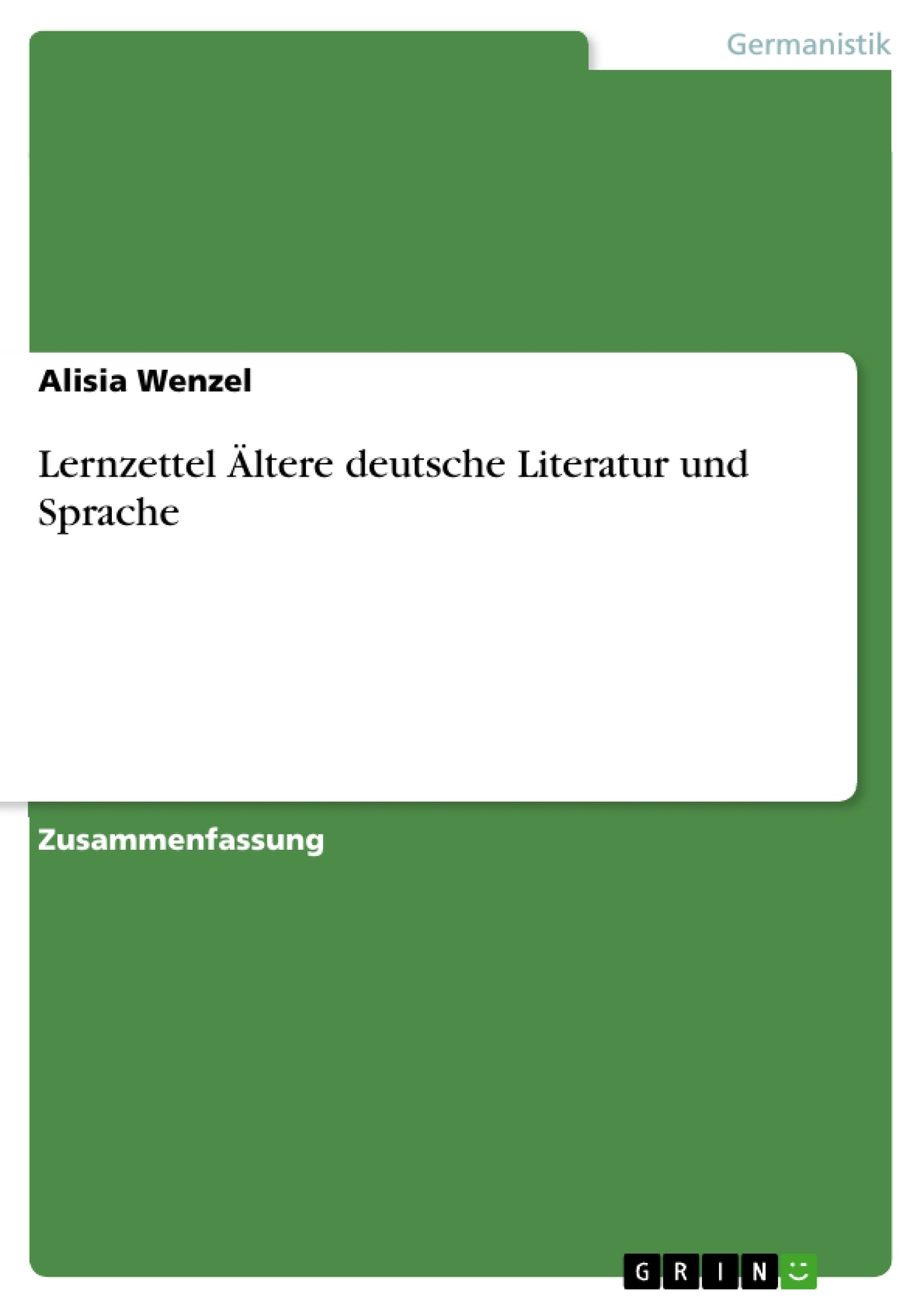Dieser Lernzettel mit dem Titel "Ältere deutsche Literatur und Sprache" enthält u.a. folgende Inhalte in Stichpunkten:
Hartmann von Aue - Erec und alles, was dazu gehört: Ritterlichkeit, Minne, Mittelhochdeutsch usw.
Aus dem Inhalt:
- WANN WAR „DAS“ MITTELALTER?;
- GEGENWÄRTIGE SITUATION DER GERMANISTISCHEN MEDIÄVISTIK;
- DAS MITTELALTERLICHE BILDUNGSWESEN;
- [...]
Inhaltsverzeichnis
- Lernzettel Ältere deutsche Literatur und Sprache
- MITTEL-HOCH-DEUTSCH / MHD.
- MEDIÄVISTIK
- WANN WAR „DAS“ MITTELALTER?
- EINBLICKE IN DIE GESCHICHTE DES FACHS
- GEGENWÄRTIGE SITUATION DER GERMANISTISCHEN MEDIÄVISTIK
- DAS MITTELALTERLICHE BILDUNGSWESEN
- Die Klosterschule
- Die Universitäten
- Die Scholastik
- Zum Verhältnis von Literarizität und Illiterarizität
- LAUTLICHE VERÄNDERUNGEN VOM MHD. ZUM NHD.: VOKALISMUS
- LAUTLICHE VERÄNDERUNGEN VON MHD. ZUM NHD. KONSONANTISMUS
- LAUTLICHE PHÄNOMENE INNERHALB DES MHD.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Lernzettel bietet eine Übersicht über die ältere deutsche Literatur und Sprache, insbesondere Mittelhochdeutsch (MHD). Er beleuchtet die Mediävistik als Fachgebiet, die Entwicklung des mittelalterlichen Bildungswesens und die lautlichen Veränderungen vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen. Die Zusammenhänge zwischen Literarizität und Illiterarizität werden ebenfalls thematisiert.
- Mittelhochdeutsche Sprache und Literatur
- Entwicklung der Mediävistik als Forschungsgebiet
- Das mittelalterliche Bildungssystem (Klosterschulen, Universitäten, Scholastik)
- Lautliche Veränderungen vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen
- Literarizität und Illiterarizität im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Lernzettel Ältere deutsche Literatur und Sprache: Dieser Abschnitt dient als Einleitung und stellt das Thema des gesamten Lernzettels vor: die Erforschung der älteren deutschen Literatur und Sprache, wobei der Fokus auf Mittelhochdeutsch liegt. Er fungiert als Überblick und führt in die nachfolgenden Themenbereiche ein.
MITTEL-HOCH-DEUTSCH / MHD.: Dieser Abschnitt definiert den Begriff Mittelhochdeutsch, sowohl zeitlich (zwischen Althochdeutsch und Frühneuhochdeutsch) als auch geographisch (im Gegensatz zum Niederdeutschen). Er skizziert die wichtigsten sprachlichen Entwicklungen dieser Periode.
MEDIÄVISTIK: Hier wird die Mediävistik als fächerübergreifende Wissenschaft vom europäischen Mittelalter vorgestellt. Die Epochenproblematik und die Schwierigkeit, den Zeitraum des Mittelalters eindeutig zu definieren, wird angesprochen. Die Entstehung und Entwicklung des Fachgebietes werden kurz umrissen.
WANN WAR „DAS“ MITTELALTER?: Dieser Abschnitt behandelt die Herausforderungen der Periodisierung des Mittelalters. Er nennt verschiedene Möglichkeiten, den Beginn und das Ende des Mittelalters zu definieren, sowohl im Allgemeinen als auch speziell im Kontext der germanistischen Mediävistik, unterstreicht aber die willkürliche Natur solcher Festlegungen.
EINBLICKE IN DIE GESCHICHTE DES FACHS: Dieser Abschnitt beleuchtet die Rezeption des Mittelalters in verschiedenen historischen Phasen, von der Frühromantik bis zur Etablierung der Germanistik als akademisches Fach. Die Entwicklung des Verständnisses von Mittelalterlicher Literatur wird nachgezeichnet.
GEGENWÄRTIGE SITUATION DER GERMANISTISCHEN MEDIÄVISTIK: Hier wird der aktuelle Forschungsstand der germanistischen Mediävistik beschrieben, mit einem Fokus auf die Erweiterung des Literaturbegriffs und die Einbeziehung von Texten, die über rein literarische Werke hinausgehen. Die Entwicklung der Fachgebiete innerhalb der Germanistik wird ebenfalls erwähnt.
DAS MITTELALTERLICHE BILDUNGSWESEN: Dieser Abschnitt behandelt die verschiedenen Institutionen des mittelalterlichen Bildungswesens: Klosterschulen, Universitäten und die Scholastik als Lehrmethode. Er beschreibt die Rolle des Lateins als Wissenschaftssprache, die Organisation der Universitäten und die Bedeutung der sieben freien Künste im Lehrplan.
Zum Verhältnis von Literarizität und Illiterarizität: Dieser kurze Abschnitt illustriert den Unterschied zwischen gebildeten und ungebildeten Personen im Mittelalter anhand von Beispielen aus der Literatur, und zeigt wie Bildung im mittelalterlichen Kontext definiert war.
LAUTLICHE VERÄNDERUNGEN VOM MHD. ZUM NHD.: VOKALISMUS: Dieser Abschnitt beschreibt detailliert die Veränderungen im Vokalismus vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen. verschiedene Prozesse wie Diphthongierung, Monophthongierung, Senkung vor Nasal, Rundung und Entrundung werden erklärt und mit Beispielen illustriert.
LAUTLICHE VERÄNDERUNGEN VON MHD. ZUM NHD. KONSONANTISMUS: Ähnlich wie der vorherige Abschnitt konzentriert sich dieser Teil auf die Konsonantenveränderungen vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen. Phänomene wie Sprossvokal, Wandel von s zu sch, Veränderungen beim Hauchlaut h, sowie Auslautverhärtung werden erklärt und mit Beispielen belegt.
LAUTLICHE PHÄNOMENE INNERHALB DES MHD.: Schliesslich werden typische lautliche Phänomene innerhalb des Mittelhochdeutschen selbst erläutert, darunter Umlaut, Ablaut, Auslautverhärtung, Kontraktion, Synkopierung, Primärberührungseffekt und Grammatischer Wechsel, jeweils mit ausführlichen Erklärungen und Beispielen.
Schlüsselwörter
Mittelhochdeutsch, Mediävistik, Mittelalter, Bildungswesen, Klosterschule, Universität, Scholastik, Lautwandel, Vokalismus, Konsonantismus, Literarizität, Illiterarizität, Sprachgeschichte, Germanistik.
Häufig gestellte Fragen zum Lernzettel "Ältere deutsche Literatur und Sprache"
Was ist der Inhalt des Lernzettels "Ältere deutsche Literatur und Sprache"?
Der Lernzettel bietet einen umfassenden Überblick über die ältere deutsche Literatur und Sprache, mit besonderem Fokus auf das Mittelhochdeutsche (MHD). Er behandelt die Mediävistik als Fachgebiet, das mittelalterliche Bildungssystem, lautliche Veränderungen vom MHD zum Neuhochdeutschen (NHD) und das Verhältnis von Literarizität und Illiterarizität im Mittelalter.
Welche Themen werden im Lernzettel behandelt?
Die behandelten Themen umfassen Mittelhochdeutsche Sprache und Literatur, die Entwicklung der Mediävistik, das mittelalterliche Bildungssystem (Klosterschulen, Universitäten, Scholastik), lautliche Veränderungen vom MHD zum NHD (Vokalismus und Konsonantismus), sowie Literarizität und Illiterarizität im Mittelalter.
Welche Kapitel umfasst der Lernzettel?
Der Lernzettel gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung (Ältere deutsche Literatur und Sprache), Mittelhochdeutsch (MHD), Mediävistik, Periodisierung des Mittelalters, Geschichte der Mediävistik als Fachgebiet, aktuelle Situation der Germanistischen Mediävistik, mittelalterliches Bildungswesen, Literarizität und Illiterarizität, lautliche Veränderungen vom MHD zum NHD (Vokalismus und Konsonantismus) und lautliche Phänomene innerhalb des MHD.
Was wird unter "mittelalterliches Bildungswesen" verstanden?
Dieser Abschnitt beschreibt die Institutionen des mittelalterlichen Bildungswesens, darunter Klosterschulen, Universitäten und die Scholastik als Lehrmethode. Er beleuchtet die Rolle des Lateins, die Organisation der Universitäten und die Bedeutung der sieben freien Künste.
Wie werden die lautlichen Veränderungen vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen erklärt?
Der Lernzettel beschreibt detailliert die Veränderungen im Vokalismus und Konsonantismus vom MHD zum NHD. Es werden Prozesse wie Diphthongierung, Monophthongierung, Senkung vor Nasal, Rundung und Entrundung (Vokalismus) sowie Sprossvokal, Wandel von s zu sch, Veränderungen beim Hauchlaut h und Auslautverhärtung (Konsonantismus) erklärt und mit Beispielen illustriert.
Welche lautlichen Phänomene innerhalb des Mittelhochdeutschen werden behandelt?
Der Lernzettel erläutert typische lautliche Phänomene des MHD, wie Umlaut, Ablaut, Auslautverhärtung, Kontraktion, Synkopierung, Primärberührungseffekt und Grammatischer Wechsel, jeweils mit ausführlichen Erklärungen und Beispielen.
Was versteht der Lernzettel unter Literarizität und Illiterarizität im Mittelalter?
Dieser Abschnitt beleuchtet den Unterschied zwischen gebildeten und ungebildeten Personen im Mittelalter anhand von Beispielen und zeigt, wie Bildung im mittelalterlichen Kontext definiert war.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Lernzettel?
Schlüsselwörter sind: Mittelhochdeutsch, Mediävistik, Mittelalter, Bildungswesen, Klosterschule, Universität, Scholastik, Lautwandel, Vokalismus, Konsonantismus, Literarizität, Illiterarizität, Sprachgeschichte, Germanistik.
Für wen ist dieser Lernzettel gedacht?
Der Lernzettel richtet sich an Studierende der Germanistik und alle, die sich umfassend mit der älteren deutschen Literatur und Sprache auseinandersetzen möchten.
Wo finde ich weitere Informationen zum Thema?
Der Lernzettel dient als Einstieg. Für vertiefende Informationen empfiehlt sich die Literatur zum Thema Mittelhochdeutsch, Mediävistik und Germanistische Sprachgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Alisia Wenzel (Autor:in), 2020, Lernzettel Ältere deutsche Literatur und Sprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/904600