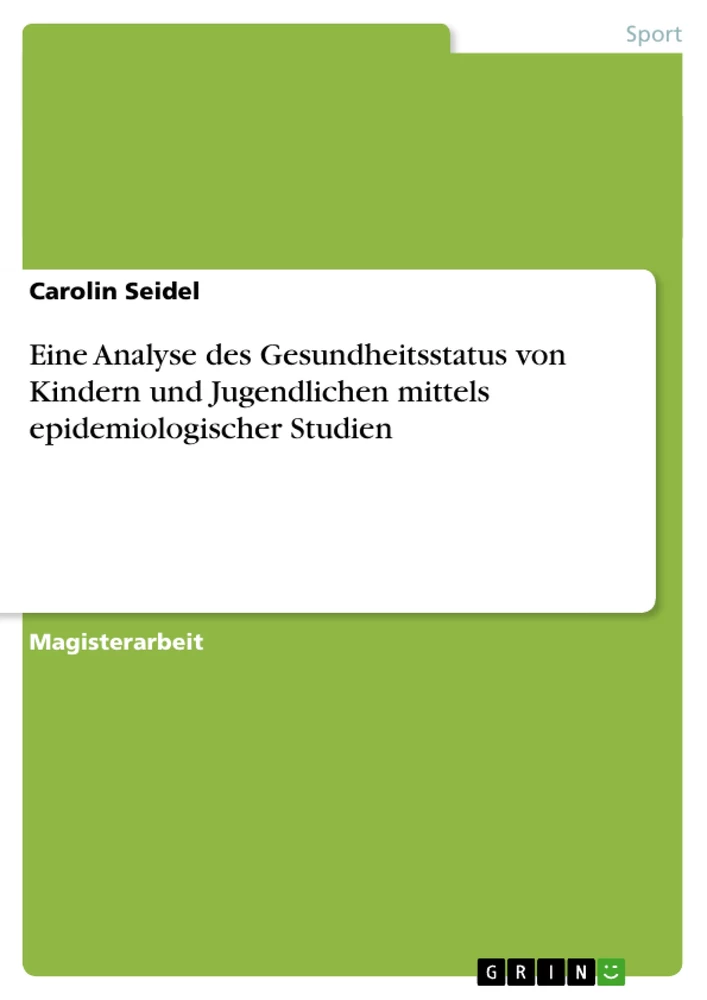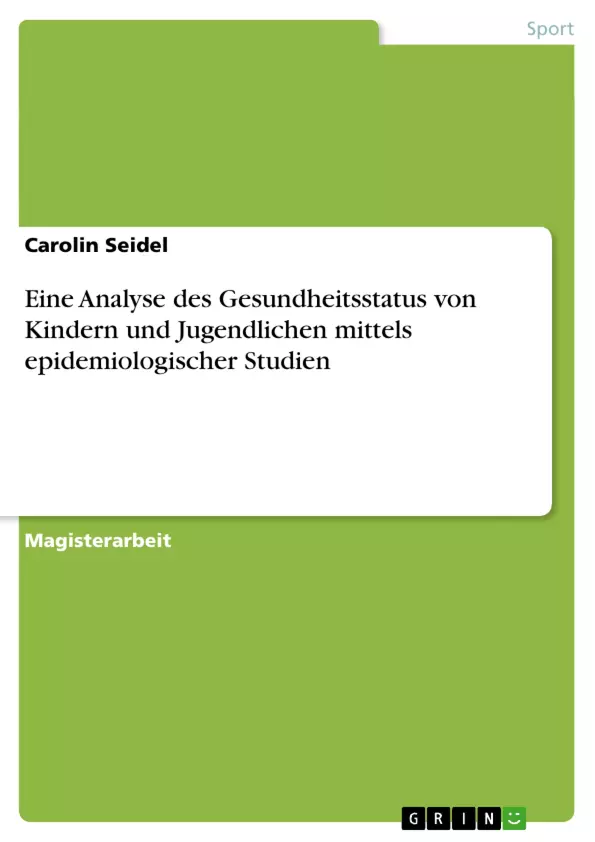In Deutschland sind über 13 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in der
Gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert. Die Summe der Ausgaben
betrug im Jahr 2004 11,3 Milliarden Euro (BKK FAKTENSPIEGEL 2006).
Wie es jedoch um die Gesundheit der Kinder steht, erfährt man aus diesen Angaben
nicht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang herauszufinden, was Gesundheit
überhaupt ist und welche Möglichkeiten der Einzelne hat, seine Gesundheit positiv
zu beeinflussen.
Im ersten Teil dieser Arbeit soll die Frage nach dem Begriff der Gesundheit anhand
verschiedener Modelle geklärt werden.
Um Kindergesundheit zu bestimmen ist es wichtig, die aktuelle Datenlage genau zu
analysieren und weltweite Studien zu diesem Thema zu vergleichen. Grundlegend
dafür ist jedoch das Wissen um die Vorgehensweise bei solchen Studien. Wie man
gesundheitsbezogene Zustände innerhalb einer Gesellschaft untersucht ist Thema
des Abschnitts ‚Epidemiologie’.
In der heutigen Medizin setzt sich die ‚Evidenzbasierte Medizin’ immer weiter durch.
Sie beschäftigt sich mit der Beweisführung in der Medizin. Nach welchen Prinzipien
klinische Entscheidungen getroffen werden und wie evidenzbasierte Medizin in der
Realität angewandt wird, soll in diesem Abschnitt geklärt werden.
Es stellt sich nun die Frage, wie gesund Deutschlands Kinder wirklich sind. Nach
Aussagen der Medien, werden ‚Deutschlands Kinder immer dicker’ (STERN
30.11.2003, SPIEGEL 04.04.2007, FAZ 30.04.2007). Es gilt herauszufinden, ob man
anhand der aktuellen Datenlage überhaupt signifikante Aussagen darüber treffen
kann. Außerdem soll gezeigt werden, ob es beweisbare Veränderungen des
Gesundheitszustandes der Kinder und Jugendlichen im Vergleich zu früher gibt.
Anhand von internationalen, nationalen und regionalen Studien sollen verschiedene
Bereiche der Kindergesundheit untersucht werden. Dazu gehören die körperliche
Leistungsfähigkeit, Essstörungen, Verhaltens- und Entwicklungsstörungen sowie
chronische Erkrankungen. Ebenfalls sollen aktuelle Themen wie
Substanzmissbrauch oder sozioökonomische Einflüsse auf die Kindergesundheit
untersucht werden. Ein besonderes Augenmerk der Arbeit liegt dabei auf der
körperlichen Leistungsfähigkeit und Motorik sowie auf Übergewicht und Adipositas.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- GESUNDHEIT UND KRANKHEIT
- DAS BIOMEDIZINISCHE KRANKHEITSMODELL
- DAS BIO-PSYCHO-SOZIALE MODELL
- DAS RISIKOFAKTORENMODELL
- DAS MODELL DER SALUTOGENESE
- ZUSAMMENFASSUNG
- EPIDEMIOLOGIE
- ENTSTEHUNGSHINTERGRUND
- SOZIALWISSENSCHAFTLICHE METHODEN UND STUDIENTYPEN
- Experiment
- Randomisierte, kontrollierte Studie
- Fall-Kontroll-Studie
- Kohortenstudie
- Querschnittsstudie
- Korrelationsstudie
- LEITLINIEN DER DEUTSCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFT EPIDEMIOLOGIE (DAE)
- EVIDENZBASIERTE MEDIZIN
- GESCHICHTE DER EVIDENZBASIERTEN MEDIZIN
- QUALITÄTSKRITERIEN UND EVIDENZKLASSEN
- SCHWÄCHEN, GRENZEN UND KRITIK: DIE EBM UNTER GENAUER BETRACHTUNG
- PRAXIS UND ZUKUNFT DER EVIDENZBASIERTEN MEDIZIN
- ZUSAMMENFASSUNG
- ANALYSE DES GESUNDHEITSSTATUS VON KINDERN UND JUGENDLICHEN
- ÜBERBLICK ÜBER NATIONALE & INTERNATIONALE STUDIEN - AKTUELLE DATENLAGE
- KÖRPERLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT BEI KINDERN
- Kindliche Entwicklung und Bewegungsmangel
- Aktuelle Datenlage
- Ursachen von Bewegungsmangel
- Folgen von Bewegungsmangel
- Ziele und Veränderungsmöglichkeiten für die Zukunft
- Die motorische Leistungsfähigkeit
- Aktuelle Datenlage
- Ursachen für motorische Defizite
- Folgen motorischer Defizite
- Ziele und Veränderungsmöglichkeiten für die Zukunft
- Zusammenfassung
- ESS- UND GEWICHTSSTÖRUNGEN
- Anorexia nervosa und Bulimia nervosa
- Aktuelle Datenlage
- Ursachen für Anorexia nervosa und Bulimia nervosa
- Folgen von Anorexia nervosa und Bulimia nervosa
- Interventionsmaßnahmen
- Adipositas
- Aktuelle Datenlage
- Ursachen für Adipositas
- Folgen von Adipositas
- Präventions- und Interventionsmaßnahmen
- Zusammenfassung
- CHRONISCHE ERKRANKUNGEN
- Diabetes mellitus
- Allergische Erkrankungen
- Heuschnupfen
- Asthma bronchiale
- Neurodermitis (atopische Dermitis)
- Zusammenfassung
- VERHALTENSSTÖRUNGEN
- Hyperkinetische Störungen
- Angststörungen
- Störung des Sozialverhaltens
- Zusammenfassung
- SUBSTANZMISSBRAUCH- UND ABHÄNGIGKEIT
- SOZIOÖKONOMISCHE UND FAMILIÄRE FAKTOREN
- FAZIT ZUM GESUNDHEITSZUSTAND DER KINDER UND JUGENDLICHEN IN DEUTSCHLAND
- Entwicklung des Gesundheitsstatus von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
- Einfluss von sozioökonomischen und familiären Faktoren auf die Kindergesundheit
- Analyse verschiedener Krankheitsbilder und gesundheitlicher Risiken
- Aktuelle Datenlage zu körperlicher Leistungsfähigkeit, Essstörungen, Verhaltensstörungen, chronischen Erkrankungen und Substanzmissbrauch
- Bedeutung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Analyse des Gesundheitsstatus von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ziel ist es, die aktuelle Datenlage zu untersuchen und die Entwicklung des Gesundheitszustandes in den vergangenen Jahren zu beleuchten. Dabei werden verschiedene Krankheitsbilder und gesundheitliche Risiken im Fokus stehen, darunter körperliche Leistungsfähigkeit, Essstörungen, Verhaltensstörungen, chronische Erkrankungen und Substanzmissbrauch. Die Arbeit betrachtet dabei auch den Einfluss von sozioökonomischen und familiären Faktoren auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik der Kindergesundheit einführt und die Forschungsfragen der Arbeit formuliert. Im Anschluss werden verschiedene Modelle zur Definition von Gesundheit und Krankheit vorgestellt. Kapitel 3 behandelt die Epidemiologie als Methode zur Untersuchung von gesundheitsbezogenen Zuständen in einer Gesellschaft. Kapitel 4 widmet sich der Evidenzbasierten Medizin und ihren Prinzipien. Das fünfte Kapitel analysiert den Gesundheitsstatus von Kindern und Jugendlichen in Deutschland anhand aktueller Studien und Daten. Es werden dabei verschiedene Bereiche wie körperliche Leistungsfähigkeit, Essstörungen, chronische Erkrankungen und Verhaltensstörungen beleuchtet. Schließlich wird ein Fazit zu den Ergebnissen der Arbeit gezogen und ein Ausblick auf mögliche Präventivmaßnahmen für Thüringer Kinder und Jugendliche gegeben.
Schlüsselwörter
Kindergesundheit, Jugendgesundheit, Epidemiologie, Evidenzbasierte Medizin, Bewegungsmangel, Essstörungen, Adipositas, chronische Erkrankungen, Verhaltensstörungen, Substanzmissbrauch, sozioökonomische Faktoren, Präventionsmaßnahmen
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Gesundheitsstatus von Kindern in Deutschland untersucht?
Der Gesundheitsstatus wird mittels epidemiologischer Studien analysiert, die Daten zu körperlicher Fitness, Krankheiten und sozioökonomischen Faktoren sammeln.
Welche Rolle spielt die Epidemiologie in dieser Arbeit?
Die Epidemiologie dient als methodische Grundlage, um gesundheitsbezogene Zustände und deren Verteilung innerhalb der Gesellschaft wissenschaftlich zu erfassen.
Sind deutsche Kinder heute wirklich dicker als früher?
Die Arbeit untersucht die Datenlage zu Übergewicht und Adipositas, um festzustellen, ob Medienberichte über eine stetige Zunahme wissenschaftlich signifikant belegbar sind.
Welche Krankheitsbilder stehen im Fokus der Analyse?
Im Fokus stehen Essstörungen (Anorexie, Bulimie), Adipositas, Verhaltensstörungen (ADHS, Angststörungen) sowie chronische Erkrankungen wie Diabetes und Asthma.
Welchen Einfluss hat der sozioökonomische Status auf die Kindergesundheit?
Die Arbeit analysiert, wie familiäre Hintergründe und das Einkommen der Eltern die gesundheitliche Entwicklung und den Zugang zu Präventionsmaßnahmen beeinflussen.
Was bedeutet Evidenzbasierte Medizin (EBM) in diesem Kontext?
EBM bezieht sich auf die Nutzung der besten wissenschaftlichen Beweise für klinische Entscheidungen zur Behandlung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen.
- Quote paper
- M.A. Carolin Seidel (Author), 2007, Eine Analyse des Gesundheitsstatus von Kindern und Jugendlichen mittels epidemiologischer Studien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90465