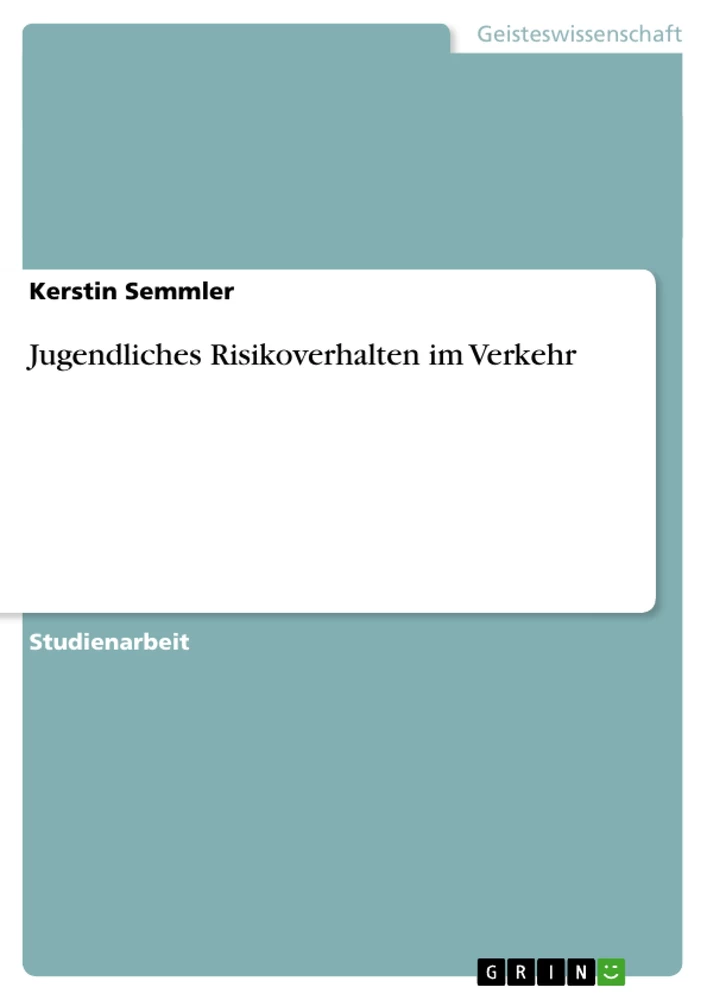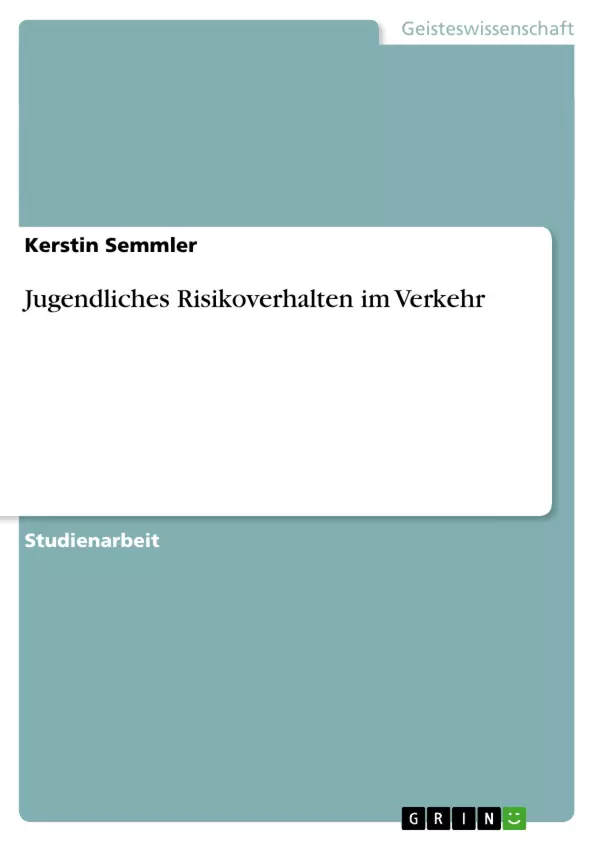Die vorliegende Arbeit möchte aus ökopsychologischer Sicht jugendliches Risikoverhalten im Verkehr darstellen, indem sie deskriptive statistische Zahlen aufbereitet, jugendliches Verkehrsverhalten beschreibt und Erklärungsansätze des Risikoverhaltens aufzeigt.
Jugendliches Risikoverhalten ist in einer Gesellschaft, für die der von Beck (1986) geprägte Name „Risikogesellschaft“ mittlerweile Allgemeingut geworden ist, dahingehend besonders signifikant, da die persönlichen Probleme und Chancen, die die Risikogesellschaft mit sich bringt, für die Jugendlichen hier in konzentrierter Form auftreten können. „Das Koordinatensystem, in dem das Leben und Denken in der industriellen Moderne befestigt ist – die Achsen von Familie und Beruf, der Glaube an Wissenschaft und Fortschritt -, gerät ins Wanken, und es entsteht ein neues Zwielicht von Chancen und Risiken – eben die Konturen der Risikogesellschaft.“ (Beck, 1986, S.20).
Die adoleszente Entwicklungsphase bringt für die Jugendlichen die besondere Herausforderung mit sich, eigenverantwortlich mit den Risiken des Lebens umgehen zu lernen und dabei Individualität und Bewältigungsstrategien zu entwickeln sowie einen eigenen Lebensweg zu finden. Dabei hat die räumliche Mobilität und vor allem die motorisierte Mobilität eine herausragende Bedeutung für die Jugendlichen, versinnbildlicht sie doch Unabhängigkeit, Kontrolle, Ansehen bei Gleichaltrigen, soziale Beweglichkeit und den Eintritt ins Erwachsenenleben. Die Bedeutung von Mobilität hat für die Menschen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten immer mehr zugenommen, der Verkehr wächst. (vlg. Statistisches Bundesamt, 2006, S.28) „Die Straße ist nach Wohnung und Arbeitsplatz bzw. Ausbildungsstätte einer der wichtigsten Verhaltensbereiche“ (Erke 1996, S. 549). Dementsprechend umfangreich sind Forschungsarbeiten der Verkehrspsychologie innerhalb der Ökopsychologie (vgl. Erke 1996). Verkehr wird in der Verkehrswissenschaft „als Überwindung von Raum durch Personen und Güter (Voigt 1973, S.34) oder als Ortsveränderungen, die im öffentlichen Verkehrsraum stattfinden (Hautzinger & Kessel 1977, S.10)“ definiert (Molt 1996, S. 555).
Um jugendliches Risikoverhalten im Verkehr beschreiben und verstehen zu können, ist es zunächst notwendig die Frage zu stellen, was unter Risiko und Risikoverhalten zu verstehen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Statistische Daten jugendlichen Verkehrsverhaltens
- Beschreibung, Motive und subjektives Erleben von allgemeinem sowie von risikoreichem jugendlichen Verkehrsverhalten
- Jugendliche Risikoeinstellung und Risikowahrnehmung
- Sensation Seeking im Verkehr
- Erklärungsansätze jugendlichen Risikoverhaltens im Verkehr
- Soziales und gesellschaftliches Umfeld
- Geschlechtsspezifische Sozialisation
- Entwicklungspsychologische und sozialisationstheoretische Ansätze
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht jugendliches Risikoverhalten im Verkehr aus ökopsychologischer Perspektive. Sie analysiert statistische Daten, beschreibt jugendliches Verkehrsverhalten und beleuchtet Erklärungsansätze für dieses Verhalten.
- Jugendliches Risikoverhalten im Kontext der Risikogesellschaft
- Die Bedeutung von Mobilität für Jugendliche in der heutigen Gesellschaft
- Die Rolle von Risiko und Risikowahrnehmung im jugendlichen Verkehrsverhalten
- Soziokulturelle und psychologische Einflussfaktoren auf jugendliches Risikoverhalten im Verkehr
- Mögliche Erklärungen für die hohe Unfallhäufigkeit unter Jugendlichen im Straßenverkehr
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in das Thema jugendliches Risikoverhalten im Verkehr ein und erläutert die Relevanz dieser Thematik im Kontext der Risikogesellschaft. Die besondere Bedeutung von Mobilität für Jugendliche und die Entwicklung von Eigenverantwortung werden hervorgehoben.
- Statistische Daten jugendlichen Verkehrsverhaltens: Dieses Kapitel präsentiert Daten über das Verkehrsaufkommen, Unfallzahlen und die Häufigkeit von Todesfällen im Straßenverkehr. Es wird der hohe Anteil jugendlicher Verkehrsopfer an der Gesamtzahl der Unfälle und Todesfälle herausgestellt.
- Beschreibung, Motive und subjektives Erleben von allgemeinem sowie von risikoreichem jugendlichen Verkehrsverhalten: Dieses Kapitel geht näher auf das Verhalten von Jugendlichen im Straßenverkehr ein. Es werden Motive und subjektive Erfahrungen mit riskantem Verhalten beschrieben.
- Jugendliche Risikoeinstellung und Risikowahrnehmung: Dieses Kapitel untersucht die Risikoeinstellung und Risikowahrnehmung von Jugendlichen im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr.
- Sensation Seeking im Verkehr: Dieses Kapitel betrachtet den Einfluss von Sensation Seeking, also dem Streben nach aufregenden Erlebnissen, auf das Verkehrsverhalten von Jugendlichen.
- Erklärungsansätze jugendlichen Risikoverhaltens im Verkehr: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Erklärungsansätze für jugendliches Risikoverhalten im Verkehr, die soziale und gesellschaftliche Faktoren, geschlechtsspezifische Sozialisation und Entwicklungspsychologie berücksichtigen.
Schlüsselwörter
Jugendliches Risikoverhalten, Verkehrsunfälle, Risikogesellschaft, Mobilität, Sensation Seeking, Sozialisation, Entwicklungspsychologie, Verkehrspsychologie, Ökopsychologie.
Häufig gestellte Fragen
Warum verhalten sich Jugendliche im Verkehr oft risikoreich?
Motive sind oft der Wunsch nach Unabhängigkeit, Kontrolle, Ansehen bei Gleichaltrigen und die Erprobung von Bewältigungsstrategien in der Adoleszenz.
Was bedeutet „Sensation Seeking“ im Straßenverkehr?
Sensation Seeking beschreibt das aktive Streben nach aufregenden Erlebnissen und Reizen, was bei Jugendlichen oft zu höherer Geschwindigkeit oder gewagten Fahrmanövern führt.
Wie beeinflusst die „Risikogesellschaft“ das Verhalten Jugendlicher?
In einer Gesellschaft, in der traditionelle Sicherheiten schwinden, treten Chancen und Risiken für Jugendliche konzentrierter auf, was den Umgang mit Gefahren zur Entwicklungsaufgabe macht.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede beim Verkehrsrisiko?
Ja, die Arbeit untersucht geschlechtsspezifische Sozialisation als Erklärungsansatz für unterschiedliche Risikoeinstellungen zwischen Jungen und Mädchen.
Welche Bedeutung hat Mobilität für Jugendliche?
Motorisierte Mobilität versinnbildlicht für Jugendliche den Eintritt ins Erwachsenenleben, soziale Beweglichkeit und Autonomie.
- Quote paper
- Kerstin Semmler (Author), 2007, Jugendliches Risikoverhalten im Verkehr, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90474