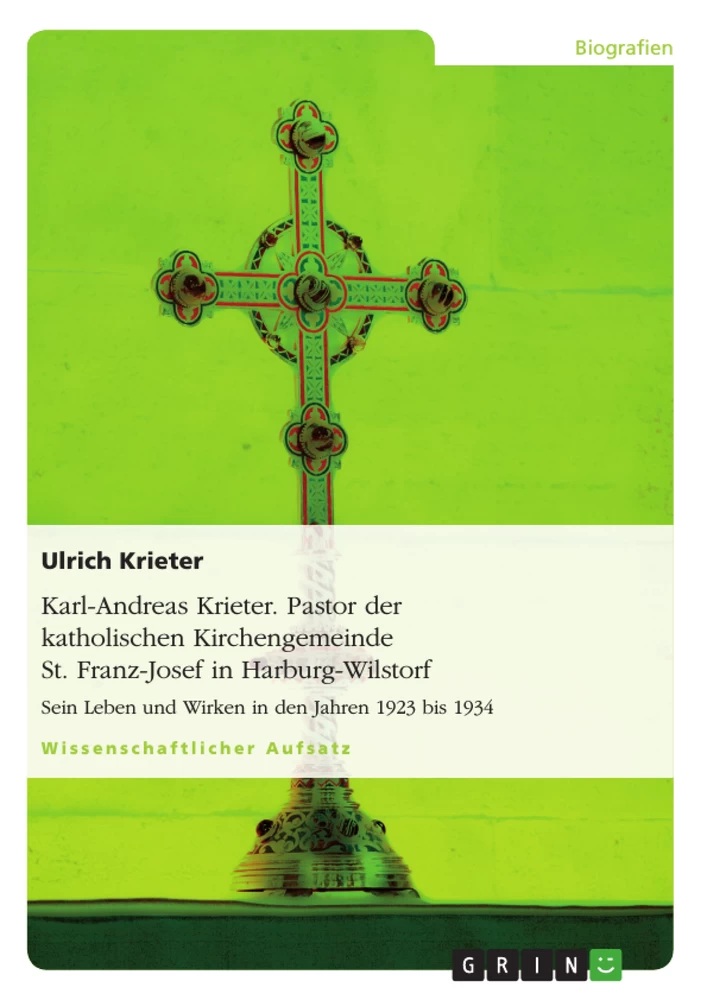Am 4. Februar des Jahres 1969 gab der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg bekannt, dass eine Straße des Hamburger Stadtteils Wilhelmsburg den Namen „Krieterstraße“ erhalten habe. Die Benennung erfolgte auf einstimmigen Vorschlag des Ortsausschusses Wilhelmsburg zur Ehrung des Pfarrers der katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius, Karl- Andreas Krieter. Er war sechs Jahre zuvor gestorben, am 24. Februar des Jahres 1963. Der Pastor, Pfarrer und Dechant Karl-Andreas Krieter galt vielen Menschen seiner Zeit als bedeutende und liebenswerte Persönlichkeit. Die katholische Kirche und die Bundesrepublik Deutschland ehrten ihn durch Auszeichnungen. Im Jahre 1960 erhielt er aus der Hand des Gesundheitssenators der Freien und Hanesestadt Hamburg - Schmedemann - das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, weil auf seine Initiative hin das katholische Krankenhaus "Groß Sand" in Hamburg-Wilhelmsburg errichtet worden war.
Vor seiner Tätigkeit in Wilhelmsburg war Pfarrer Karl-Andreas Krieter elf Jahre Pastor in der Gemeinde St. Franz-Josef in Harburg-Wilstorf.
Karl-Andreas Krieter wurde im Jahre 1890 geboren. Der Hintergrund seines Lebensweges sind also vier Epochen der jüngeren deutschen Geschichte, die nicht nur sein persönliches Leben, sondern auch das Wesen des gegenwärtigen Deutschland entscheidend geprägt haben. Der vorliegende 1. Teil seiner Biografie schildert das Leben und Wirken des Pastors Karl-Andreas Krieter während der Jahre 1923 bis 1934. Die Darstellung legt besonderen Wert auf die zeitgeschichtlichen Entwicklungen in der damals selbständigen preußischen Stadt Harburg, die im Jahre 1937 ein Teilgebiet Hamburgs wurde. Die Ortsgeschichte Harburgs in der Zeit der Weimarer Republik und während der ersten beiden Jahre der Hitler-Diktatur findet in diesem 1. Teil der Biografie des Karl-Andreas Krieter breiten Raum. Der 2. Teil seiner Biografie wird demnächst fertig gestellt sein.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Die ersten beiden Jahre im Pastorenamt
- 1.1. Das Pfarrer-Examen und die Zeit des Wartens
- 1.2. Erste Informationen über die Franz-Joseph-Gemeinde
- 1.3. Die Franz-Joseph-Kirche und die Wohnsituation des Pastors Krieter im Jahre 1923
- 1.4. Erste Orientierung in Harburg
- 1.5. Vom Hunger getrieben - Unruhen in Harburg
- 1.6. Pastor Krieter gründet zwei Vereine zum Kampf gegen die Not in der Franz-Joseph-Gemeinde
- 1.7. Katholisches Vereinsleben und die Konkurrenz der „weltlichen“ Vereine
- 1.8. Aus „Franz-Joseph“ wird „St. Franz-Josef“
- 1.9. Die alltägliche Arbeit
- 2. Die „Große Politik“ und das politische Geschehen in Harburg während der ersten Hälfte der 20er Jahre
- 2.1. Bürgerkriegsgefahr
- 2.2. Das „Wunder der Rentenmark“ und der „Dawes-Plan“
- 2.3. Die Reichstagswahl vom 4. Mai 1924 und die Wahl der Bürgervorsteher in Harburg
- 2.4. Dr. Walter Dudek wird Oberbürgermeister von Harburg
- 2.5. Der Tod des Reichspräsidenten Friedrich Ebert
- 2.6. Paul von Hindenburg wird Reichspräsident
- 3. Pastor Krieter und seine Gemeinde in der zweiten Hälfte der 20er Jahre
- 3.1. Aussicht auf Weltfrieden und Wirtschaftsaufschwung in Deutschland
- 3.2. Wirtschaftsaufschwung in Harburg-Wilhelmsburg
- 3.3. Neuerungen in St. Franz-Josef
- 3.4. Katholische Sorge um gute Sitte und öffentliche Moral
- 3.4.1. Die Sorgen des Pastors Krieter wegen der verderblichen Wirkung der neuen Medien
- 3.4.2. Leitsätze der deutschen Bischöfe zu Sittlichkeitsfragen
- 4. Pastor Krieter bittet um Versetzung
- 4.1. Das Haus Reeseberg 16
- 4.2. Das Zerwürfnis mit Pfarrer Krell
- 5. Pastor Krieter erlebt den Niedergang der Demokratie.
- 5.1. Die Weltwirtschaftskrise
- 5.2. Kirchliche Arbeitslosen- und Armenfürsorge in Harburg
- 5.3. „Katholisch bin und bleibe ich“.
- 6. Die Übergangszeit von der Demokratie zur Diktatur
- 6.1. Die Reichstagswahl vom 14. September 1930
- 6.2. Reaktionen auf die Reichstagswahl
- 6.3. Dr. Brüning regiert mittels Notverordnungen
- 6.4. Die zweite Regierung Dr. Brüning und die Wahlen zum Amt des Reichspräsidenten
- 6.5. Die Entlassung des Dr. Brüning
- 7. Die Demokratie stirbt
- 8. Die ersten Monate der Hitler-Regierung
- 8.1. Fackelzüge in Berlin und Harburg-Wilhelmsburg
- 8.2. Vor der Reichstagswahl vom 5. März 1933
- 8.2.1. Gewalt gegen Kommunisten in Harburg-Wilhelmsburg
- 8.2.2. Das Reichstagsgebäude brennt.
- 8.2.3. Prominente Unterstützer des Nationalsozialismus in Harburg-Wilhelmsburg
- 8.2.4. Terror und Propaganda der Nationalsozialisten
- 8.3. Die Wahlergebnisse am 5. März 1933
- 8.4. Die „Machtergreifung“ der NSDAP in Harburg-Wilhelmsburg
- 8.4.1. Die Hakenkreuzfahne auf dem Harburger Rathaus
- 8.4.2. Dr. Dudek wird aus dem Rathaus gewiesen
- 8.4.3. Die Wahl des Bürgervorsteher-Kollegiums am 12. März 1933
- 8.5. Das „Ermächtigungsgesetz“
- 8.5.1. Perfekte Propaganda der Hitler-Regierung am 21.3.1933
- 8.5.2. Die „Nationale Feier“ in Harburg-Wilhelmsburg
- 8.5.3. Die Katholische Kirche sucht ihren Vorteil.
- 8.5.4. Die „Zentrumspartei“ stimmt dem „Ermächtigungsgesetz“ zu.
- 8.6. Willkür und Gewalt der Nationalsozialisten hören nicht auf.
- 8.6.1. Willkürliche Veränderungen des Wählerwillens im Bürgervorsteherkollegium
- 8.6.2. Racheaktionen an Kommunisten in Harburg
- 8.6.3. Der Juden-Boykott am 1. April 1933 und die Haltung der Katholiken zu den Juden
- 8.7. Der „Hitler-Tag“ in Harburg-Wilhelmsburg
- 9. „Gleichschaltung“ allüberall
- 9.1. Die „Gleichschaltung“ der Länder und der Berufs- und Wirtschaftsorganisationen
- 9.2. Die Gleichschaltung der Politischen Parteien
- 9.3. Gleichschaltungsversuche in der Evangelischen Kirche
- 9.4. Erste Versuche, die katholischen Vereine gleichzuschalten - Hausdurchsuchung bei Pastor Krieter
- 10. Das Reichskonkordat – ein geschickter Schachzug des Vatikans oder des Adolf Hitler?
- 10.1. Der Abschluss des Reichskonkordats – Euphorie der Katholiken
- 10.2. Bischofsbesuch in Harburg
- 11. Anpassung und Begeisterung – neue Gewalttaten und neue Propaganda in Harburg-Wilhelmsburg
- 11.1. „Nationalsozialistischer Geist“ zieht in die katholischen Schulen ein.
- 11.2. Erneuter Terror gegen Kommunisten und erste Gewalttätigkeiten gegen Katholiken
- 11.3. Luftschutzpropaganda
- 11.4. Entrümpelungskampagnen
- 12. Mord und Totschlag und das Schweigen der Bischöfe
- 13. Hitler vereint die gesamte Staatsmacht in seiner Person
- 14. Pastor Krieter wird zur St. Bonifatius-Gemeinde in Wilhelmsburg versetzt.
- Verzeichnis der Abbildungen
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Personenregister
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit erzählt die Geschichte des katholischen Pfarrers Karl-Andreas Krieter. Er war von 1923 bis 1934 Pastor der St. Franz-Josef-Gemeinde in Harburg-Wilstorf, später Pfarrer der St. Bonifatius-Gemeinde in Wilhelmsburg. Der Schwerpunkt liegt auf seinen ersten elf Dienstjahren in Harburg-Wilstorf. Die Geschichte seiner Gemeinde wird im Rahmen der Ereignisse beschrieben, die das politische und wirtschaftliche Leben Deutschlands und Harburg-Wilhelmsburgs in den Jahren von 1923 bis 1934 prägten.
- Die Entwicklung der St. Franz-Josef-Gemeinde von 1923 bis 1934
- Die Auswirkungen des Ruhrkampfes und der Weltwirtschaftskrise auf Harburg-Wilhelmsburg
- Das Verhältnis der Katholischen Kirche zum Nationalsozialismus
- Die Rolle des Pfarrers Krieter im öffentlichen Leben der Stadt Harburg-Wilhelmsburg
- Das Leben des Pfarrers Krieter im Spannungsfeld zwischen politischer Veränderung und religiösem Auftrag
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Zeit beschrieben, in der Karl-Andreas Krieter, der in Hilkerode im Eichsfeld aufgewachsen ist, nach dem Ersten Weltkrieg zum Priester geweiht wurde und zum Pfarrer-Examen zugelassen wurde. Anschließend berichtet die Arbeit von den ersten Monaten, in denen Karl-Andreas Krieter im September 1923 Pastor der katholischen Kirchengemeinde St. Franz-Josef in Harburg-Wilstorf war. Die Arbeit schildert die große Not, die durch den Ruhrkampf und die Inflation ausgelöst worden ist, sowie die schwierige Wohnsituation des Pfarrers.
Kapitel 2 beschreibt das politische und wirtschaftliche Geschehen in Harburg im Verlauf der ersten Hälfte der 20er Jahre. Die Arbeit berichtet von der Gefahr, die von separatistischen und nationalistischen Bestrebungen ausging. Die Arbeit beleuchtet außerdem die Bedeutung des Dawes-Plans für Deutschland.
Kapitel 3 beschreibt die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs in Harburg-Wilhelmsburg und die Entwicklung der St. Franz-Josef-Gemeinde in der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Die Arbeit beschreibt die Sorgen des Pfarrers Krieter um die öffentliche Moral, die durch die neuen Medien und den Einfluss „weltlicher“ Vereine gefährdet war.
Kapitel 4 schildert das Zerwürfnis des Pfarrers Krieter mit seinem Vorgesetzten, dem Pfarrer Krell. Die Arbeit berichtet davon, wie der Pfarrer Krieter das Haus Reeseberg 16 erbaut hat, um der St. Franz-Josef-Gemeinde angemessene Räume für den Gemeindebetrieb zu ermöglichen.
Kapitel 5 beleuchtet die schwere Zeit, die die St. Franz-Josef-Gemeinde und die Stadt Harburg-Wilhelmsburg mit der Weltwirtschaftskrise ab 1930 zu überstehen hatten.
Im sechsten Kapitel erzählt die Arbeit vom politischen Geschehen in Deutschland und Harburg-Wilhelmsburg während der letzten Jahre der Weimarer Republik. Die Arbeit beschreibt das Vorgehen der Regierung unter Reichskanzler Heinrich Brüning und die Wahlkämpfe um das Amt des Reichspräsidenten im Jahre 1932.
Kapitel 7 beschreibt die Ereignisse, die zum Ende der Weimarer Republik führten. Der Rücktritt des Reichskanzlers Brüning und die Ernennung des Franz von Papen zum Reichskanzler werden im Detail dargestellt.
Im achten Kapitel berichtet die Arbeit von den ersten Monaten der Hitler-Regierung. Das „Gesetz zum Schutz von Volk und Staat“ wird genau betrachtet, ebenso die Hausdurchsuchungen in der St. Franz-Josef-Gemeinde und im Viertel Neuhof.
Kapitel 9 beschreibt den Aufbau der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland. Die Arbeit zeigt die „Gleichschaltung“ der Länder, der politischen Parteien und der Berufs- und Wirtschaftsorganisationen.
Kapitel 10 beschreibt den Abschluss des Konkordats zwischen dem Vatikan und der Hitler-Regierung und die Euphorie der deutschen Katholiken.
Kapitel 11 berichtet von den ersten Schritten zur „Gleichschaltung“ der katholischen Schulen in Harburg-Wilhelmsburg.
Kapitel 12 beleuchtet die Morde im Rahmen des so genannten Röhm-Putsches und das Schweigen der deutschen Bischöfe.
Kapitel 13 erzählt von der Machtübernahme Adolf Hitlers und der Einrichtung der totalitären Diktatur.
Im letzten Kapitel, Kapitel 14, wird die Versetzung des Pastors Krieter von St. Franz-Josef in Wilhelmsburg geschildert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Leben und Wirken von Karl-Andreas Krieter, einem katholischen Pfarrer der St. Franz-Josef-Gemeinde in Harburg-Wilstorf. Die Arbeit zeigt auf, wie der Pfarrer Krieter das politische und wirtschaftliche Geschehen in den Jahren von 1923 bis 1934 erlebte und wie er seinen religiösen Auftrag mit den Herausforderungen seiner Zeit versuchte in Einklang zu bringen. Die Arbeit beleuchtet außerdem die politischen und sozialen Probleme der Weimarer Republik und die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf das Leben der Menschen in Harburg-Wilhelmsburg. Die Arbeit zeigt weiterhin auf, wie sich die Katholische Kirche mit den Nationalsozialisten arrangierte und wie die nationalsozialistische „Gleichschaltung“ das Leben des Pfarrers Krieter und seiner Gemeinde prägte.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Karl-Andreas Krieter?
Karl-Andreas Krieter (1890–1963) war ein bedeutender katholischer Pfarrer in Harburg-Wilstorf und Wilhelmsburg, der für sein soziales Engagement und den Bau des Krankenhauses "Groß Sand" mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde.
In welcher Zeit wirkte Pfarrer Krieter in Harburg-Wilstorf?
Er war von 1923 bis 1934 Pastor der Gemeinde St. Franz-Josef, eine Zeit, die vom Ende der Inflation über die Weltwirtschaftskrise bis hin zur Machtergreifung der Nationalsozialisten reichte.
Wie reagierte die katholische Kirche in Harburg auf die NS-Diktatur?
Die Arbeit beschreibt ein Spannungsfeld zwischen Anpassung, Euphorie über das Reichskonkordat und ersten Repressalien wie Hausdurchsuchungen bei Pastor Krieter durch die Nationalsozialisten.
Was war das Besondere am Haus Reeseberg 16?
Pastor Krieter ließ dieses Haus bauen, um der Gemeinde angemessene Räume für soziale Arbeit und Vereinsleben zu bieten, was jedoch zu Konflikten mit seinem Vorgesetzten führte.
Welche sozialen Unruhen gab es 1923 in Harburg?
Infolge von Hunger und Inflation kam es zu Unruhen; Pastor Krieter gründete daraufhin Vereine zur Linderung der Not in seiner Gemeinde.
- Quote paper
- Ulrich Krieter (Author), 2008, Karl-Andreas Krieter. Pastor der katholischen Kirchengemeinde St. Franz-Josef in Harburg-Wilstorf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90529