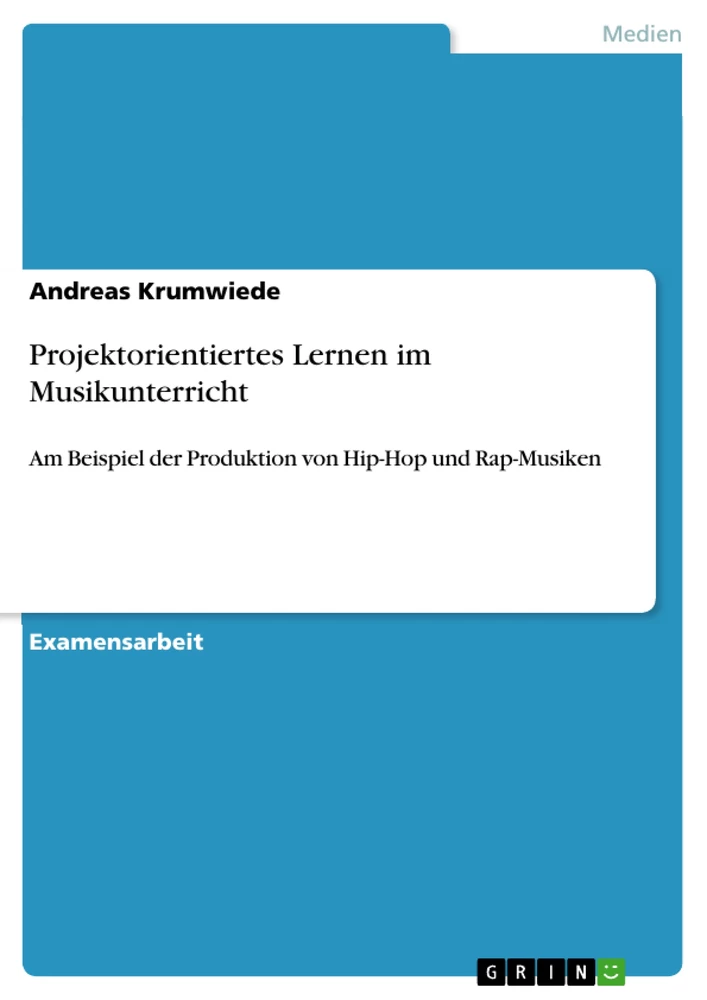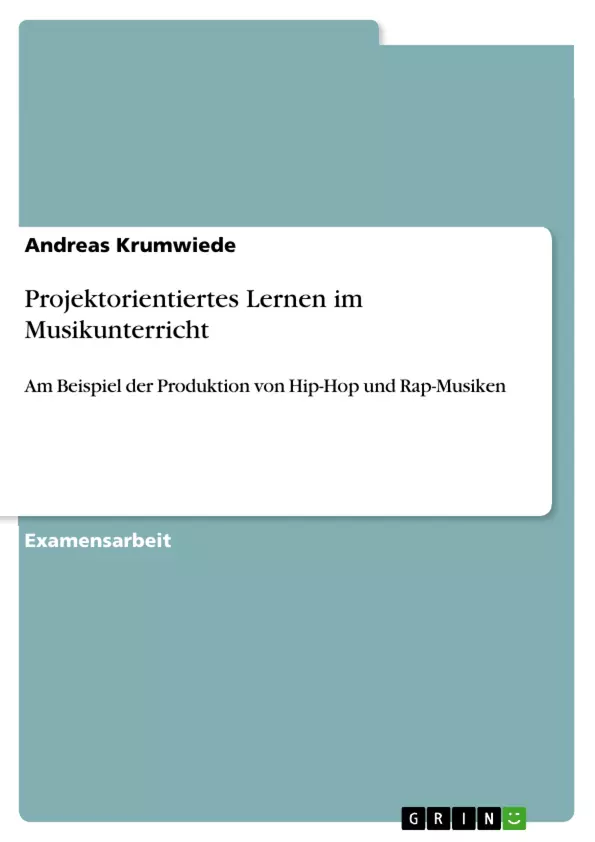Die Arbeit bietet anregende Möglichkeiten, sich dem Thema Hip-Hop projektorientiert auf unterschiedliche Weise zu nähern. Sie stellt das Projekt (nach Karl Frey), den Projektgedanken (nach John Dewey und William Heard Kilpatrick) und Handlungsorientierten Unterricht (nach Herbert Gudjons) vor. Ebenso stellt sie die Entstehung und Entwicklung des Hip-Hop dar von den 1970er Jahren (Grandmaster Flash, Cool DJ Herc) bis heute dar. Der Autor bietet verschiedene Projektideen (nach der Produktionsdidaktik von Christopher Wallbaum) zum Thema Hip-Hop mit an.
Die Jugendlichen von heute und damit die Schüler stehen einer immer größer werdenden Auswahl an Musik gegenüber. Populäre Musik ist allgegenwärtig und die dominierende Musikform unserer Zeit. Ständig werden neue Stile geprägt oder vorhandene weiterentwickelt. Ebenso schnell, wie sie entstanden, verschwinden viele davon wieder. Das gilt für Hip-Hop und Rap nicht. Seit Entstehen der Jugendkultur Hip-Hop Mitte der siebziger Jahre in New York und der Verbreitung in der Öffentlichkeit seit 1979 hat sich diese Kultur zu einer festen, sich ständig weiterentwickelnden Musikrichtung und Lebenseinstellung und somit zu einer der wichtigsten Jugendkulturen unserer Zeit etabliert.
Diese Sparte stellt eines der meistumsetzenden Segmente der Tonträgerindustrie dar und wird vornehmlich von Jugendlichen, also insbesondere Schülern, gehört. Hip-Hop ist heute weltweit in allen Medien vom Film bis zur Werbung präsent und hat sich somit zu einem globalen Phänomen zwischen Mainstream und Untergrund entwickelt.
Auch das Projekt hat als Unterrichtsform nach wie vor Konjunktur. Im Zeitalter der Informationen wird es zunehmend wichtiger, dass Schülern die Gelegenheit gegeben wird, authentische Erfahrungen mit der Wirklichkeit zu machen und sie nicht nur durch Betrachten, Hören oder Lesen zu vermitteln. Ob und in welcher Weise sich der Projektgedanke und die ihm zugehörigen Unterrichtsmethoden eignen, Erfahrungen mit der Herstellung von Handlungsprodukten im Musikunterricht zu machen, ist ein Thema der Arbeit. Welche Handlungsprodukte sind möglich? Welche Voraussetzungen herrschen auf Schüler- bzw. Lehrerseite? Welche Hilfsmittel didaktischer, methodischer und technischer Art stehen dem interessierten Lehrer zur Verfügung? Welche ästhetischen Anforderungen soll, muss oder kann ein von Schülern und Lehrer(n) hergestelltes Produkt erfüllen? Wozu sollen Produkte überhaupt gut sein, welche Lernerfahrungen können sie vermitteln?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. THEORETISCHE ASPEKTE
- 1. Einführende Betrachtungen zum Handlungsorientiertem Unterricht
- 1.1. Definition von Handlungsorientiertem Unterricht
- 1.2. Voraussetzungen für Handlungsorientierten Unterricht
- 1.3. Merkmale von Handlungsorientiertem Unterricht
- 1.4. Produkte im Handlungsorientierten Unterricht
- 2. Der Projektgedanke – Unterrichtskonzeptionen und Besonderheiten
- 2.1. Projekt, Projektunterricht, Projektmethode sowie Geschichte der Projektmethode
- 2.1.1. Definition des Projekts
- 2.1.2. Der Begriff des Projektorientierten Lernens
- 2.1.3. Definition der Projektmethode
- 2.1.4. Geschichte der Projektmethode
- 2.2. Theoretische Ansätze der Projektmethode und des Projektunterrichts
- 2.2.1. Die Urväter des Projektes in der allgemein bildenden Schule: John Dewey (1859-1952) und William Heard Kilpatrick (1871-1965)
- 2.2.2. Die Projektmethode nach Karl Frey
- 2.2.3. Projektunterricht nach Herbert Gudjons
- 2.3. Besonderheiten des Projektmethode, des Projektunterrichts und des Projektorientierten Lernens
- 2.3.1. Besonderheiten der Lehrerrolle
- 2.3.2. Besonderheiten der Schülerrolle
- 2.3.3. Die Schule: eine andere Rolle im Projektunterricht
- 2.3.4. Leistungsbegriff und Leistungsbeurteilung im Projekt
- 2.3.5. Die Bedeutung der Produkte im Projekt
- 3. Ästhetische Erfahrungen im Projektorientierten Lernen
- 3.1. Ästhetik und ästhetische Erfahrung
- 3.2. Das Produkt bei Wallbaum
- 3.3. Ästhetische Theorie in der Produktionsdidaktik
- 3.4. Die Prozess-Produkt-Didaktik und die ästhetische Erfahrung
- 4. Thesen und aktuelle Forderungen an einen zeitgemäßen Musikunterricht
- II. SACHANALYSE
- 1. HipHop bzw. Rap
- 1.1. Definitionen von HipHop und Rap
- 1.1.1. Definition von HipHop
- 1.1.2. Definition von Rap
- 1.2. Entstehung und Geschichte der HipHop-Kultur
- 1.3. Die Elemente der HipHop-Kultur: Rap, Breakdance, Graffiti
- 1.3.1. Die Musik: Rap und DJing
- 1.3.2. Der Tanz: Breakdance
- 1.3.3. Die visuelle Ausdrucksform: Graffiti
- 1.4. Stilistische Entwicklung der HipHop- bzw. Rapmusik
- 1.4.1. Die Schools des HipHop
- 1.4.2. HipHop in Europa und Deutschland
- 1.5. Die Texte
- III. UNTERRICHTSPRAKTISCHE ASPEKTE
- 1. Informationsquellen
- 1.1. Informationsquellen für Schüler
- 1.2. Informationsquellen für Lehrer
- 2. Voraussetzungen für produktorientierten Projektunterricht im Fach Musik
- 2.1. Rahmenplananalyse
- 2.2. Die Voraussetzungen für die Schüler
- 2.3. Die Voraussetzungen für die Lehrer
- 2.4. Die Ausstattung des Musikfachraums bzw. des Projektraums
- 2.5. Materialien und Einrichtungen
- 3. Die Produktionstechniken
- 3.1. Die Produktion des Textes
- 3.2. Die Produktion der Musik
- 4. Projektvorschläge zum Thema HipHop bzw. Rap
- 4.1. Die Ausstellung zum Thema HipHop: ein theoretischer Aspekt
- 4.2. Praktische Projektideen und ihre Entwürfe
- 4.3. Ein Kleinprojekt: Erarbeiten eines rhythmischen Patterns und eines Raps
- 4.4. Ein Mittelprojekt: Lebensentwürfe am Beispiel des Songs „Millenium“
- 4.5. Die Produktion und Aufnahme eines eigenen Songs
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten projektorientierten Lernens im Musikunterricht am Beispiel der Produktion von HipHop- und Rap-Musik. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen des Handlungsorientierten und Projektorientierten Unterrichts sowie die Geschichte und die Elemente der HipHop-Kultur. Darüber hinaus werden praktische Beispiele für die Umsetzung von Projekten im Musikunterricht gegeben.
- Handlungstheoretische Ansätze des projektorientierten Lernens
- Entwicklung des Projektgedankens in der Pädagogik
- Die Rolle von Produkten und ästhetischen Erfahrungen im projektorientierten Unterricht
- Analyse der HipHop-Kultur und ihrer Elemente
- Praktische Umsetzung von Projekten im Musikunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet eine Einführung in das Thema der Arbeit und erläutert die Forschungsfrage. Das erste Kapitel analysiert die theoretischen Grundlagen des Handlungsorientierten und Projektorientierten Unterrichts. Es werden verschiedene Definitionen, Voraussetzungen und Merkmale dieser Unterrichtsformen betrachtet sowie die Geschichte der Projektmethode und die Rolle von Produkten im Unterricht untersucht. Das zweite Kapitel fokussiert sich auf die ästhetischen Erfahrungen im Projektorientierten Lernen. Es werden verschiedene Theorien und Ansätze zur Ästhetik im Bildungskontext beleuchtet, sowie die Bedeutung von Produkten und Prozessen im Zusammenhang mit der ästhetischen Erfahrung.
Das dritte Kapitel analysiert die HipHop-Kultur und ihre Elemente, insbesondere die Musik, den Tanz und die visuelle Ausdrucksform Graffiti. Es werden die Entstehung und Entwicklung der HipHop-Kultur betrachtet sowie wichtige stilistische Merkmale und Vertreter der Musikrichtung vorgestellt. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den praktischen Aspekten des Projektorientierten Lernens im Musikunterricht am Beispiel von HipHop und Rap. Es werden verschiedene Informationsquellen für Schüler und Lehrer vorgestellt, sowie wichtige Voraussetzungen für die Durchführung von Projekten im Musikunterricht.
Im fünften Kapitel werden konkrete Projektvorschläge zum Thema HipHop und Rap vorgestellt. Dabei wird zwischen Klein-, Mittel- und Großprojekten differenziert und die praktische Umsetzung von Projekten anhand von Beispielen erläutert.
Schlüsselwörter
Projektorientierter Unterricht, Handlungsorientierter Unterricht, Projektmethode, HipHop, Rap, Musikunterricht, Ästhetik, ästhetische Erfahrung, Produktionsdidaktik, Prozess-Produkt-Didaktik, Kulturpädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Wie lässt sich Hip-Hop im Musikunterricht projektorientiert umsetzen?
Durch handlungsorientierten Unterricht können Schüler eigene Texte produzieren, Beats bauen oder Ausstellungen zur Hip-Hop-Kultur gestalten.
Welche pädagogischen Ansätze liegen dem Projektunterricht zugrunde?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorien von Karl Frey (Projektmethode), John Dewey (Learning by doing) und Herbert Gudjons.
Was sind die vier Elemente der Hip-Hop-Kultur?
Dazu gehören Rap (Musik), DJing, Breakdance (Tanz) und Graffiti (visuelle Ausdrucksform).
Warum eignet sich Hip-Hop besonders für Jugendliche in der Schule?
Hip-Hop ist eine dominante Jugendkultur und Lebenseinstellung, die authentische Erfahrungen mit der Lebenswirklichkeit der Schüler ermöglicht.
Was ist das Ziel der Produktionsdidaktik nach Christopher Wallbaum?
Ziel ist es, durch die Herstellung eigener ästhetischer Produkte (z.B. ein aufgenommener Song) tiefere Lernerfahrungen und ästhetische Erkenntnisse zu gewinnen.
- Quote paper
- Andreas Krumwiede (Author), 2002, Projektorientiertes Lernen im Musikunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90579