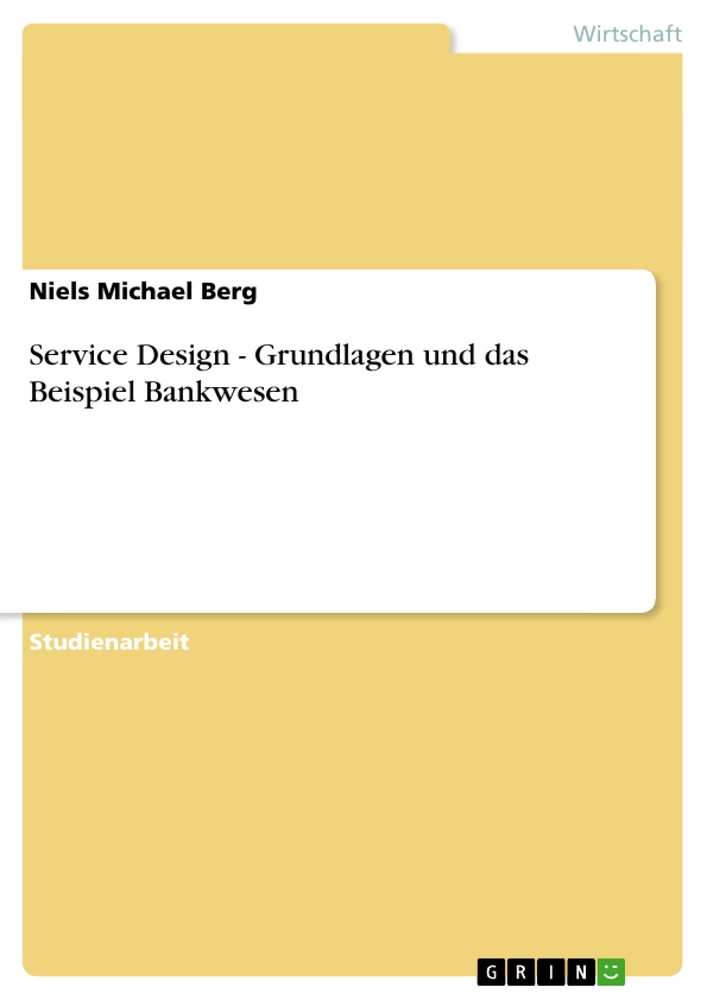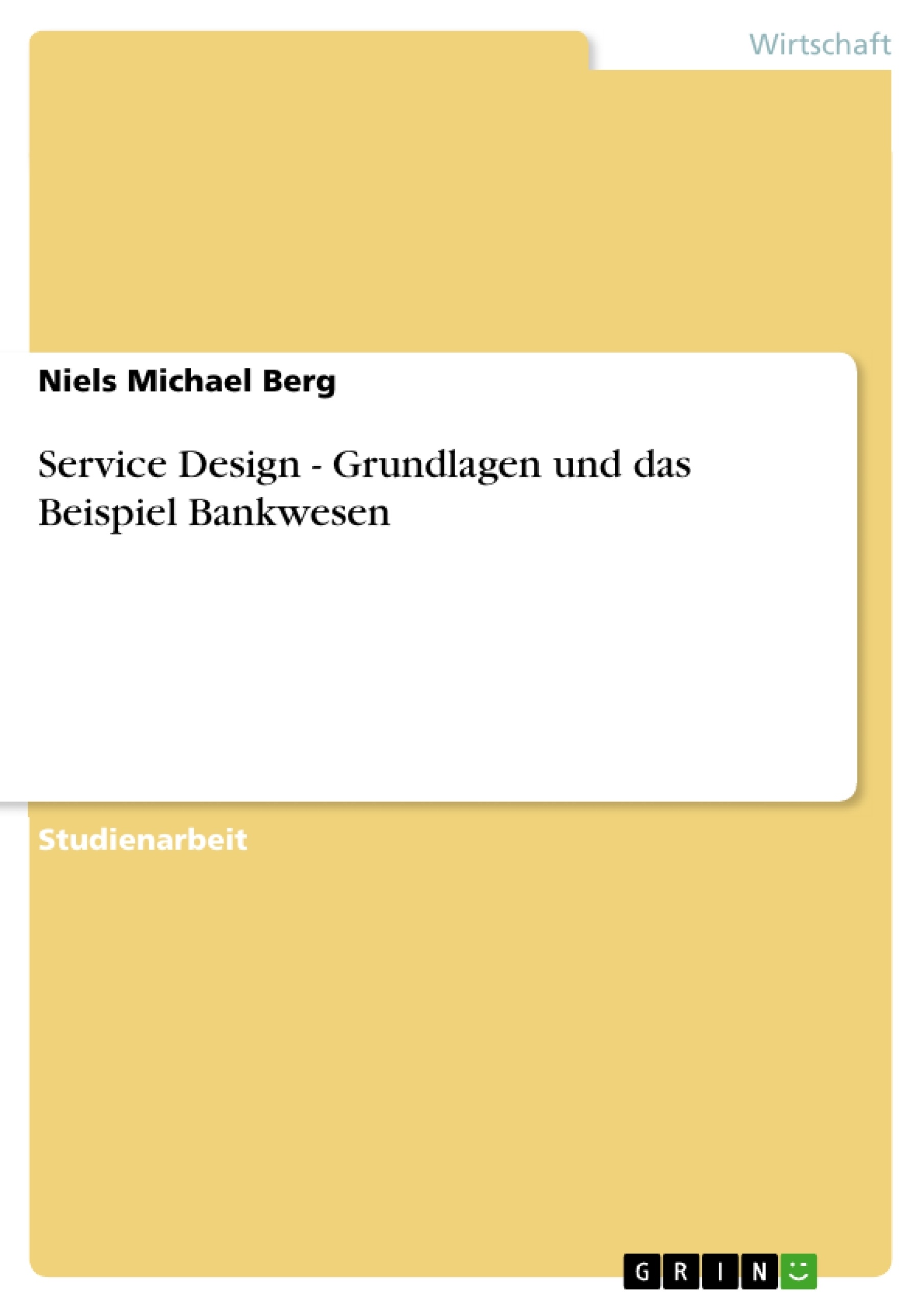Von 1990 bis 2003 ist der Anteil des tertiären Sektors am BIP von 60,0% auf 70,3% gestiegen. Diese Entwicklung schlägt sich ebenfalls in der Erwerbstätigkeit im Dienstleistungssektor nieder. Diese stieg allein in den Jahren 2000 bis 2003 von 64,2% auf 66,0% an. Führt man diesen Trend fort, entwickeln wir uns zu einer sog. `Dienstleistungsgesellschaft´.
Einer der Gründe für das anhaltende Wachstum im Dienstleistungssektor ist die stete Homogenisierung der im Markt angebotenen Konsumgüter. Unternehmen erweitern im Kampf um Wettbewerbsvorteile ihre Sachgüter um Dienstleistungskomponenten und versuchen sich so gegen ihre Wettbewerber durchzusetzen.
Des Weiteren verlangt der Kunde vermehrt nach komplexen Problemlösungen, wodurch der systematischen und strukturierten Entwicklung von Dienstleistungen eine immer größer werdende Bedeutung zukommt.
Bei dem Versuch den gestiegenen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden sehen sich die Unternehmen aber auch einem Mangel an geeigneten Vorgehensweisen, Methoden und Werkzeugen gegenüber, sowie fehlenden organisatorischen Strukturen im Bereich der Dienstleistungsentwicklung . Die in der Vergangenheit häufig praktizierte Vorgehensweise des `learning-by-doing´ bei der Entwicklung von Dienstleistungsangeboten birgt das Risiko, den Kunden anfänglich nicht zufrieden zu stellen. Dieses kann zu Reklamationen oder sogar Kundenabwanderungen führen und somit wird nicht nur kein Wettbewerbsvorteil erlangt, sondern das erforderliche Reengineering verursacht zusätzlich hohe Kosten.
Die Herausforderung an die Unternehmen und das Service-Design besteht darin, die Dienstleistung als Ganzes, in sich geschlossenes System mit einer Vielzahl von Prozessen zu verstehen. Die Funktion des Service-Designs ist, diese verschiedenen Prozesse in unterschiedlichen Dimensionen zu gestalten und den Unternehmen somit einen strukturierten Ablauf zur Erstellung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen zu ermöglichen.
Im Rahmen dieser Arbeit sollen die unterschiedlichen Konzepte des Service-Designs vorgestellt und anhand des Bankensektors die Anwendungsmöglichkeiten des Service-Designs aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1. Problemstellung der Arbeit
- 1.2. Gang der Untersuchung
- 2. Konzeptionelle Grundlagen
- 2.1. Definition des Service-Begriffs
- 2.2. Erläuterung der Service-Entwicklung an ausgewählten Ansätzen
- 2.2.1. Service-Design Konzept nach RAMASWAMY
- 2.2.2. Design-Ansatz nach ISO
- 2.2.3. Service Development-Konzept nach EDVARDSSON und OLSSON
- 2.3. Design als Grundlage für das Service-Design
- 2.3.1. Einführung in den Design-Begriff
- 2.3.2. Abgrenzung des Design-Begriffs im Dienstleistungsbereich
- 3. Die Phasen im Prozess des Service-Designs nach Haller
- 3.1. Ideenfindung und -bewertung
- 3.2. Aufnahme der Anforderungen
- 3.3. Entwicklung, Evaluation und Auswahl von Servicekonzepten
- 3.4. Design der Prozesse
- 3.5. Design der materiellen Komponenten
- 3.6. Implementierung
- 4. Service Design im deutschen Bankwesen
- 4.1. Eigenschaften und Merkmale des deutschen Bankwesens
- 4.2. Definition und Eigenschaften von Bankdienstleistungen
- 4.3. Ansatzpunkte für das Service-Design im Bankwesen
- 5. Service-Qualität durch den Einsatz von Design im Bankwesen
- 5.1. Der Begriff Qualität im Bereich Bankdienstleistung
- 5.2. Der Mitarbeiter als Serviceträger
- 5.3. Service-Qualität durch Internetpräsenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Grundlagen des Service Designs und deren Anwendung im deutschen Bankwesen. Ziel ist es, die konzeptionellen Grundlagen des Service Designs darzulegen und anhand des Beispiels des Bankensektors aufzuzeigen, wie Design die Servicequalität verbessern kann.
- Definition und konzeptionelle Grundlagen des Service Designs
- Analyse verschiedener Service-Design-Ansätze
- Charakteristika des deutschen Bankwesens und seiner Dienstleistungen
- Potenziale des Service Designs zur Verbesserung der Servicequalität im Bankwesen
- Der Einfluss von Design auf die Mitarbeiter und die Kundeninteraktion im Bankensektor
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Seminararbeit ein. Es beschreibt die Problemstellung, die die Arbeit zu beantworten versucht, und skizziert den methodischen Aufbau der Untersuchung. Der Fokus liegt auf der Relevanz von Service Design für den Bankensektor und der Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der zugrundeliegenden Konzepte.
2. Konzeptionelle Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen des Service Designs dar. Es beginnt mit der Definition des Service-Begriffs und erläutert verschiedene Service-Entwicklungsansätze, wie den von Ramaswamy, ISO und Edvardsson/Olsson. Die Rolle des Designs als Grundlage für Service Design wird umfassend behandelt, inklusive einer Einführung in den Design-Begriff und seiner Abgrenzung im Dienstleistungsbereich. Der Kapitel verbindet die theoretischen Überlegungen mit dem praktischen Kontext des Bankwesens.
3. Die Phasen im Prozess des Service-Designs nach Haller: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Phasen des Service-Design-Prozesses nach Haller. Es behandelt die Ideenfindung und -bewertung, die Aufnahme der Anforderungen, die Entwicklung, Evaluation und Auswahl von Servicekonzepten, das Design der Prozesse und der materiellen Komponenten, sowie die Implementierung. Jede Phase wird im Detail erläutert und mit Beispielen illustriert, um das Verständnis des gesamten Prozesses zu verbessern.
4. Service Design im deutschen Bankwesen: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Anwendung von Service Design im Kontext des deutschen Bankwesens. Es analysiert die spezifischen Eigenschaften und Merkmale des deutschen Bankensektors und definiert die Charakteristika von Bankdienstleistungen. Darauf aufbauend werden Ansatzpunkte für das Service Design im Bankwesen identifiziert und diskutiert, wobei die Besonderheiten des Sektors berücksichtigt werden.
5. Service-Qualität durch den Einsatz von Design im Bankwesen: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Service Design auf die Qualität von Bankdienstleistungen. Der Begriff der Qualität im Bankensektor wird definiert, und die Rolle des Mitarbeiters als Serviceträger wird beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Service-Qualität durch eine optimierte Internetpräsenz, wobei die Bedeutung des Designs für die Benutzerfreundlichkeit und die Kundenbindung herausgestellt wird.
Schlüsselwörter
Service Design, Dienstleistungsmanagement, Bankwesen, Servicequalität, Design-Konzepte, Kundenorientierung, Mitarbeiter, Internetpräsenz, Prozessdesign, Innovation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Service Design im deutschen Bankwesen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Grundlagen des Service Designs und deren Anwendung im deutschen Bankwesen. Das Hauptziel ist es, die konzeptionellen Grundlagen des Service Designs darzulegen und anhand des Beispiels des Bankensektors aufzuzeigen, wie Design die Servicequalität verbessern kann.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und konzeptionelle Grundlagen des Service Designs, Analyse verschiedener Service-Design-Ansätze (u.a. Ramaswamy, ISO, Edvardsson/Olsson), Charakteristika des deutschen Bankwesens und seiner Dienstleistungen, Potenziale des Service Designs zur Verbesserung der Servicequalität im Bankwesen, sowie den Einfluss von Design auf die Mitarbeiter und die Kundeninteraktion im Bankensektor.
Welche Phasen des Service-Design-Prozesses nach Haller werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Phasen des Service-Design-Prozesses nach Haller: Ideenfindung und -bewertung, Aufnahme der Anforderungen, Entwicklung, Evaluation und Auswahl von Servicekonzepten, Design der Prozesse und der materiellen Komponenten sowie die Implementierung. Jede Phase wird im Detail erläutert und mit Beispielen illustriert.
Wie wird die Service-Qualität im Bankwesen durch den Einsatz von Design verbessert?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Service Design auf die Qualität von Bankdienstleistungen. Es wird die Rolle des Mitarbeiters als Serviceträger beleuchtet und die Bedeutung einer optimierten Internetpräsenz für die Benutzerfreundlichkeit und Kundenbindung hervorgehoben. Der Begriff der Qualität im Bankensektor wird ebenfalls definiert.
Welche konzeptionellen Grundlagen des Service Designs werden erläutert?
Die Arbeit erläutert die Definition des Service-Begriffs und verschiedene Service-Entwicklungsansätze. Die Rolle des Designs als Grundlage für Service Design wird umfassend behandelt, inklusive einer Einführung in den Design-Begriff und seiner Abgrenzung im Dienstleistungsbereich. Die theoretischen Überlegungen werden mit dem praktischen Kontext des Bankwesens verbunden.
Welche spezifischen Eigenschaften des deutschen Bankwesens werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die spezifischen Eigenschaften und Merkmale des deutschen Bankensektors und definiert die Charakteristika von Bankdienstleistungen. Darauf aufbauend werden Ansatzpunkte für das Service Design im Bankwesen identifiziert und diskutiert, wobei die Besonderheiten des Sektors berücksichtigt werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Service Design, Dienstleistungsmanagement, Bankwesen, Servicequalität, Design-Konzepte, Kundenorientierung, Mitarbeiter, Internetpräsenz, Prozessdesign, Innovation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einführung, Konzeptionelle Grundlagen, Die Phasen im Prozess des Service-Designs nach Haller, Service Design im deutschen Bankwesen und Service-Qualität durch den Einsatz von Design im Bankwesen. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung erläutert.
- Quote paper
- Niels Michael Berg (Author), 2005, Service Design - Grundlagen und das Beispiel Bankwesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90603