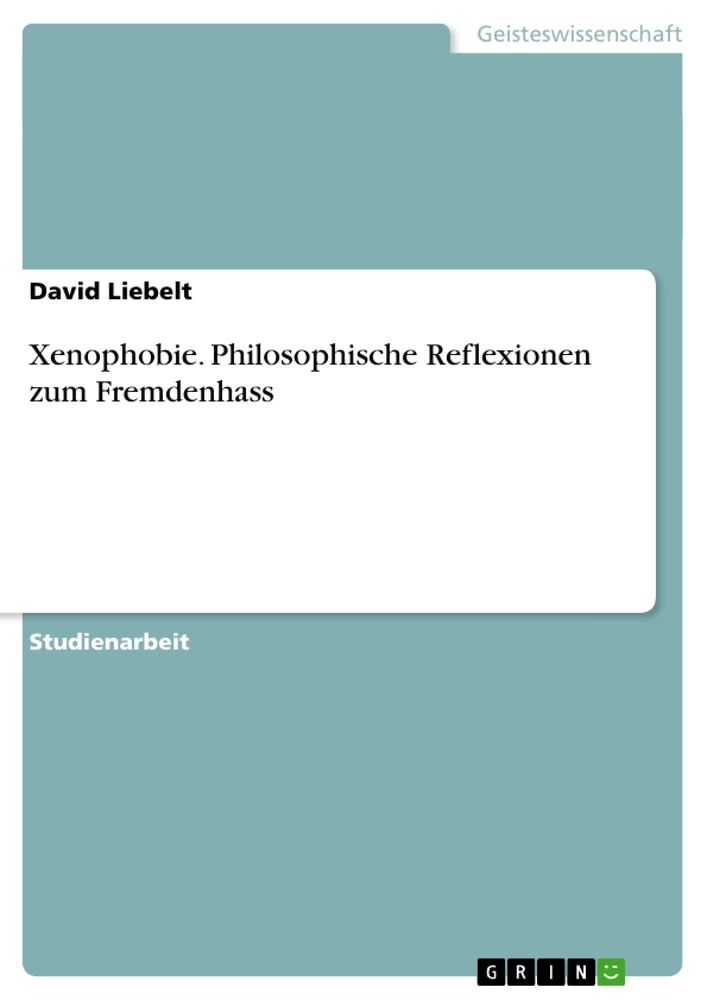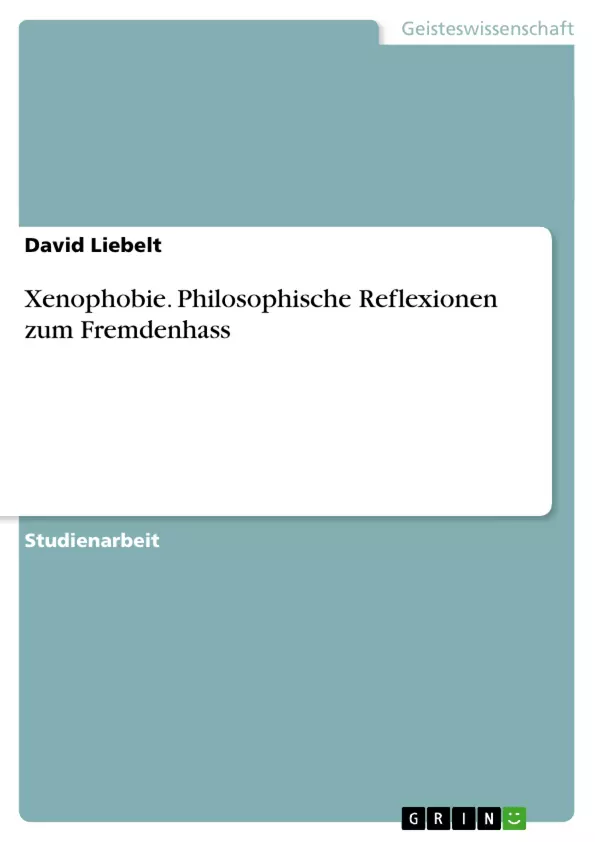Die von mir zu dem Thema „Fremdenangst, Fremdenhass“ behandelte Literatur sowie Reflexionen über das eigene und das von Mitmenschen erlebte Verhalten, haben mich dazu veranlaßt folgende These aufzustellen: Obwohl wir täglich mit verschiedenen Formen von „Fremdheit“ konfrontiert sind, kommt es zu keinem „richtigen Kontakt“ im Sinne von „Sich- Miteinander -Auseinandersetzen“. Dieser „richtige Kontakt“ wird vermieden, weil „der Fremde“ in uns „Angst“ bzw. Unbehagen auslöst.
Kontakthypothese
Die Kontakthypothese besagt, dass Menschen mit weniger „Kontakt“ zu „Fremden“ mehr Vorurteile gegenüber diesen haben. Eine Studie von Klaus Ahlheim und Bardo Heger kann dies unterstützen. So haben sie festgestellt, dass fremdenfeindliche Einstellungen gerade da besonders hoch sind, wo der Anteil der „Ausländer“ nur 2% der Bevölkerung ausmacht (Nick 2002: 32). Auch die Shell-Studie: Jugend 2000 zeigt auf, dass fremdenfeindliche Einstellungen nicht rational oder aufgrund konkreter Erfahrungen erklärbar sind, vielmehr lägen diesen sozialpsychologische Dynamiken zugrunde. Als ein Ergebnis der Studie soll hier erwähnt werden, dass das Vorurteil, Ausländer nähmen uns die Arbeitsplätze weg, gerade bei Gruppe der Befragten, die dem „Konkurrenzkampf gar nicht mehr selbst ausgesetzt sind: die Gruppe der über 75jährigen (Ahlheim und Heger in Nick 2002: 33)“ besonders verbreitet ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kontakthypothese
- Warum löst „der Fremde“ Angst aus?
- Soziopsychologischer Erklärungsansatz
- Exkurs: In welchem Sinn wird hier „der Fremde“ bzw. „Fremdheit“ benutzt?
- Ethnopsychologischer Erklärungsansatz: Der Fremde als Projektionsfläche
- Faszination und Staunen
- Strategien im Umgang mit „alltäglicher Fremdheit“
- Konstruktionscharakter von „Fremd“ bzw. „Fremdheit“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen von Fremdenangst und -hass. Die zentrale These ist, dass trotz täglicher Konfrontation mit „Fremdheit“, ein echter Austausch vermieden wird, da „der Fremde“ Angst und Unbehagen auslöst. Die Arbeit analysiert verschiedene soziopsychologische und ethnopsychologische Erklärungsansätze.
- Die Kontakthypothese und ihre Grenzen
- Soziopsychologische Erklärungen von Fremdenangst anhand des Konzepts der Relevanzsysteme
- Der Fremde als Projektionsfläche für unbewusste Ängste und Wünsche
- Die Ambivalenz der Begegnung mit dem Fremden: Angst und Faszination
- Der Konstruktionscharakter von „Fremdheit“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor: Trotz täglicher Begegnungen mit Fremdheit kommt es selten zu einem echten Austausch, da der Fremde Angst und Unbehagen auslöst. Diese These wird im weiteren Verlauf der Arbeit anhand verschiedener theoretischer Ansätze untersucht und belegt.
Kontakthypothese: Dieses Kapitel präsentiert die Kontakthypothese, die besagt, dass weniger Kontakt zu Fremden mit mehr Vorurteilen einhergeht. Es werden empirische Studien (Ahlheim & Heger, Shell-Studie Jugend 2000) herangezogen, die diese Hypothese teilweise stützen, aber auch auf die komplexen sozialpsychologischen Dynamiken hinweisen, die fremdenfeindlichen Einstellungen zugrunde liegen. Der Fokus liegt auf der Einschränkung der Hypothese, dass fremdenfeindliche Einstellungen nicht allein auf rationale Erwägungen oder konkrete Erfahrungen zurückzuführen sind.
Warum löst „der Fremde“ Angst aus?: Dieses Kapitel befasst sich mit soziopsychologischen und ethnopsychologischen Erklärungsansätzen für Fremdenangst. Der soziopsychologische Ansatz nach Alfred Schütz betont den Unterschied in den Relevanzsystemen zwischen dem Fremden und den Mitgliedern der einheimischen Gruppe. Die Konfrontation mit diesen unterschiedlichen Systemen führt zu einer Krise des „Denkens-wie-üblich“ und löst Angst aus. Der Fremde wird als potenzielle Bedrohung der eigenen Identität wahrgenommen, da er bestehende Normen und Gewohnheiten in Frage stellt. Der ethnopsychologische Ansatz betrachtet den Fremden als Projektionsfläche für eigene Ängste und unerwünschte Eigenschaften. Diese Projektion dient der Aufrechterhaltung der individuellen und gruppalen Integrität.
Faszination und Staunen: Dieses Kapitel beleuchtet die ambivalente Natur der Begegnung mit dem Fremden. Neben Angst und Unbehagen löst der Fremde auch Faszination und Staunen aus. Die Überwindung der Angst erfordert die Auseinandersetzung mit dieser Faszination. Erdheim argumentiert, dass der Kontakt mit dem Fremden für die Weiterentwicklung des Individuums und der Kultur unerlässlich ist. Kultur entsteht nach Erdheim erst in der Auseinandersetzung mit dem Fremden und ist das Produkt der Veränderung des Eigenen durch das Fremde. Der Kontakt wird durch Institutionen wie Gastfreundschaft und Inzestverbot gesichert.
Schlüsselwörter
Fremdenangst, Fremdenhass, Kontakthypothese, Soziopsychologie, Ethnopsychologie, Relevanzsysteme, Projektion, Identität, Kultur, Assimilation, Fremdheit, kulturelle Unterschiede, Interaktion, Angst, Faszination, Konstruktionscharakter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Fremdenangst
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Ursachen von Fremdenangst und -hass. Die zentrale These lautet: Trotz täglicher Begegnungen mit „Fremdheit“ wird ein echter Austausch vermieden, da „der Fremde“ Angst und Unbehagen auslöst. Verschiedene soziopsychologische und ethnopsychologische Erklärungsansätze werden analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Kontakthypothese, Warum löst „der Fremde“ Angst aus?, Faszination und Staunen, Strategien im Umgang mit „alltäglicher Fremdheit“ und Konstruktionscharakter von „Fremd“ bzw. „Fremdheit“.
Was ist die Kontakthypothese und wie wird sie in der Arbeit behandelt?
Die Kontakthypothese besagt, dass weniger Kontakt zu Fremden mit mehr Vorurteilen einhergeht. Die Arbeit präsentiert empirische Studien, die diese Hypothese teilweise stützen, aber auch auf die komplexen sozialpsychologischen Dynamiken hinweisen, die fremdenfeindlichen Einstellungen zugrunde liegen. Die Einschränkung der Hypothese, dass fremdenfeindliche Einstellungen nicht allein auf rationale Erwägungen oder konkrete Erfahrungen zurückzuführen sind, wird hervorgehoben.
Welche soziopsychologischen und ethnopsychologischen Erklärungsansätze werden vorgestellt?
Der soziopsychologische Ansatz betont den Unterschied in den Relevanzsystemen zwischen dem Fremden und Einheimischen. Die Konfrontation mit diesen unterschiedlichen Systemen löst Angst aus, da der Fremde als potenzielle Bedrohung der eigenen Identität wahrgenommen wird. Der ethnopsychologische Ansatz betrachtet den Fremden als Projektionsfläche für eigene Ängste und unerwünschte Eigenschaften.
Wie wird die Ambivalenz der Begegnung mit dem Fremden dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet die ambivalente Natur der Begegnung mit dem Fremden: Neben Angst und Unbehagen löst er auch Faszination und Staunen aus. Die Überwindung der Angst erfordert die Auseinandersetzung mit dieser Faszination. Erdheims Argument, dass der Kontakt mit dem Fremden für die Weiterentwicklung des Individuums und der Kultur unerlässlich ist, wird vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fremdenangst, Fremdenhass, Kontakthypothese, Soziopsychologie, Ethnopsychologie, Relevanzsysteme, Projektion, Identität, Kultur, Assimilation, Fremdheit, kulturelle Unterschiede, Interaktion, Angst, Faszination, Konstruktionscharakter.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Ursachen von Fremdenangst und -hass und analysiert verschiedene soziopsychologische und ethnopsychologische Erklärungsansätze. Sie beleuchtet die Ambivalenz der Begegnung mit dem Fremden (Angst und Faszination) und den Konstruktionscharakter von „Fremdheit“.
- Quote paper
- David Liebelt (Author), 2005, Xenophobie. Philosophische Reflexionen zum Fremdenhass, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90645