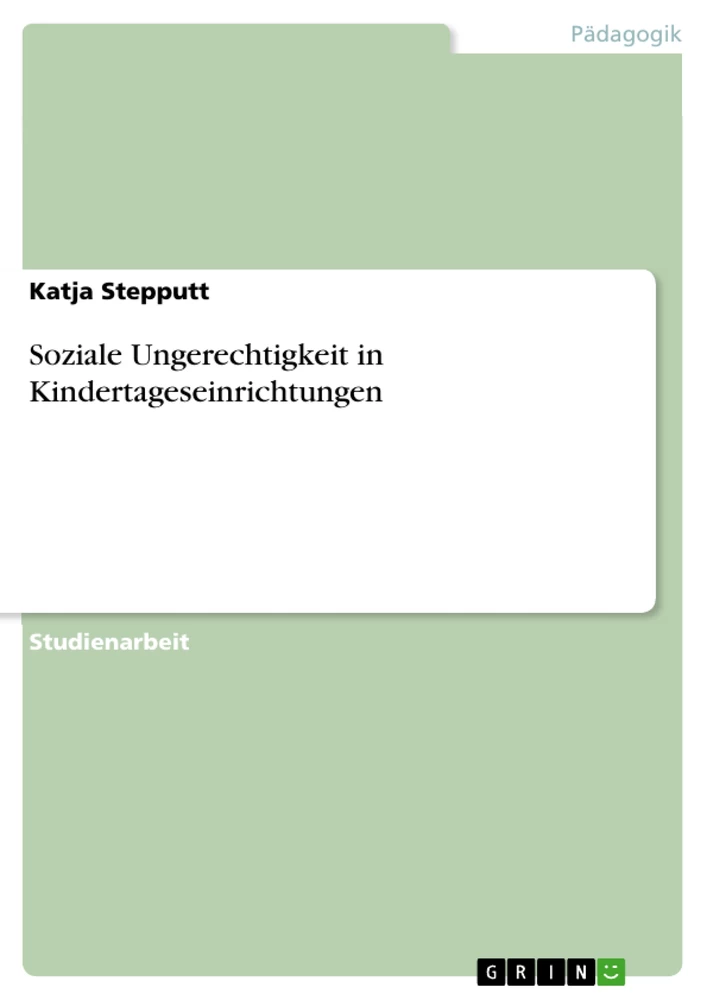Das Anliegen dieser Arbeit ist, systematisch herauszuarbeiten, ob der Kindergarten als außerschulische Einrichtung sozialer Ungleichheit entgegenwirken kann und dadurch Chancengleichheit verspricht, oder ob er als erste Bildungsinstanz Chancenungleichheit von Beginn an fördert.
Den Anfang dieser Arbeit bildet eine theoretische Betrachtungsweise. Hierzu wird auf Bourdieu und seine Habitustheorie verwiesen. In dieser wird der Mensch als ein gesellschaftlich geprägter Akteur gesehen. Darüber hinaus wird in dieser Arbeit mit einem an Bourdieu angelehntes Milieukonzept gearbeitet, das Menschen gruppiert, die sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise ähneln.
Vor dem Hintergrund der Debatte um die Bedeutung vorschulischer Bildungseinrichtungen wird in dieser Arbeit eine Analyse zum selektiven Zugang zum Kindergarten vorgenommen. Hierzu werden die Daten des sozioökonomischen Panels (SOEP) im Hinblick auf soziale Ungleichheit des Besuches einer Kindertageseinrichtung auf drei Ebenen untersucht. Darauf aufbauend wird im weiteren Verlauf der Arbeit die Rolle des Kindergartens im Hinblick auf Chancengleichheit aber auch auf Chancenungleichheit diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Soziale Ungleichheit in Kindertageseinrichtungen
- Struktur und Finanzierung
- Besuchsquote und deren Entwicklung
- Soziale Herkunft
- Schlussfolgerungen
- Chancengleichheit oder Chancenungleichheit?
- Thematisierung von Chancengleichheit
- Thematisierung von Chancenungleichheit
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen sozialer Ungleichheit auf den Zugang zu Kindertageseinrichtungen und beleuchtet, ob der Kindergarten als Bildungsinstitution Chancengleichheit fördern oder Chancenungleichheit verstärken kann.
- Analyse des selektiven Zugangs zum Kindergarten anhand von Daten des sozio-ökonomischen Panels (SOEP)
- Betrachtung der Struktur und Finanzierung von Kindertageseinrichtungen
- Untersuchung der Besuchsquote und deren Entwicklung
- Einfluss der sozialen Herkunft auf den Zugang zum Kindergarten
- Diskussion der Rolle des Kindergartens im Hinblick auf Chancengleichheit und Chancenungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Forschungsfrage: Kann der Kindergarten soziale Ungleichheit entgegenwirken und Chancengleichheit ermöglichen, oder verstärkt er Chancenungleichheit von Beginn an?
Theoretischer Hintergrund
Dieses Kapitel behandelt den theoretischen Ansatz der Arbeit, insbesondere die Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu. Es wird erläutert, wie die Theorie die Bedeutung sozialer Milieus und die Rolle von Kapitalien im Hinblick auf Bildungsentscheidungen verdeutlicht.
Soziale Ungleichheit in Kindertageseinrichtungen
Dieses Kapitel analysiert den selektiven Zugang zum Kindergarten unter dem Aspekt der sozialen Ungleichheit. Es werden die Struktur und Finanzierung von Kindertageseinrichtungen, die Besuchsquote und deren Entwicklung sowie der Einfluss der sozialen Herkunft auf den Zugang zum Kindergarten untersucht.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Kindertageseinrichtungen, Bildung, Chancengleichheit, Chancenungleichheit, Habitus, Kapital, soziale Herkunft, Struktur, Finanzierung, Besuchsquote, sozio-ökonomisches Panel (SOEP).
- Quote paper
- Katja Stepputt (Author), 2016, Soziale Ungerechtigkeit in Kindertageseinrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/906636