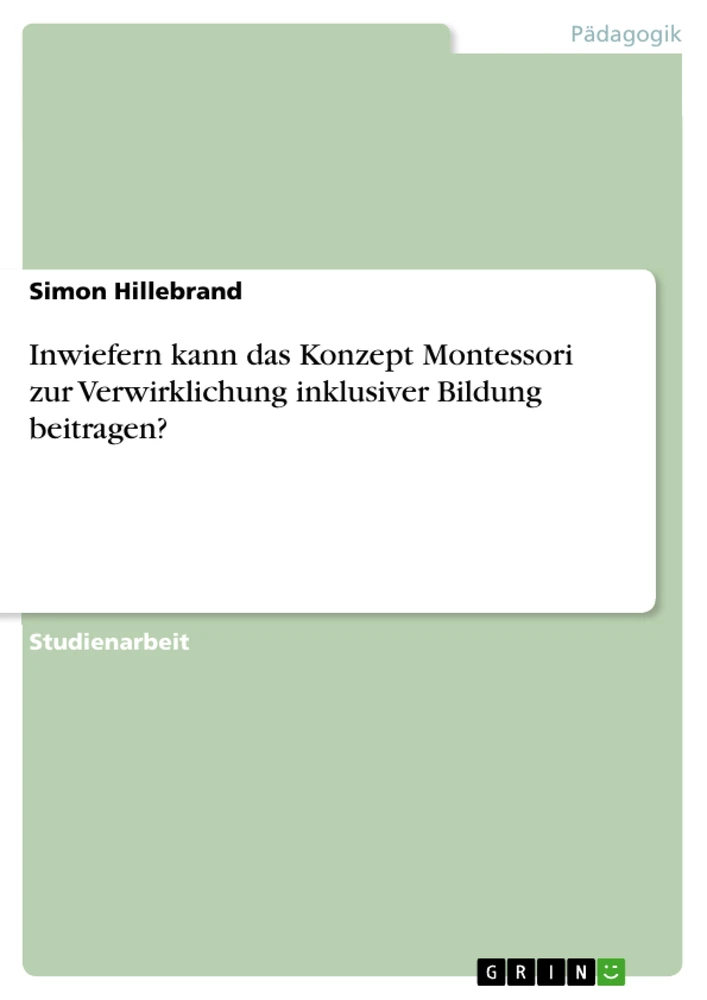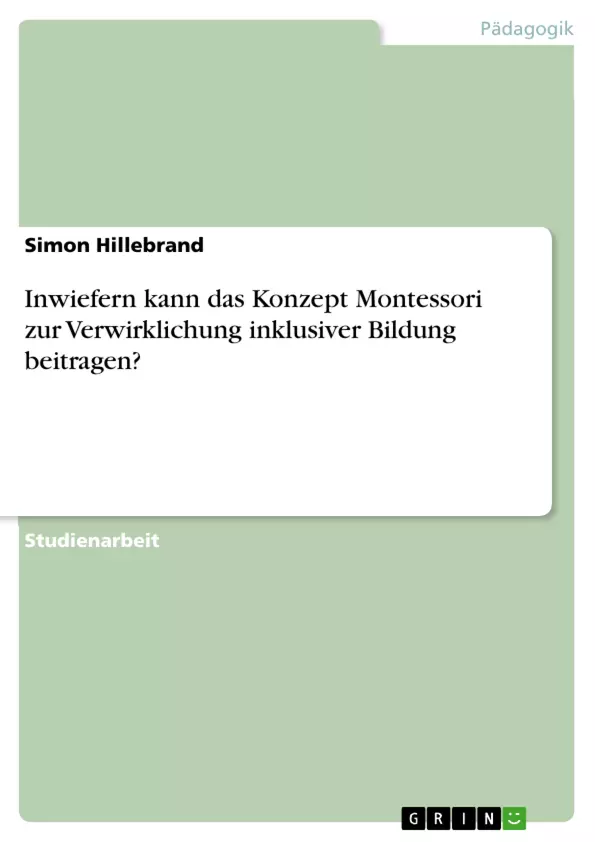Diese Arbeit thematisiert die Grundzüge der Montessori-Pädagogik und ihrer Didaktik. In Hinblick auf die Fragestellung wird in Abschnitt 2 die ‚Entstehungsgeschichte‘ der Inklusion dargestellt, ein Definitionsversuch für den Begriff Inklusion unternommen sowie die Differenz zwischen Integration und Inklusion erläutert. Dieser Abschnitt legt zudem den rechtlichen und bildungspolitischen Grundstein der Arbeit.
Darauffolgend wird in Abschnitt 3 und dessen Unterpunkte auf das Konzept Montessori eingegangen und die acht Prinzipien dieses Konzept thematisiert. Welcher Gedanke steckt hinter Montessoris Vorstellung von Pädagogik? Unterscheidet sich dieses Konzept von dem der Regelschule? Diese und weitere Fragen werden diskutiert und beantwortet. Nachdem ein Einblick in das Konzept Montessori gegeben wurde, ist es möglich auf die Fragestellung dieser Arbeit einzugehen. In Abschnitt 4 werden ausgewählte Aspekte der Montessori dahingehend untersucht, inwiefern diese zur Verwirklichung inklusiver Bildung beitragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Inklusion?
- Die Montessori-Pädagogik
- Die Prinzipien der Montessori-Pädagogik
- Montessoris sensible Phasen und ihre Drei-Alters-Gruppen
- Zur Didaktik der Montessori-Pädagogik
- Wie inklusiv ist das Konzept Montessori?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der Montessori-Pädagogik im Hinblick auf seine Fähigkeit, zur Verwirklichung inklusiver Bildung beizutragen. Sie beleuchtet die Entstehung und Definition von Inklusion, analysiert die Prinzipien der Montessori-Pädagogik, untersucht die Umsetzung der Montessori-Pädagogik in der Praxis und beleuchtet schließlich deren Potenzial zur Förderung von Inklusion.
- Die Entwicklung und Definition des Begriffs Inklusion
- Die Prinzipien und Methoden der Montessori-Pädagogik
- Die Relevanz der Montessori-Pädagogik für heterogene Lerngruppen
- Die Bedeutung der Montessori-Pädagogik für die Verwirklichung inklusiver Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in die Thematik der Montessori-Pädagogik und ihre Relevanz für inklusive Bildung ein.
- Was ist Inklusion?: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Inklusion, grenzt ihn von Integration ab und erläutert die rechtlichen und bildungspolitischen Hintergründe.
- Die Montessori-Pädagogik: Dieses Kapitel präsentiert die acht Prinzipien der Montessori-Pädagogik, erklärt Montessoris Konzept der sensiblen Phasen und die Bedeutung der Drei-Alters-Gruppen. Außerdem geht es auf die Didaktik der Montessori-Pädagogik ein.
Schlüsselwörter
Inklusion, Montessori-Pädagogik, Heterogenität, Integration, Didaktik, Sensible Phasen, Drei-Alters-Gruppen, Bildungspolitik, Bildungsgerechtigkeit, inklusive Bildung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Integration gliedert Menschen ein, während Inklusion die Verschiedenheit als Normalität betrachtet und das System an alle anpasst.
Wie unterstützt Montessori-Pädagogik inklusive Bildung?
Durch individuelle Lernwege, Freiarbeit und altersgemischte Gruppen (Drei-Alters-Gruppen) wird Heterogenität produktiv genutzt.
Was sind die „sensiblen Phasen“?
Zeitspannen in der Entwicklung eines Kindes, in denen es besonders empfänglich für den Erwerb bestimmter Fähigkeiten ist.
Welche Rolle spielt das Material in der Montessori-Didaktik?
Das Material hat Aufforderungscharakter und ermöglicht Selbstkontrolle, was die Eigenständigkeit fördert.
Unterscheidet sich Montessori von der Regelschule?
Ja, vor allem durch den Fokus auf die Selbstbestimmung des Kindes („Hilf mir, es selbst zu tun“) statt auf frontale Wissensvermittlung.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Simon Hillebrand (Autor:in), 2020, Inwiefern kann das Konzept Montessori zur Verwirklichung inklusiver Bildung beitragen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/907169