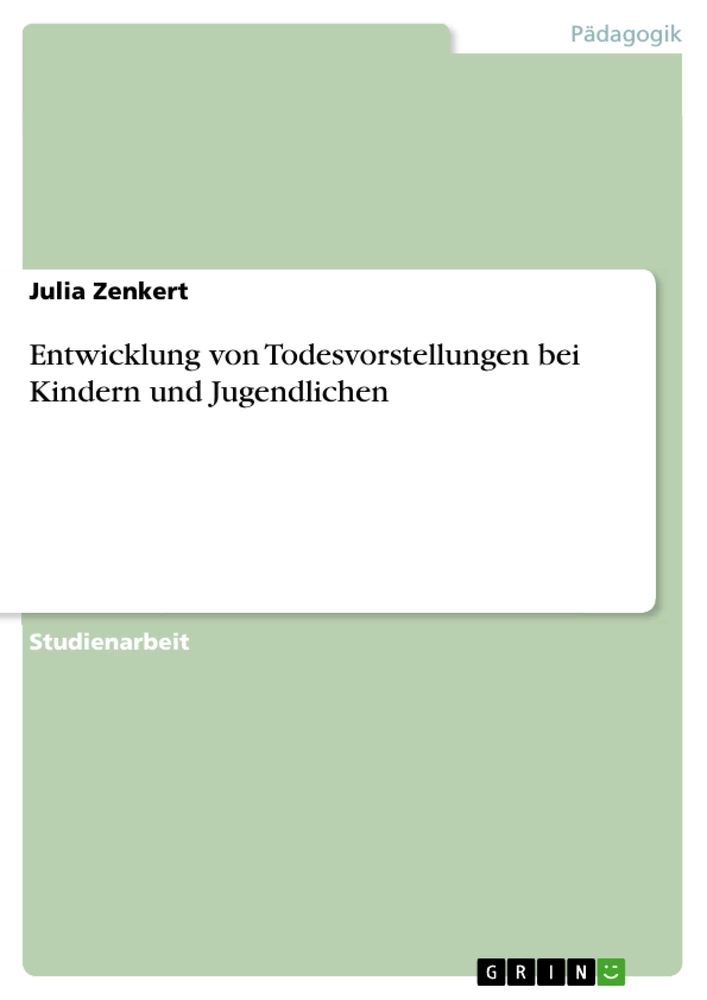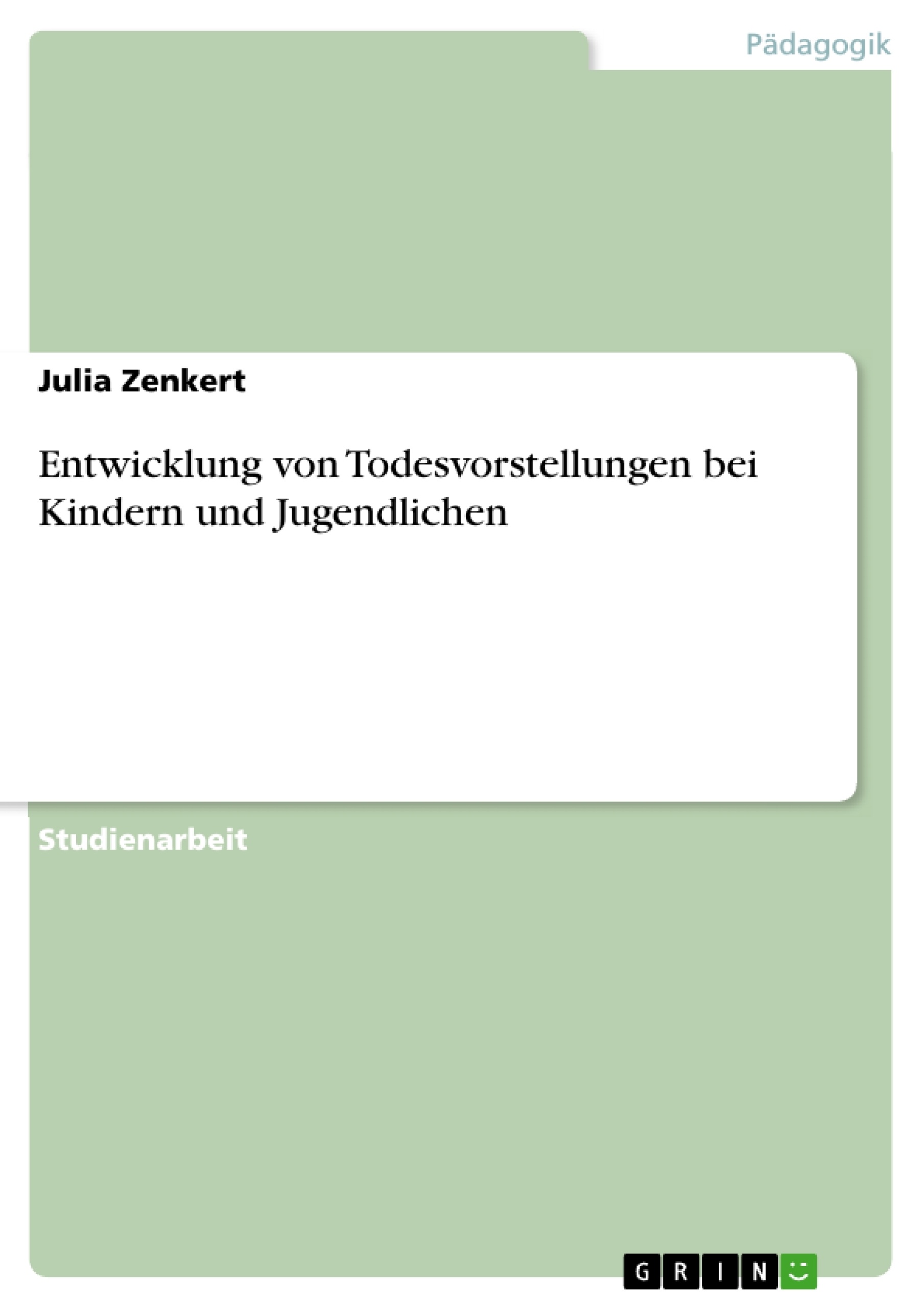„Da unten soll Rune jetzt wirklich liegen?
Sara muß [sic!] unbedingt etwas fragen:
`Aber was ist wenn er nun mal aufwacht
und aufstehen will und er kriegt den Deckel vom Sarg nicht auf?´
´Rune wacht nicht mehr auf`, antwortet Papa leise
´Er schläft für immer.`“
(Marit Kaldhol, Abschied von Rune, 1991)
Abschied nehmen, weil der beste Freund beim gemeinsamen Spiel am Wasser ertrunken ist.
Marit Kaldhol beschreibt in ihrem Kinderbuch „Abschied von Rune“ genau dieses schwierige und schmerzhafte Erlebnis, dass die kleine Sara (ca. 5-6 Jahre) in ihrem noch so jungen Leben schon bewältigen soll.
Wie unterschiedlich jedoch die Todesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen sein können, sollen auch die folgenden Aussagen beweisen:
„Die Toten schließen die Augen, weil Sand hineingefallen ist.“
(3 Jahre, 11 Monate)
„Wenn ich ins Grab falle, denke ich, dass ich in Tausend Fetzen zerfalle.“
(9 Jahre)
„Ich stelle mir vor, dass, wenn ich tot bin, ich bei Gott wieder aufwache.“
(9 Jahre)
Einige von diesen „Kinderstimmen“ lassen sehr gut die Faktoren erkennen, die die Vorstellung vom Tod beeinflussen.
Im Anschluss werde ich mich mit den altersabhängigen Todesvorstellungen auseinandersetzen.
Es geht hier nicht über den tatsächlichen biologischen Ablauf des Sterbeprozesses, sondern über ihre Vorstellungen und Empfindungen, mit denen sie den Begriff „Tod“ mit Inhalt füllen.
Nachdem ich mich nun allgemein mit dem Tod beschäftigt habe, werde ich mich danach den Todesvorstellungen in bezug auf Kinder und Jugendliche mit einer lebensbedrohenden Krankheit widmen und Chancen und Möglichkeiten aufzeigen, wie man Kinder bzw. Jugendliche auf den Tod vorbereiten bzw. mit dem Tod selbst umgehen kann bzw. sollte. Nach Buckingham gibt es verschiedene Faktoren, die die Todesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen beeinflussen können, die ich im Folgenden aufzeigen möchte. Wohl der wichtigste Faktor, der ein Kind bzw. einen Jugendlichen im Hinblick auf die Todesvorstellung beeinflussen kann, sind die Eltern oder aber auch die Umgebung.
Um Kinder bzw. Jugendliche zu unterstützen, ihnen in einer solchen Situation beizustehen, ist es von größter Bedeutung, dass sich die Eltern bzw. Erwachsenen selbst mit dem Tod auseinandersetzen – sie müssen selbst trauern können!
Sie müssen ihre eigenen Gefühle wahrnehmen und vor allem auch dem Kind gegenüber zeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Einflussfaktoren auf die Todesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen
- Einstellungen der Eltern bzw. Umgebung zum Tod
- Medien (TV/ Internet....)
- Beziehungen der Kinder zum Objektverlust
- Stufe der psychologischen Entwicklung
- Umstände des Verlusts
- Frühere Erfahrungen mit dem Tod
- Religiöse Vorstellungen
- Todesvorstellungen bei Kindern und Jugendlichen
- Das Kleinkind (0 – 3 Jahre)
- Das Vorschulkind (3 - 6 Jahre)
- Das Grundschulkind ( 6 – 9 Jahre)
- Das Schulkind ( 9 – 12 Jahre)
- Der Jugendliche ( ab 12 Jahre)
- Progredient kranke Kinder und Jugendliche
- Begriffserklärung
- Todesvorstellungen bei progredient kranken Kindern und Jugendlichen
- Umgang mit und Vorbereitung auf den Tod
- Das Recht des Kindes auf Wahrheit
- Das Recht des Kindes auf Leben
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung der Todesvorstellungen bei Kindern und Jugendlichen und untersucht dabei die unterschiedlichen Einflussfaktoren, die diese Vorstellungen prägen können. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die besondere Situation von Kindern und Jugendlichen mit einer lebensbedrohlichen Krankheit und analysiert den Umgang mit dem Tod in diesem Kontext.
- Einflussfaktoren auf die Todesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen
- Entwicklung der Todesvorstellungen in verschiedenen Altersstufen
- Spezifische Todesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen mit lebensbedrohlicher Krankheit
- Umgang mit und Vorbereitung auf den Tod im Kontext der Krankheit
- Recht des Kindes auf Wahrheit und Leben
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung präsentiert verschiedene „Kinderstimmen“ als Ausgangspunkt für die Analyse der Todesvorstellungen bei Kindern und Jugendlichen. Sie stellt die Bedeutung der individuellen Vorstellung vom Tod und die Relevanz des Themas heraus.
- Einflussfaktoren auf die Todesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Faktoren, die die Todesvorstellungen von Kindern und Jugendlichen beeinflussen können, darunter die Einstellungen der Eltern und der Umgebung, Medien, Beziehungen zum Objektverlust, die Stufe der psychologischen Entwicklung, die Umstände des Verlusts, frühere Erfahrungen mit dem Tod und religiöse Vorstellungen.
- Todesvorstellungen bei Kindern und Jugendlichen: Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Todesvorstellungen in verschiedenen Altersstufen, angefangen vom Kleinkind bis hin zum Jugendlichen, und zeichnet ein Bild der sich verändernden Wahrnehmung und Interpretation des Todes.
- Progredient kranke Kinder und Jugendliche: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die besondere Situation von Kindern und Jugendlichen mit einer lebensbedrohlichen Krankheit. Es erklärt den Begriff der progredienten Krankheit und betrachtet die spezifischen Todesvorstellungen in diesem Kontext. Außerdem werden Möglichkeiten und Chancen aufgezeigt, wie man Kinder und Jugendliche auf den Tod vorbereiten und mit dem Tod selbst umgehen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Todesvorstellungen, Kinder, Jugendliche, Einflussfaktoren, psychologische Entwicklung, Medien, Verlust, Krankheit, Umgang mit dem Tod, Recht auf Wahrheit, Recht auf Leben und Vorbereitung auf den Tod.
- Arbeit zitieren
- Julia Zenkert (Autor:in), 2008, Entwicklung von Todesvorstellungen bei Kindern und Jugendlichen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90718