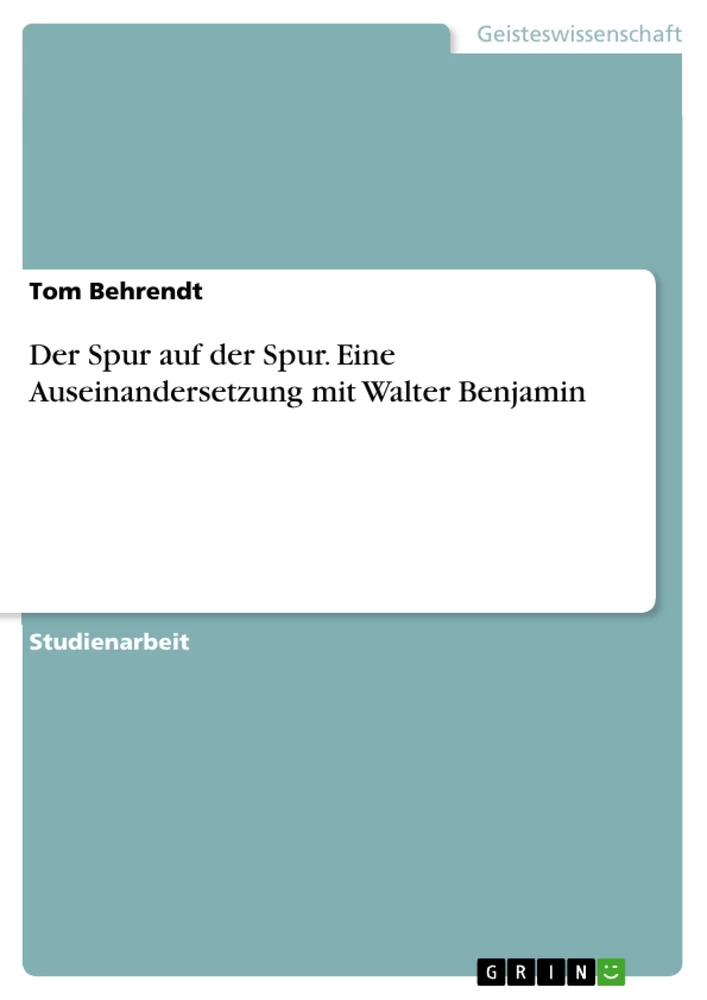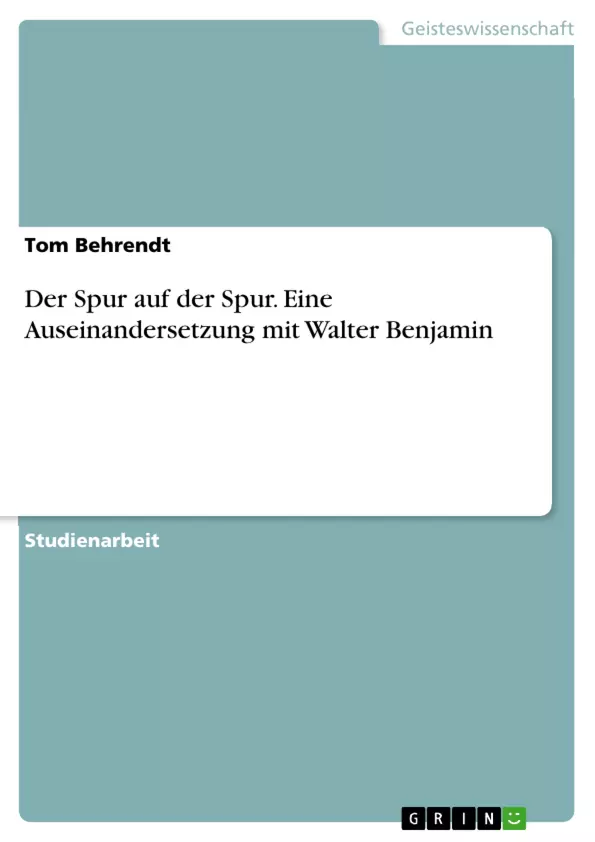Der Spur auf der Spur sein – das bedeutet zunächst eine Extrapolation vornehmen. Wir wollen nicht nur in Nippsachen, Deckchen und Transparenten Spuren lesen, sondern auch andere alltägliche Dinge in den Blick nehmen. Nicht nur das 19. Jahrhundert hinterlässt spuren. Wenn Benjamin über Bücher, Tische, Tassen oder Teppiche spricht, scheinen auch diese Dinge die Fähigkeit zu besitzen Spuren zu speichern.
Es stellt sich daher zunächst die Aufgabe die Struktur der Spur zu entschlüsseln. Im Anschluss daran werden wir jene Texte, in denen wir diese Struktur der Spur zugrunde legen können, in eine Ordnung bringen. Diese Ordnung soll uns helfen folgende Frage zu beantworten: Was sagen uns die Spuren, die Benjamin in den Dingen entdeckt? Die Hypothese lautet zweierlei: dass erstens die Bedeutung der Spuren darin liegt, dass sie die enge Verbundenheit zwischen Mensch und Ding sichtbar machen; und dass zweitens in dieser Subjekt-Objekt-Relation die Idee von Identität, Sozialität und Kultur beheimatet ist. Wir müssen daran anknüpfend auch die Frage versuchen zu beantworten, warum für Benjamin die Relevanz besteht diese Spuren in den Blick zu nehmen; und auch, ob wir heute immer noch davon sprechen können, dass sich die gesellschaftlichen Konzepte von Identität und Sozialität oder überhaupt von Kultur, als Schnittstelle von Spuren zwischen Menschen und Dingen etablieren. Wir werden sehen, dass sich Spuren zwar immer noch in dieser Schnittstelle abzeichnen, aber die vernetzte, digitale Welt, als neuer Spurenträger ins Auge gefasst werden muss. Benjamins Prognose über den Verfall der Spuren durch die Moderne, bekommt unter dem Licht der digitalen Welt, eine neue Stoßrichtung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist eine Spur?
- Wo kommen Spuren vor?
- Ordnung der Textstellen
- Identität
- Sozialität
- Erinnerung
- Das Ge-wohn-te
- Digitale Spuren
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Walter Benjamins Theorie der Spur und analysiert ihre Relevanz für das Verständnis von Identität, Sozialität und Kultur im Kontext der Moderne. Benjamin sieht in alltäglichen Dingen wie Möbeln, Tassen oder Büchern Spuren der menschlichen Existenz, die die enge Verbundenheit zwischen Mensch und Ding aufzeigen.
- Die Struktur und Funktionsweise der Spur
- Die Rolle von Spuren in der Konstitution von Identität, Sozialität und Kultur
- Der Einfluss der Moderne auf die Entstehung und Wahrnehmung von Spuren
- Die Bedeutung von Benjamins Theorie der Spur für die digitale Welt
- Die Frage nach der Bedeutung von Spuren in der Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Benjamins Theorie der Spur anhand eines Zitates vor, das die Verbindung zwischen Mensch und Ding im 19. Jahrhundert deutlich macht. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Analyse der Struktur der Spur und ihrer Bedeutung für die Konstitution von Identität, Sozialität und Kultur.
Das erste Kapitel widmet sich der Frage, was eine Spur ist und welche Eigenschaften sie besitzt. Hierbei wird die transzendente Natur der Spur hervorgehoben, die über sich selbst hinausweist und Vergangenes in der Gegenwart vergegenwärtigt.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Vorkommen von Spuren in Benjamins Texten. Es wird gezeigt, dass Benjamin sich vor allem auf Spuren in häuslichen Dingen konzentriert, die das menschliche Leben strukturieren.
Das dritte Kapitel analysiert verschiedene Textstellen aus Benjamins Werken, die sich mit der Spur befassen. Diese Textstellen werden in drei Kategorien geordnet: Identität, Sozialität und Erinnerung.
Schlüsselwörter
Walter Benjamin, Spur, Identität, Sozialität, Kultur, Moderne, Digitalisierung, Gegenstand, Ding, Vergegenwärtigung, Erinnerung, Transzendenz, Archäologie, Hermeneutik.
- Citar trabajo
- Tom Behrendt (Autor), 2019, Der Spur auf der Spur. Eine Auseinandersetzung mit Walter Benjamin, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/907480