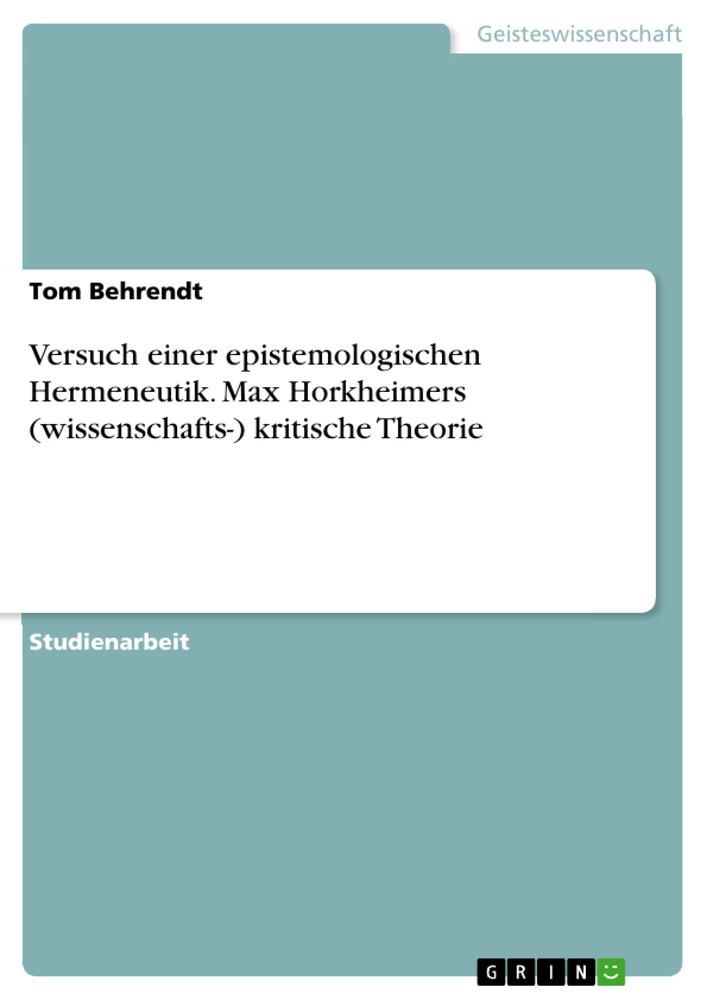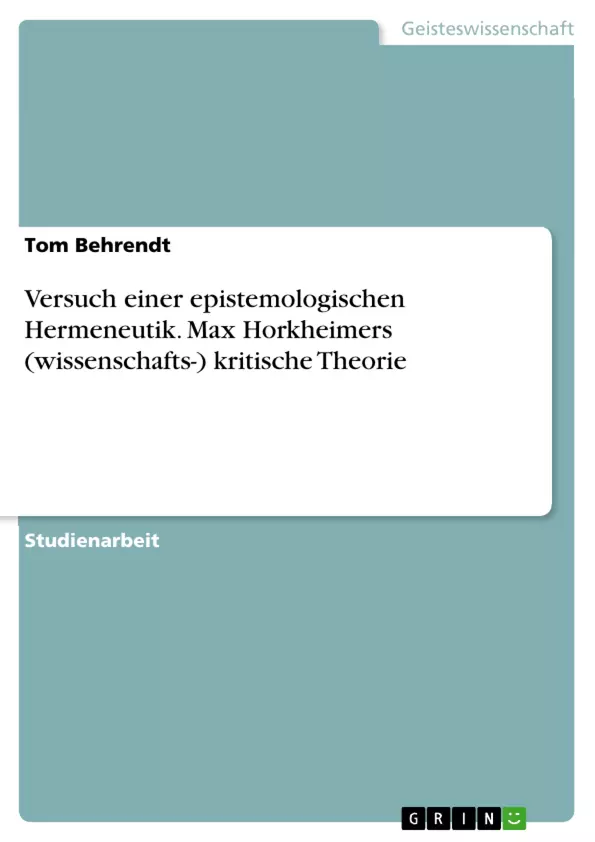Die in einer Gesellschaft verankerten sozialen Strukturen beeinflussen die Art und Weise wie Wissenschaft gelehrt und betrieben wird. Max Horkheimer geht sogar noch einen Schritt weiter. Zwischen Gesellschaft und Wissenschaft bestehe kein lineares, sondern ein dialektisches Verhältnis: Einerseits wirken gesellschaftliche Strukturen auf den Wissenschaftsbetrieb ein, jedoch erzeugen neue Entdeckungen auch neue Veränderungen innerhalb der gesellschaftlichen Struktur. Horkheimers Analyse dieser dialektischen Spannung ist als wissenschaftskritische Theorie angelegt. Denn aufgrund dieser Dialektik dienten seit dem 19. Jahrhundert wissenschaftliche Erkenntnisse nur noch einem wirtschaftlichen Apparat, weil sowohl Theorien und Methoden als auch ihre praktische Anwendungen je nur im Kontext einer ökonomischen Verwertbarkeit Verwendung fänden. Die eigentliche Aufgabe der Wissenschaft — die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse zu verbessern — scheint für Horkheimer unter diesen Umständen nicht verwirklicht werden zu können.
In Reaktion auf die wissenschaftskritischen Äußerungen Horkheimers versteht sich der erste Teil dieser Arbeit als eine Hermeneutik der dialektischen Erkenntnistheorie Horkheimers, da es keine von ihm eigens entworfene epistemologische Abhandlung gibt. Seine Ideen verstreuen sich auf diverse Texte, von denen für diese Arbeit drei analysiert wurden, die während der 1930er Jahre in der Zeitschrift für Sozialforschung erschienen und aus denen seine erkenntnistheoretischen Standpunkte interpretiert werden sollen. Im Anschluss an diese Auslegung, die begrifflich als 'epistemischer Zirkel' vorgestellt wird, versucht der zweite Teil sich an einer Revision der wissenschaftskritischen Äußerungen Horkheimers. Die These die hierbei formuliert werden soll ist, dass Horkheimers Kritik — über die Reproduktion ökonomischer Strukturen der Wissenschaft — auf ihn selbst zurückfällt. Betrachtet man die kritische (wissenschafts-) Theorie Horkheimers unter dem Standpunkt einer Denkstilgebundenheit, dann ergibt sich die Konsequenz, dass auch Horkheimer nur einen marxistischen Denkstil reproduziert und nicht über das hinauskommt, was seiner Theorie als revolutionäre Kräfte zuschreibt: die Lösung der Krise der Wissenschaft durch die richtige Theorie der Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Frühe wissenschaftskritische Theorie
- a) Wissenschaftliche Erkenntnis als epistemischer Zirkel
- II. Soziale Erkenntnis Die Verquickung von Wissenschaft und Gesellschaft
- a) Wissenschaftstheorie und Wissenssoziologie in der Zwischenkriegszeit
- b) Implikationen eines epistemischen Zirkels
- c) Rekapitulation
- III. Versuch einer Kritik
- a) Aufzeichnen, Klassifizieren, Verallgemeinern
- b) Denkstilgebundenheit
- c) Horkheimers Denkstil
- IV. Eine letzte Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der frühen wissenschaftskritischen Theorie von Max Horkheimer. Sie analysiert Horkheimers dialektische Erkenntnistheorie und beleuchtet die Spannungen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Dabei wird Horkheimers Kritik an der Reproduktion ökonomischer Strukturen innerhalb der Wissenschaft untersucht.
- Dialektische Beziehung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft
- Epistemischer Zirkel als Grundlage der Erkenntnis
- Kritik an der Verwertbarkeit von wissenschaftlicher Erkenntnis
- Denkstilgebundenheit als Limitation der Wissenschaftskritik
- Reproduktion ökonomischer Strukturen in der Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Horkheimers Grundthese vor, dass Wissenschaft und Gesellschaft in einem dialektischen Verhältnis zueinander stehen. Das erste Kapitel beleuchtet Horkheimers dialektische Erkenntnistheorie, die als epistemischer Zirkel vorgestellt wird. Das zweite Kapitel betrachtet die Verquickung von Wissenschaft und Gesellschaft im Kontext der Zwischenkriegszeit und untersucht die Implikationen eines epistemischen Zirkels. Das dritte Kapitel analysiert Horkheimers Kritik an der Wissenschaft unter dem Gesichtspunkt der Denkstilgebundenheit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Wissenschaftskritik, dialektische Erkenntnistheorie, epistemischer Zirkel, Gesellschaftskritik, Denkstilgebundenheit und die Reproduktion ökonomischer Strukturen in der Wissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Max Horkheimer unter dem dialektischen Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft?
Horkheimer argumentiert, dass gesellschaftliche Strukturen die Wissenschaft beeinflussen, während wissenschaftliche Entdeckungen wiederum die Gesellschaft verändern.
Was ist der „epistemische Zirkel“?
Der Begriff beschreibt Horkheimers Erkenntnistheorie, nach der wissenschaftliche Erkenntnis immer innerhalb der bestehenden gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen zirkuliert.
Warum kritisiert Horkheimer die moderne Wissenschaft?
Er kritisiert, dass Wissenschaft seit dem 19. Jahrhundert primär einem wirtschaftlichen Apparat dient und Erkenntnisse nur noch nach ihrer ökonomischen Verwertbarkeit beurteilt werden.
Was bedeutet „Denkstilgebundenheit“ in dieser Arbeit?
Die Arbeit hinterfragt, ob Horkheimer selbst in einem marxistischen Denkstil gefangen ist und somit nur eine bestimmte Theorie der Gesellschaft reproduziert.
Was sollte die eigentliche Aufgabe der Wissenschaft sein?
Für Horkheimer sollte die Wissenschaft dazu dienen, die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse der Menschen grundlegend zu verbessern.
- Quote paper
- Tom Behrendt (Author), 2019, Versuch einer epistemologischen Hermeneutik. Max Horkheimers (wissenschafts-) kritische Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/907482