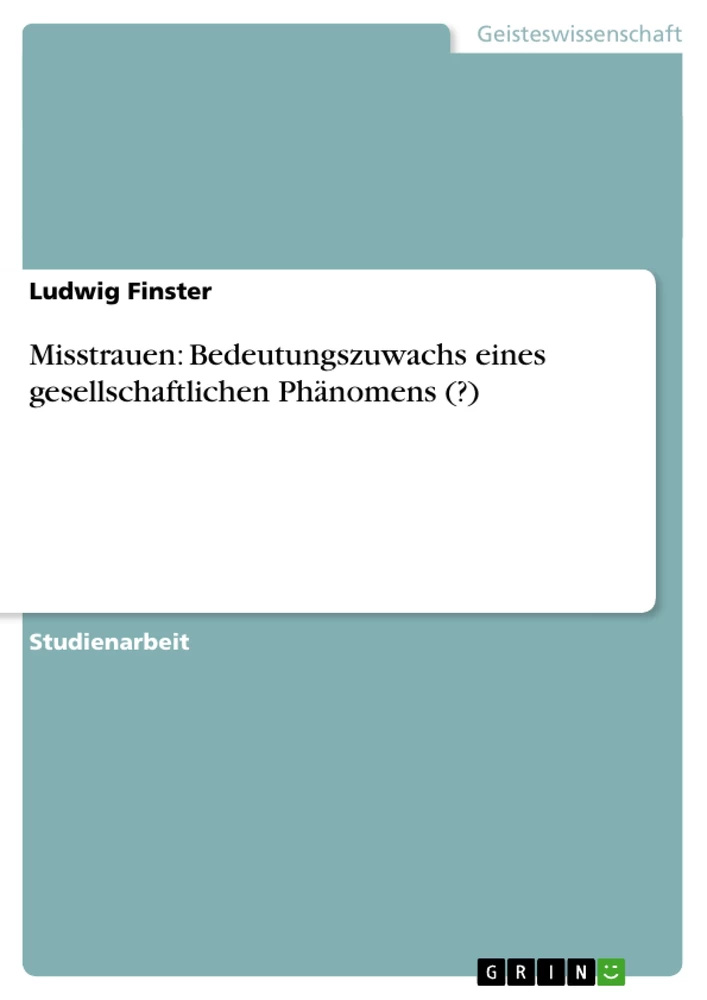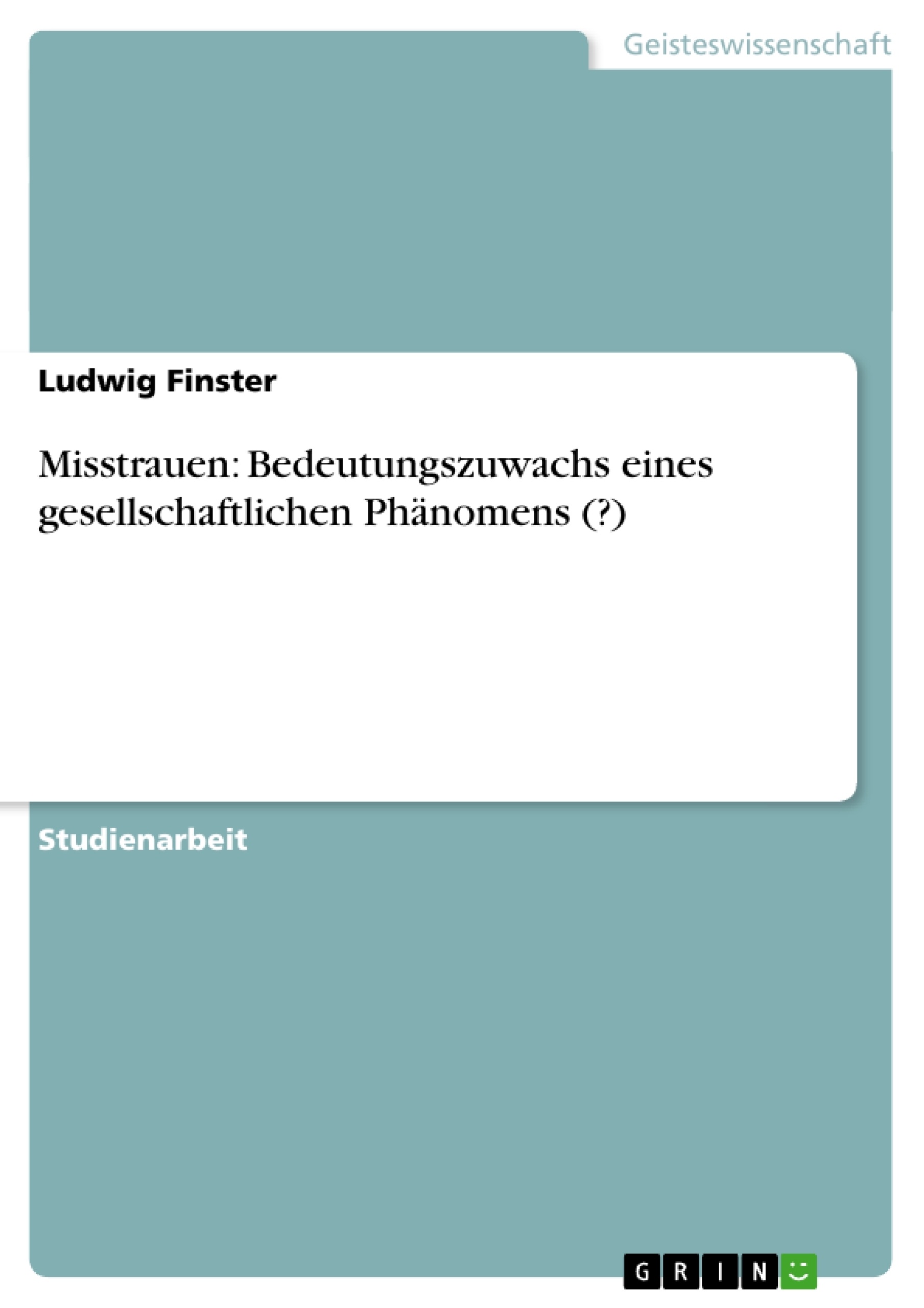Auszug aus der Einleitung: Gewerkschaftsführer, Fernsehmoderatoren, Politiker, Buchhändler, Journalisten, Offiziere und Manager in Großunternehmen – all diese Berufsstände oder Personengruppen haben, zumindest in statistischer Sichtweise, eines gemein: sie verkörpern diejenigen, die in einer für Gesamtdeutschland repräsentativen Umfrage als besonders unbeliebt auserkoren wurden.
Was dabei als eine in Zahlenwerten oder Schulnoten ausgedrückte, vermeintliche Grundstimmung der BürgerInnen oftmals nur für einen kleinen Artikel und/oder Beitrag herhalten muss und somit nicht selten nur als kleine Randnotiz wahrgenommen wird, verdient beim näheren Hinsehen und in der Einordnung in weitere Zusammenhänge jedoch deutlich mehr Beachtung. Unbeliebtheit als besonders negative Einschätzung, als eine Art „Stempel“ oder als Urteil/Beurteilung. Besonders davon betroffen dürfte hierbei die Gruppe der Politiker sein, welche offensichtlich nicht nur als Gesamtgruppe unter fehlendem Ansehen und niedriger Beliebtheit zu leiden hat, sondern durchaus und ganz besonders auch individuell persönlich in öffentlicher Beurteilung und Kritik steht. Die verschiedensten Meinungsumfragen und Stimmungsabbilder – besonders auch vor politisch wichtigen Ereignissen, wie z.B. Wahlen – zeugen davon. Besonders eindringlich an eben diesen Arten von Bürgerbefragungen sind jedoch die deutlich werdenden Tendenzen, für die es sogar einen eigenen Begriff gibt: Politikverdrossenheit. Die gezeigten Beurteilungen der Unbeliebtheit auf der einen Seite und eine deutlich spürbare Politikverdrossenheit auf der anderen, müssen – dies zumindest als kurz aufgeworfene Frage – doch auf konkreten Ursachen und/oder Gründen fußen? Das Stichwort, das sich einem an dieser Stelle aufdrängt, heißt: Misstrauen. Umfragen (wie die eben angeführte Beliebtheitsumfrage des IfD Allensbach) drücken in Zahlen das aus, was Meinungen, Stimmungen und letztlich gar Verhaltensweisen häufig genug vermuten lassen. Es ist also offensichtlich – wenn auch freilich in unterschiedlichsten Ausprägungen – ein gewisses Misstrauen gegenüber Politikern, Politik sogar im Allgemeinen, gegenüber Institutionen, aber auch eine Zurückhaltung – wenn nicht sogar eine mit weiteren Folgen verbundene Ablehnungshaltung gegenüber der Gesamtgesellschaft, also bis hin zur Infragestellung der Rechtsstaatlichkeit – beobachtbar. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Betrachtung und Klärung wichtiger Begriffe
- Einleitung und Fragestellung
- Was versteht man eigentlich unter „Vertrauen“ und „Misstrauen“?
- Misstrauen: Bedeutungszuwachs eines gesellschaftlichen Phänomens?
- Der Erklärungsansatz nach Hitzler – Kurze Darstellung der Thesen
- Wie aber kommt Hitzler zu diesem Ergebnis? – Erste Ansätze
- Wie wirkt sich nun dieses Interaktionsproblem aus?
- Wie sieht eine Gesellschaft unter diesen Vorzeichen aus?
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert den Bedeutungswandel von Misstrauen in der Gesellschaft. Sie geht der Frage nach, welche Umstände und Veränderungen zu einem Verlust des Vertrauens geführt haben und wie der Konflikt zwischen der Notwendigkeit von Vertrauen für die Demokratie und dem zunehmenden Misstrauen zu erklären ist.
- Bedeutung und Definition von Vertrauen und Misstrauen
- Der Erklärungsansatz von Hitzler zur Zunahme von Misstrauen in der Gesellschaft
- Die Auswirkungen von Misstrauen auf das Zusammenleben in der Gesellschaft
- Der Zusammenhang zwischen Misstrauen und gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen
- Der Einfluss von Misstrauen auf die Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitende Betrachtung und Klärung wichtiger Begriffe: Die Einleitung führt in das Thema Misstrauen ein und stellt die Relevanz des Begriffs in aktuellen gesellschaftlichen Diskursen heraus. Sie erläutert die Problematik des fehlenden Vertrauens in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Der Begriff „Vertrauen“ wird im Kontext der Arbeit definiert und in seiner Bedeutung für die Demokratie und das Zusammenleben der Menschen beleuchtet.
- Misstrauen: Bedeutungszuwachs eines gesellschaftlichen Phänomens?: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Erklärungsansatz von Hitzler zur Zunahme von Misstrauen in der Gesellschaft. Es stellt die Thesen von Hitzler zur Interaktionsproblematik vor und erläutert die Auswirkungen von Misstrauen auf die soziale Interaktion.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Hausarbeit sind Misstrauen, Vertrauen, gesellschaftliche Modernisierung, Individualisierung, Interaktionsproblematik, Demokratie, soziale Ordnung und Systemvertrauen. Die Arbeit untersucht die Ursachen für die Zunahme von Misstrauen in der Gesellschaft und analysiert die Auswirkungen auf das Zusammenleben, die Demokratie und das Funktionieren gesellschaftlicher Systeme.
Häufig gestellte Fragen
Warum nimmt das Misstrauen in der Gesellschaft zu?
Die Arbeit analysiert Modernisierungsprozesse und Individualisierung, die zu einer "Interaktionsproblematik" und einem Verlust an Systemvertrauen führen.
Was ist "Politikverdrossenheit"?
Ein Begriff für die ablehnende Haltung der Bürger gegenüber Politikern und politischen Institutionen, oft begründet durch tiefes Misstrauen.
Wie definiert die Arbeit "Vertrauen" und "Misstrauen"?
Vertrauen gilt als notwendige Basis für soziale Ordnung und Demokratie, während Misstrauen als Schutzreaktion oder Folge von Enttäuschungen auftritt.
Wer ist laut Umfragen besonders von Misstrauen betroffen?
Statistisch gesehen genießen Politiker, Manager in Großunternehmen und Journalisten oft besonders niedrige Beliebtheits- und Vertrauenswerte.
Welchen Erklärungsansatz liefert Hitzler?
Hitzler untersucht, wie sich die Interaktionsprobleme in einer modernen Gesellschaft auf das soziale Gefüge und das Vertrauen in den Rechtsstaat auswirken.
- Quote paper
- Ludwig Finster (Author), 2008, Misstrauen: Bedeutungszuwachs eines gesellschaftlichen Phänomens (?), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90764