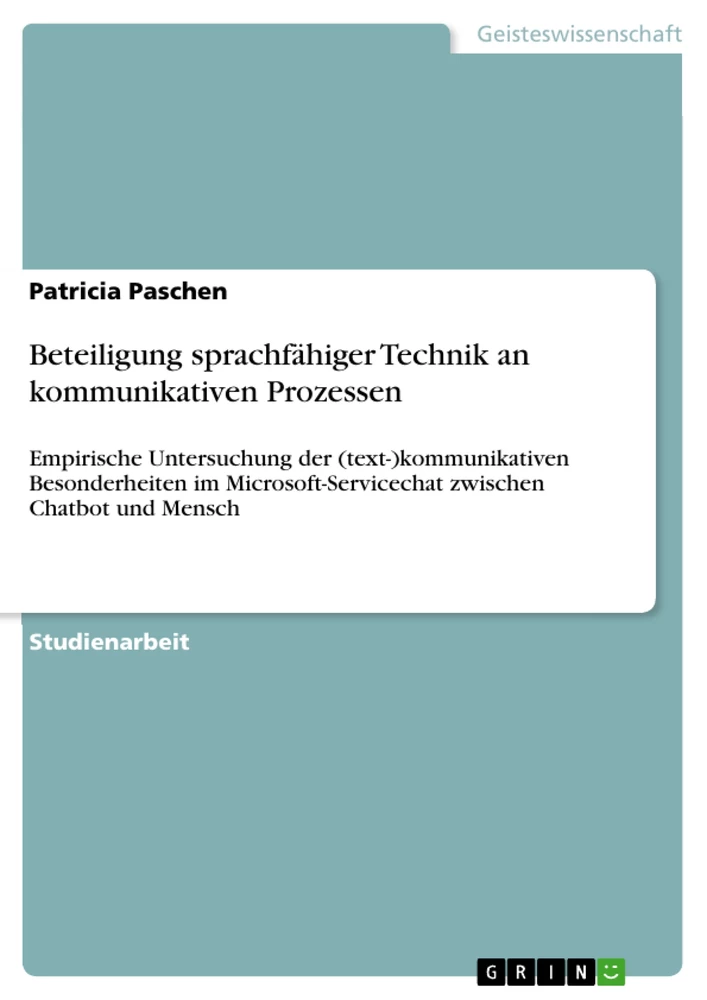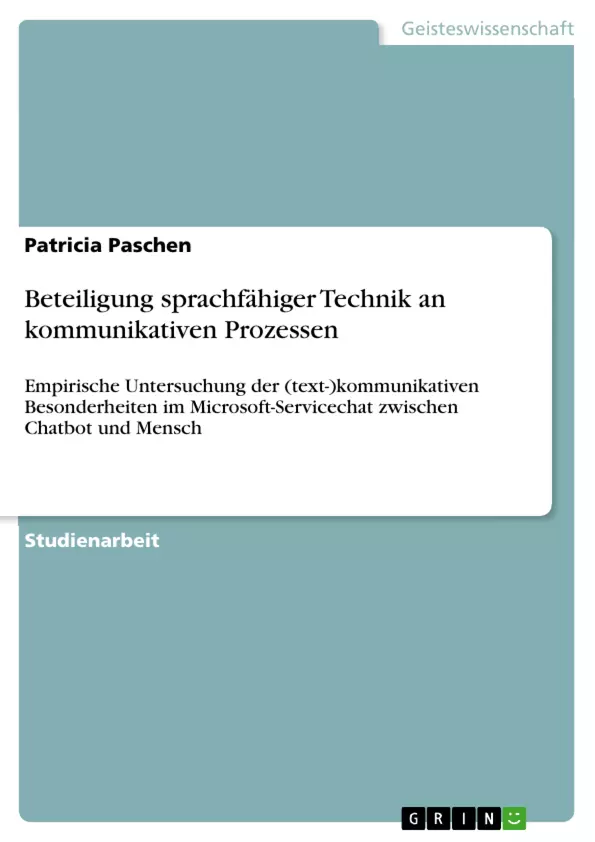Der Alltag ist von Softwareprogrammen durchdrungen. Menschen delegieren Aufgaben an technische Artefakte, führen Handlungen über sie aus, oder lassen wie bei Messengerdiensten Kommunikation über sie vermitteln. Immer häufiger gelangen Menschen in Situationen, in denen sie mit technischen, sprachfähigen Systemen umgehen müssen. Für die Soziologie eröffnet sich hier ein spannendes Untersuchungsfeld, da sich durch die Allgegenwärtigkeit und vermeintliche Selbstverständlichkeit der Nutzung von Technik die Alltagserfahrungen von Menschen im Umgang damit verändern. Relevant ist eine Beschäftigung mit solcher an Kommunikationsprozessen beteiligter Technik, da sie traditionelle Annahmen der Soziologie untergräbt. Für soziologische Forschungen sind Fragen des Verhältnisses zwischen Menschen und Maschinen insofern relevant, als die Soziologie Technik als Phänomen bislang nicht ausschöpfend und auch nicht ausreichend aus unterschiedlichen theoretischen bzw. methodischen Hintergründen als Untersuchungsgegenstand wahrgenommen hat.
Diese empirisch angelegte Arbeit erforscht kommunikative Prozesse an denen ein Chatbot und ein menschlicher Nutzer beteiligt sind. Der Bot als ein technisches, sprachfähiges System ist in dieser und ähnlicher Form inzwischen ein alltägliches Phänomen, welches Florian Muhle zufolge von der Soziologie vermehrt ins Auge gefasst werden sollte. Die Arbeit nähert sich dem kommunikativen Verhältnis zwischen Mensch und Maschine über die Analyse eines Online-Servicechats des Unternehmens Microsoft zwischen einem Chatbot und einem menschlichen Nutzer an. Untersucht wird die folgende Frage, die sich durch eine explorative Offenheit auszeichnet: Welche (text-)kommunikativen Besonderheiten lassen sich im Onlinechat zwischen Chatbot und Mensch empirisch feststellen?
Inhaltsverzeichnis
- Sprachfähige Technik und Soziologie im Onlinechat
- Verknüpfung von Systemtheorie und Methoden qualitativer Sozialforschung
- Kommunikative Prozesse zwischen Chatbot und Nutzer im Microsoft-Servicechat.
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Rolle sprachfähiger Technik im Online-Chat und analysiert die Besonderheiten der Kommunikation zwischen einem Chatbot und einem menschlichen Nutzer. Ziel ist es, empirische Einblicke in die (text-)kommunikativen Prozesse im Microsoft-Servicechat zu gewinnen.
- Verknüpfung von Systemtheorie und qualitativer Sozialforschung
- Analyse von Textkommunikation im Online-Chat
- Untersuchung der Besonderheiten der Kommunikation zwischen Chatbot und Mensch
- Konstruktivistische Hermeneutik als analytisches Werkzeug
- Bedeutung sprachfähiger Technik für die Soziologie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Dieses Kapitel führt in das Thema der sprachfähigen Technik und deren Bedeutung für die Soziologie ein. Es wird die Relevanz der Untersuchung kommunikativer Prozesse zwischen Mensch und Maschine im Kontext der digitalen Alltagskultur hervorgehoben. Die Arbeit fokussiert auf den Microsoft-Servicechat als Fallbeispiel und stellt die Forschungsfrage nach den spezifischen (text-)kommunikativen Besonderheiten im Onlinechat zwischen Chatbot und Mensch.
Kapitel 2: Dieses Kapitel erläutert den methodischen Hintergrund der Arbeit. Es werden zentrale Leitsätze der Systemtheorie und qualitative Methoden der Sozialforschung vorgestellt, insbesondere die Objektive Hermeneutik und die Konversationsanalyse. Darüber hinaus werden Überlegungen zu Textkommunikation (Hausendorf 2017), experimentelle, virtuelle Ethnografie und die konstruktivistische Hermeneutik (Muhle 2013) skizziert, die die Analyse anleiten.
Schlüsselwörter
Sprachfähige Technik, Systemtheorie, Qualitative Sozialforschung, Konversationsanalyse, Objektive Hermeneutik, Textkommunikation, Online-Chat, Microsoft-Servicechat, Chatbot, Mensch-Maschine-Interaktion, Konstruktivistische Hermeneutik.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht diese soziologische Arbeit über Technik?
Die Arbeit erforscht die (text-)kommunikativen Besonderheiten in der Interaktion zwischen einem Chatbot und einem menschlichen Nutzer.
Welches Fallbeispiel wird in der Studie analysiert?
Es wird ein konkreter Online-Servicechat des Unternehmens Microsoft zwischen einem Bot und einem Kunden untersucht.
Warum ist sprachfähige Technik für die Soziologie relevant?
Weil die Allgegenwärtigkeit solcher Systeme die Alltagserfahrungen der Menschen verändert und traditionelle soziologische Annahmen über Kommunikation infrage stellt.
Welche Forschungsmethoden kommen zum Einsatz?
Die Arbeit nutzt Methoden der qualitativen Sozialforschung, insbesondere die Konversationsanalyse, die Objektive Hermeneutik und die konstruktivistische Hermeneutik.
Was ist das Ziel einer konstruktivistischen Hermeneutik in diesem Kontext?
Sie dient als analytisches Werkzeug, um zu verstehen, wie Sinn und Kommunikation in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine konstruiert werden.
- Quote paper
- Patricia Paschen (Author), 2020, Beteiligung sprachfähiger Technik an kommunikativen Prozessen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/907670