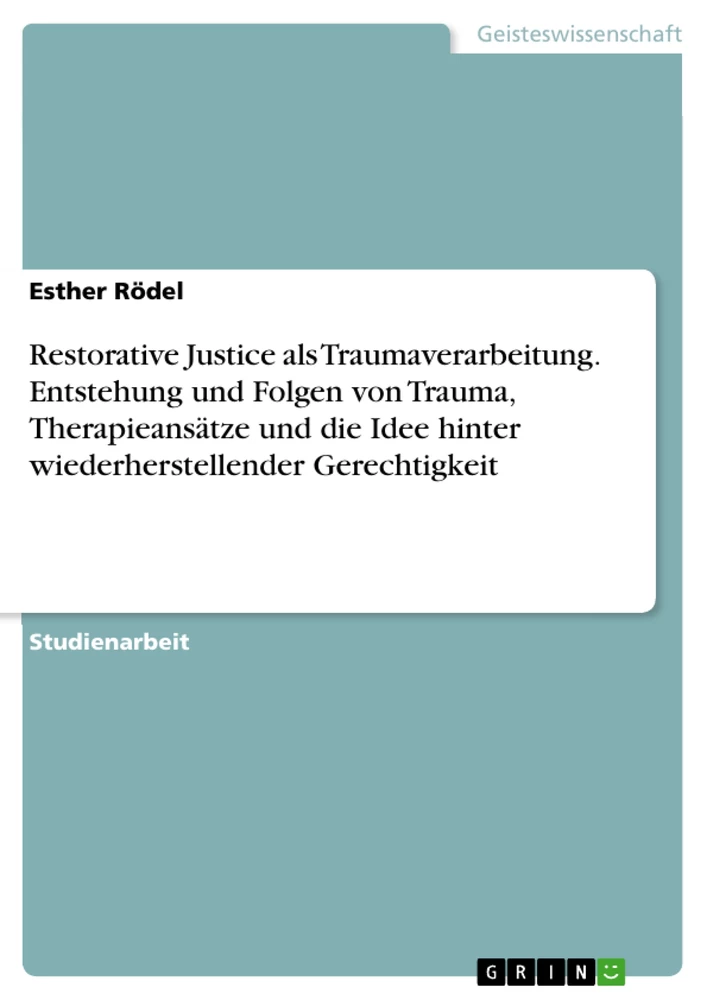Restorative Justice bedeutet wiederherstellende Gerechtigkeit. Die heilende und verarbeitende Wirkung beispielsweise eines gelungenen Täter- Opfer- Ausgleiches ist bereits statistisch nachhaltig belegt. Echte Verarbeitung im Sinne einer das erlebte Trauma einbeziehenden Realität anstelle einer dieses ausgrenzenden Wahrnehmung ist mutig und nachhaltig. Diese Arbeit zeigt die Verbindung beider Themenkomplexe auf.
Um die Begriffe Trauma und Restorative Justice in einen Zusammenhang bringen zu können, müssen wir in beiden Kontexten die Gruppierung einer Opfer- und Täterschaft herausarbeiten. Das Konzept von Restorative Justice findet erstmals 1974 in Kanada Erwähnung und bedeutet eine Wiederherstellung von Gerechtigkeit in einer Ausgleichsinteraktion zwischen Täter*innen, Opfern und der Gemeinschaft im strafrechtlichen Kontext. 1989 verankerte Neuseeland das Konzept Family- Group- Conference als Methode im Jugendstrafprozessverfahren. Weitere internationale Projekte folgen. Dies geht unter anderem. auch auf die UN-Erklärung "der Grundprinzipien der Gerechtigkeit für Opfer von Straftaten und Machtmissbrauch" vom 29.11.1985 zurück.
Als ein Ergebnis dieser Erklärung fand 1990 ein von der NATO subventionierter internationaler Kongress statt, der sich mit restaurativen Umsetzungsideen beschäftigte. Auch in den USA findet Restorative Justice Anwendung. Susan L. Miller formuliert das Ziel von Restorative Justice folgendermaßen: "Restorative Justice`s focus is on correcting a harm, whereas retributive justice strives for proportionate punishment to teach an offender a lesson through some kind of suffering." In Deutschland wird vorrangig das Konzept des Täter- Opfer- Ausgleichs (TOA) umgesetzt. In der Regel findet es Anwendung bei leichteren Straftatbeständen sowie im Jugendstrafrecht.
Inhaltsverzeichnis
- Einstieg in die Begriffe Restorative Justice und Trauma
- Traumaverarbeitung und Restorative Justice
- Die Entstehung eines Traumas
- Traumafolgestörungen
- Darstellung unterschiedlicher Therapieansätze zur Traumaverarbeitung
- Das Eye-Movement-Disensitization-and-Reprocessing-Verfahren (EMDR)
- Dialektisch- behaviorale Therapie (DBT)
- Psychodynamische Imaginative Traumatherapie (PITT)
- Restorative Justice
- Die Entstehung unseres Rechtssystems
- Die Idee von Restorative Justice
- Anwendungsgebiete des restaurativen Gerechtigkeitsprinzips
- Das Verfahren des Täter- Opfer- Ausgleiches (TOA)
- Family- Group- Conference
- Restorative Justice - ein Konzept zur Traumaverarbeitung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Traumaverarbeitung und dem Konzept der Restorative Justice. Ziel ist es, die Anwendung von Restorative Justice-Prinzipien, insbesondere des Täter-Opfer-Ausgleiches (TOA), im Kontext von Traumatisierungen zu beleuchten und deren Potenzial für die Heilung zu evaluieren.
- Definition und Kontextualisierung von Trauma und Restorative Justice
- Traumafolgestörungen und deren Behandlungsansätze
- Das Konzept der Restorative Justice und seine Anwendung in verschiedenen Rechtssystemen
- Der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) als Beispiel für Restorative Justice
- Das Potenzial von Restorative Justice in der Traumaverarbeitung
Zusammenfassung der Kapitel
Einstieg in die Begriffe Restorative Justice und Trauma: Dieses Kapitel führt in die Konzepte von Restorative Justice und Trauma ein und betont die gemeinsame Betrachtung von Opfer- und Täterschaft in beiden Kontexten. Es beleuchtet die historische Entwicklung von Restorative Justice, beginnend mit seiner ersten Erwähnung in Kanada 1974 und seine internationale Verbreitung, mit besonderem Fokus auf die UN-Erklärung von 1985 und den internationalen Kongress von 1990. Das Kapitel beschreibt den Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) als zentrale Anwendung von Restorative Justice in Deutschland und hebt dessen Bedeutung als effektives Mittel der Streitbeilegung hervor, wobei die Freiwilligkeit und die Verantwortungsübernahme des Täters betont werden. Restorative Justice wird als Abkehr von einem rein strafrechtlichen, retributiven Modell dargestellt, welches die sozialwissenschaftliche Erkenntnis von kriminellem Verhalten als Folge negativer sozialer Bedingungen berücksichtigt.
Traumaverarbeitung und Restorative Justice: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Phasen der Traumaverarbeitung, beginnend mit der Schaffung einer sicheren Umgebung und der anschließenden therapeutischen Begleitung. Es beleuchtet die Entstehung eines Traumas aus neurologischer Sicht, wobei die Rolle der Amygdala als Alarm- und Notfallsystem hervorgehoben wird. Die Reaktion des Gehirns in Überlastungssituationen (Flucht, Kampf, Freezing) und die Ausbildung von Traumafolgestörungen bei ausbleibender Hilfestellung werden detailliert erklärt. Verschiedene Therapieansätze wie EMDR, DBT und PITT werden kurz vorgestellt, um die Möglichkeit der Integration von Restorative Justice in den Heilungsprozess aufzuzeigen.
Restorative Justice: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Konzept der Restorative Justice, indem es die Entstehung des heutigen Rechtssystems beleuchtet und den Unterschied zu einem rein strafrechtlichen Ansatz herausarbeitet. Es erklärt die Grundprinzipien der Restorative Justice und deren unterschiedliche Anwendungsgebiete, mit besonderem Fokus auf das Verfahren des Täter-Opfer-Ausgleiches (TOA) und die Family-Group-Conference. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Wiederherstellung von Gerechtigkeit durch Ausgleichsinteraktion zwischen Täter, Opfer und Gemeinschaft.
Schlüsselwörter
Restorative Justice, Trauma, Traumaverarbeitung, Täter-Opfer-Ausgleich (TOA), EMDR, DBT, PITT, Jugendstrafrecht, Streitbeilegung, Opferhilfe, Wiederherstellung der Gerechtigkeit, sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, Traumafolgestörungen.
Häufig gestellte Fragen zu: Traumaverarbeitung und Restorative Justice
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Traumaverarbeitung und dem Konzept der Restorative Justice. Der Fokus liegt auf der Anwendung von Restorative Justice-Prinzipien, insbesondere des Täter-Opfer-Ausgleiches (TOA), im Kontext von Traumatisierungen und deren Potenzial für die Heilung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Kontextualisierung von Trauma und Restorative Justice, Traumafolgestörungen und deren Behandlungsansätze (EMDR, DBT, PITT), das Konzept der Restorative Justice und seine Anwendung (TOA, Family-Group-Conference), sowie das Potenzial von Restorative Justice in der Traumaverarbeitung. Sie beleuchtet die historische Entwicklung von Restorative Justice und seine internationale Verbreitung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die sich mit dem Einstieg in die Begriffe Restorative Justice und Trauma, der Traumaverarbeitung und Restorative Justice (inklusive verschiedener Therapieansätze), und dem Konzept von Restorative Justice (inkl. TOA und Family-Group-Conference) befassen. Ein abschließendes Kapitel betrachtet Restorative Justice als Konzept zur Traumaverarbeitung.
Was ist Restorative Justice?
Restorative Justice ist ein Konzept, das sich von einem rein strafrechtlichen, retributiven Modell abgrenzt. Es zielt auf die Wiederherstellung von Gerechtigkeit durch Ausgleichsinteraktion zwischen Täter, Opfer und Gemeinschaft ab. Der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) und die Family-Group-Conference sind Beispiele für seine Anwendung.
Welche Rolle spielt der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)?
Der TOA ist ein zentrales Anwendungsbeispiel von Restorative Justice. Er betont die Freiwilligkeit und die Verantwortungsübernahme des Täters und dient als effektives Mittel der Streitbeilegung.
Welche Therapieansätze zur Traumaverarbeitung werden betrachtet?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Therapieansätze zur Traumaverarbeitung, darunter EMDR (Eye-Movement-Disensitization-and-Reprocessing), DBT (Dialektisch-behaviorale Therapie) und PITT (Psychodynamische Imaginative Traumatherapie).
Wie wird die Entstehung eines Traumas erklärt?
Die Arbeit beleuchtet die Entstehung eines Traumas aus neurologischer Sicht, wobei die Rolle der Amygdala als Alarm- und Notfallsystem hervorgehoben wird. Die Reaktion des Gehirns in Überlastungssituationen (Flucht, Kampf, Freezing) und die Ausbildung von Traumafolgestörungen bei ausbleibender Hilfestellung werden detailliert erklärt.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, das Potenzial von Restorative Justice-Prinzipien, insbesondere des TOA, in der Traumaverarbeitung zu evaluieren und den Zusammenhang zwischen Traumaverarbeitung und Restorative Justice zu untersuchen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Restorative Justice, Trauma, Traumaverarbeitung, Täter-Opfer-Ausgleich (TOA), EMDR, DBT, PITT, Jugendstrafrecht, Streitbeilegung, Opferhilfe, Wiederherstellung der Gerechtigkeit, sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, Traumafolgestörungen.
- Arbeit zitieren
- Esther Rödel (Autor:in), 2019, Restorative Justice als Traumaverarbeitung. Entstehung und Folgen von Trauma, Therapieansätze und die Idee hinter wiederherstellender Gerechtigkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/908608