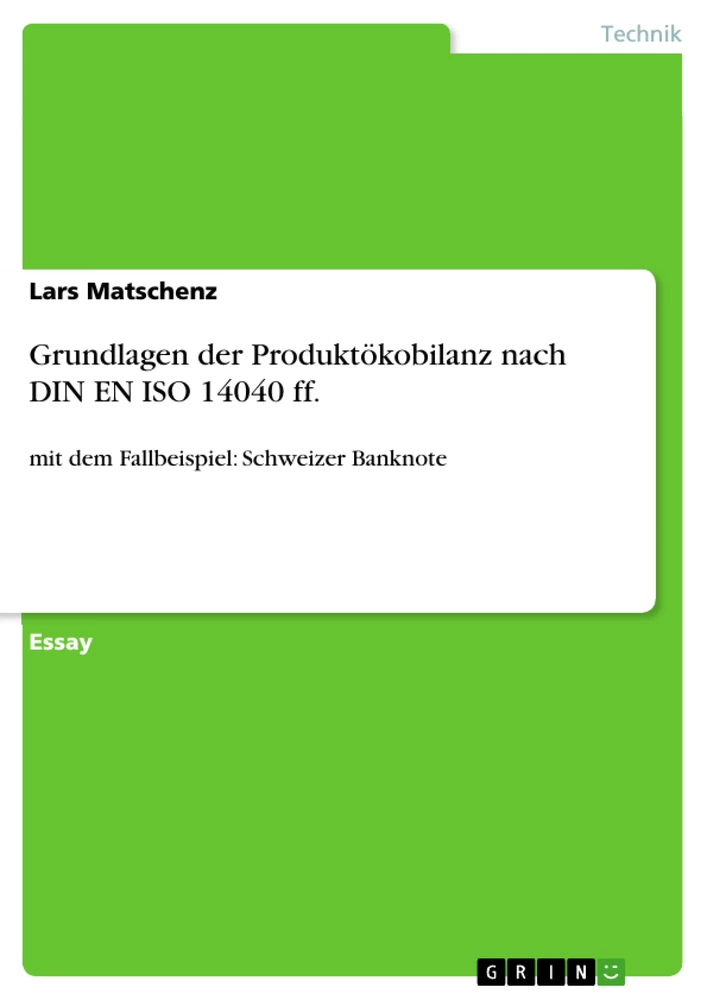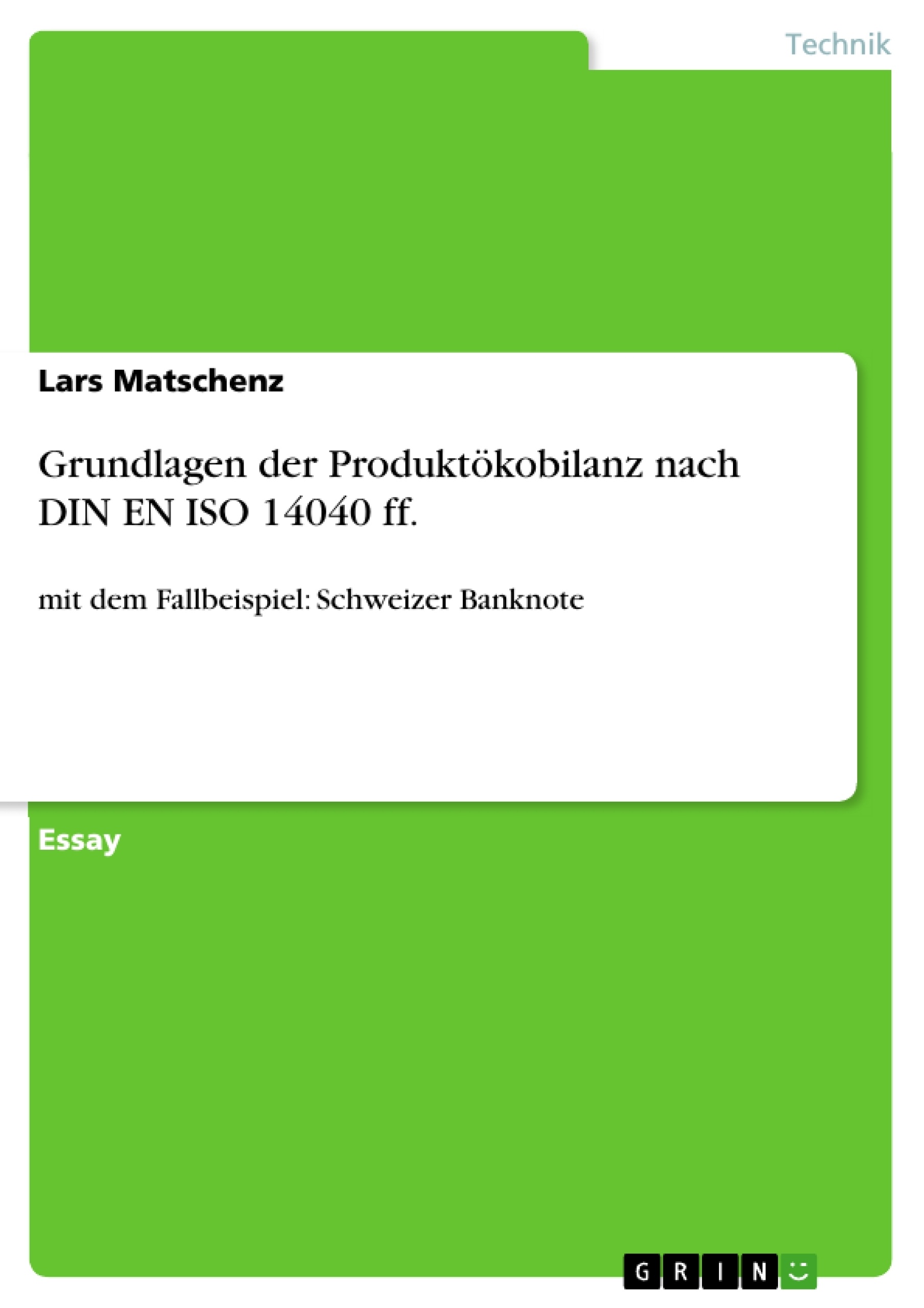Der Begriff der Produktökobilanz wurde erst in den 90er Jahren geprägt, im angelsächsischen Sprachraum hat sich der Begriff des „Life-Cycle-Assessment“ (LCA) durchgesetzt. Erstmals wurden in den 60er Jahren Ökobilanzen in den USA erstellt. Die Ökobilanz ist keine Bilanz im Sinne des Rechnungswesens, sondern ein Vergleich von stofflichen Einsatzfaktoren (Input) und ihren Umwelteinwirkungen (Output).
Die Produktökobilanzierung ist ein Instrument des Umweltmanagements und beschreibt ein ökologisches Produktprofil. Umwelteinflüsse werden über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts erfasst und analysiert (von der Wiege bis zur Bahre). Insbesondere die Stoffkreisläufe spielen eine große Rolle. Diese reichen von der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung, Produktion und letztlich bis zur Beseitigung. Ökobilanzen bieten eine medienübergreifende Sichtweise, so können Problemverschiebungen zwischen einzelnen Umweltmedien (wie Luft, Boden, Wasser) aufgedeckt und erkannt werden.
Im betrieblichen Kontext bieten sie die Möglichkeit einer Bestandsaufnahme der vom Produkt ausgehenden Umweltbeeinflussung und der Identifikation von ökologischen Schwachstellen. Somit liefern sie die Grundlage für Optimierung bei der Gestaltung von Produktionsprozessen, Auswahl und Einsparung von Materialien und Rohstoffen sowie der Vermeidung bzw. Verringerung von Abfällen und Emissionen. Insbesondere die Energiegewinnung und Einsparung von Energie wird mit immer steigenden Energiepreisen an Bedeutung zunehmen.
Die Produktökobilanz der schweizer Banknote wird als Fallbeispiel behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Normenreihe DIN EN ISO 14040 ff.
- 2.1. Grundkonzept der Normenreihe
- 2.2. Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens
- 2.3. Sachbilanz
- 2.4. Wirkungsabschätzung
- 2.5. Auswertung
- 2.6. Kritische Prüfung
- 3. Fallbeispiel - Die Schweizer Banknote
- 3.1. Ziel und Untersuchungsrahmen
- 3.2. Sachbilanz und Wirkungsabschätzung
- 3.3. Auswertung
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Grundlagen der Produktökobilanz nach DIN EN ISO 14040 ff. und illustriert diese anhand eines Fallbeispiels. Das Ziel ist es, das Verständnis für die Methodik der Produktökobilanzierung zu verbessern und deren Anwendung in der Praxis zu veranschaulichen.
- Grundkonzept der Normenreihe DIN EN ISO 14040 ff.
- Prozesse der Zieldefinition und des Untersuchungsrahmens bei der Produktökobilanzierung.
- Durchführung und Interpretation einer Sachbilanz.
- Anwendung der Produktökobilanzierung in einem konkreten Fallbeispiel.
- Bedeutung der Produktökobilanzierung für Umweltmanagement und ökonomische Optimierung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Produktökobilanz (Ökobilanz oder Life-Cycle-Assessment, LCA) ein und beschreibt deren Entstehung und Bedeutung im Umweltmanagement. Sie hebt die medienübergreifende Sichtweise hervor, die Problemverschiebungen zwischen Umweltmedien aufdeckt, und betont die Möglichkeiten der Optimierung von Produktionsprozessen, Materialauswahl und Abfallvermeidung. Die ökonomischen Vorteile, wie Kostensenkung und die Erschließung neuer Marktchancen durch ökologisch orientierte Verbraucher, werden ebenfalls angesprochen. Die Anwendung der Produktökobilanzierung sowohl für Einzelprodukte als auch für Dienstleistungen wird erläutert, ebenso wie die retrospektive und prospektive Betrachtungsweise.
2. Normenreihe DIN EN ISO 14040 ff.: Dieses Kapitel beschreibt das Grundkonzept der Normenreihe DIN EN ISO 14040 ff., beginnend mit der ISO 14040, welche allgemeine Prinzipien festlegt. Es werden die detaillierteren Normen ISO 14041 (Zieldefinition und Sachbilanz), ISO 14042 (Wirkungsabschätzung) und ISO 14043 (Auswertung) vorgestellt. Die Möglichkeit, die Wirkungsabschätzung zu überspringen und eine reine Sachökobilanz durchzuführen, wird ebenfalls erläutert. Das Kapitel unterstreicht die Bedeutung der Norm für die standardisierte Durchführung von Ökobilanzen.
2.2. Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die initiale Phase der Produktökobilanzierung: die Definition des Ziels und des Untersuchungsrahmens. Die Bedeutung einer klaren Zieldefinition und der Bestimmung der Zielgruppe wird betont, um die Vergleichbarkeit von Produkten zu gewährleisten. Die funktionelle Einheit als Grundlage für den Vergleich wird erläutert, sowie die Notwendigkeit, Systemgrenzen zu setzen, um die Datenerfassung zu vereinfachen und zu fokussieren. Hierbei werden verschiedene Aspekte wie geografische, technologische und zeitliche Grenzen betrachtet.
Schlüsselwörter
Produktökobilanz, Life-Cycle-Assessment (LCA), DIN EN ISO 14040 ff., Umweltmanagement, Sachbilanz, Wirkungsabschätzung, Auswertung, Ökologische Optimierung, Kostensenkung, Systemgrenzen, funktionelle Einheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Produktökobilanz nach DIN EN ISO 14040 ff.
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit behandelt die Grundlagen der Produktökobilanz (Ökobilanz oder Life-Cycle-Assessment, LCA) gemäß der Normenreihe DIN EN ISO 14040 ff. Sie erläutert die Methodik der Produktökobilanzierung und veranschaulicht diese anhand eines Fallbeispiels (Schweizer Banknote).
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter das Grundkonzept der Normenreihe DIN EN ISO 14040 ff., die Festlegung von Zielen und Untersuchungsrahmen, die Durchführung und Interpretation einer Sachbilanz, die Wirkungsabschätzung und die Auswertung der Ergebnisse. Ein konkretes Fallbeispiel illustriert die praktische Anwendung der Methodik. Die Bedeutung der Produktökobilanzierung für Umweltmanagement und ökonomische Optimierung wird ebenfalls diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel über die Normenreihe DIN EN ISO 14040 ff. (mit Unterkapiteln zu Zieldefinition, Sachbilanz, Wirkungsabschätzung und Auswertung), ein Kapitel mit einem Fallbeispiel (Schweizer Banknote) und ein Literaturverzeichnis.
Was wird im Kapitel über die Normenreihe DIN EN ISO 14040 ff. behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt das Grundkonzept der Normenreihe, einschließlich der ISO 14040 (allgemeine Prinzipien), ISO 14041 (Zieldefinition und Sachbilanz), ISO 14042 (Wirkungsabschätzung) und ISO 14043 (Auswertung). Es wird auch die Möglichkeit einer reinen Sachökobilanz ohne Wirkungsabschätzung erläutert.
Wie wird das Fallbeispiel der Schweizer Banknote behandelt?
Das Fallbeispiel illustriert die Anwendung der Produktökobilanzierung anhand der Schweizer Banknote. Es umfasst die Definition von Ziel und Untersuchungsrahmen, die Durchführung der Sachbilanz und Wirkungsabschätzung sowie die Auswertung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Hausarbeit relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Produktökobilanz, Life-Cycle-Assessment (LCA), DIN EN ISO 14040 ff., Umweltmanagement, Sachbilanz, Wirkungsabschätzung, Auswertung, Ökologische Optimierung, Kostensenkung, Systemgrenzen, funktionelle Einheit.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel der Hausarbeit ist es, das Verständnis für die Methodik der Produktökobilanzierung zu verbessern und deren Anwendung in der Praxis zu veranschaulichen.
Welche Bedeutung hat die Produktökobilanzierung?
Die Produktökobilanzierung ist wichtig für das Umweltmanagement, da sie die Möglichkeit bietet, Produktionsprozesse, Materialauswahl und Abfallvermeidung zu optimieren. Sie kann auch ökonomische Vorteile wie Kostensenkung und die Erschließung neuer Marktchancen durch ökologisch orientierte Verbraucher bieten.
- Arbeit zitieren
- Lars Matschenz (Autor:in), 2008, Grundlagen der Produktökobilanz nach DIN EN ISO 14040 ff., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90876