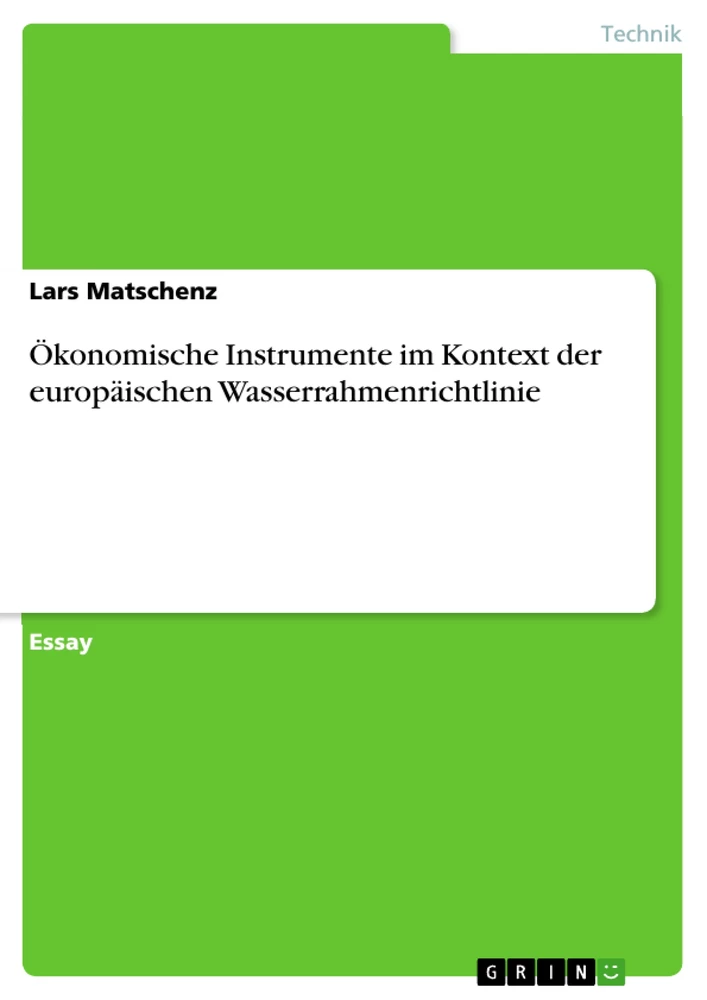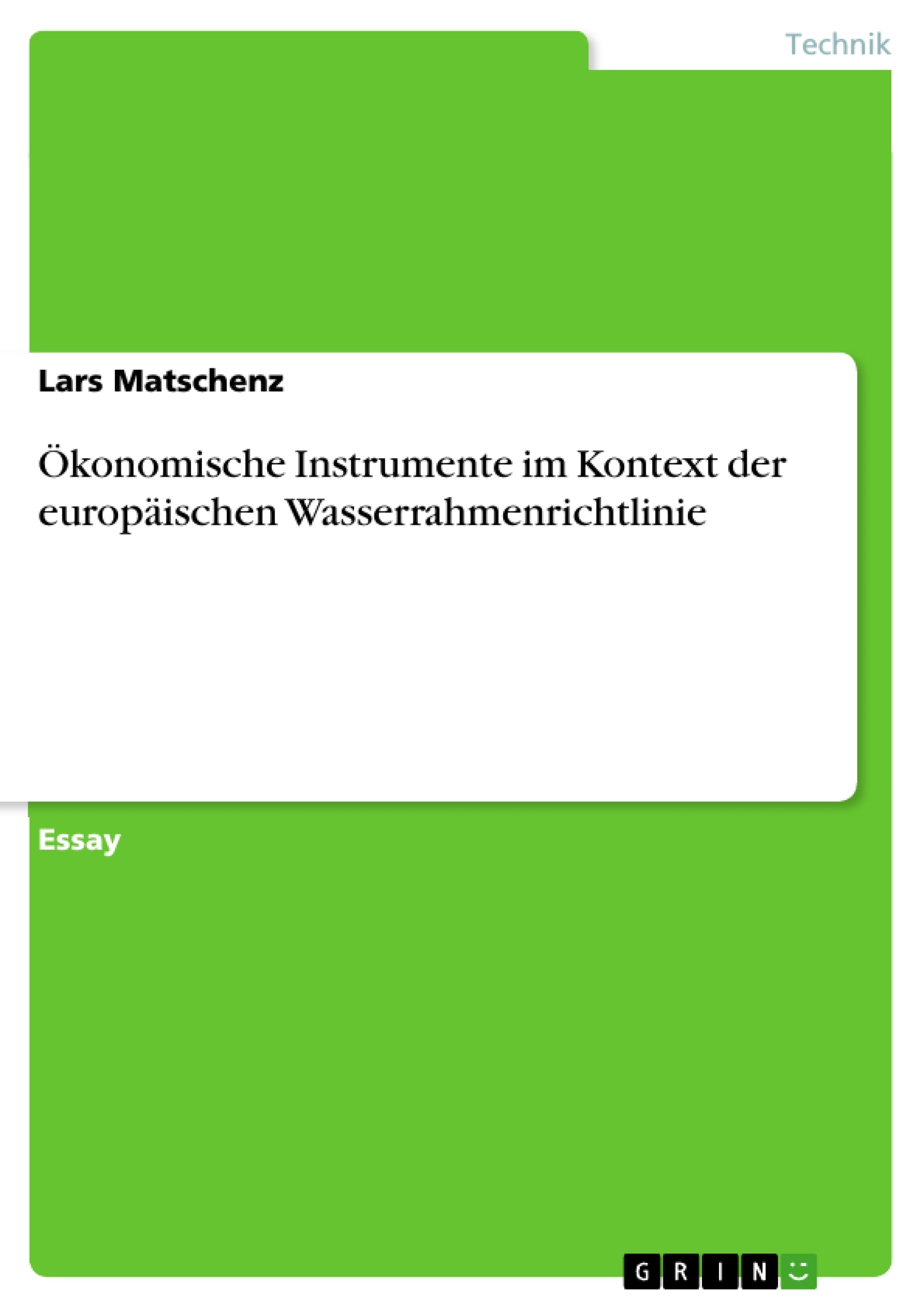Europa leidet allgemein nicht an Wasserknappheit. Jedoch ist die Qualität der Gewässer nicht in allen Gebieten zufrieden stellend. Wasser bildet eine Grundlage des Lebens und stellt eine wichtige Ressource für den Menschen dar. So sind Landwirtschaft, Fischerei, Energieerzeugung, Industrie, Verkehr und Tourismus vom Wasser abhängig und somit bildet Wasser auch eine Grundlage des Wohlstands in Europa.
Im globalen Kontext ist Wasser eine knappe Ressource. Die Vereinten Nationen riefen daher das Jahr 2003 zum „Internationalen Jahr des Süßwassers“ aus (begründet in der Resolution 55/196), um auf eine nachhaltige Nutzung der Ressource Wasser aufmerksam zu machen. Bereits im Jahr 2000 trat nach fünfjährigem Diskussions- und Konsultationsprozess am 22. Dezember die „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ (WRRL) in Kraft. Ziel der WRRL ist die Erreichung eines „guten Zustands“ für alle Gewässer im europäischen Raum. Die unterschiedlichen Gesetzgebungen der einzelnen Mitgliedsstaaten der EU sollen vereinheitlicht werden und eine neue Phase der modernen Gewässerpolitik eingeleitet werden. So bildet die WRRL eine Harmonisierung der nationalen Vorschriften und bietet einen medienübergreifenden Ansatz.
Mit der WRRL sollte ein Ordnungsrahmen geschaffen werden, der die Binnenoberflächengewässer, das Grundwasser und die Übergangs- und Küstengewässer einbezieht. Die Qualität der Gewässer soll sich nicht nur nicht weiter verschlechtern, sondern auch verbessern. Dies soll durch Schutz-, Verbesserungs- und Sanierungsaufgaben sichergestellt werden. Ein weiterer Kernpunkt der WRRL ist eine Kostendeckung der Wasserdienstleistung zu erreichen. Dies bedeutet, dass nach dem Verursacherprinzip einzelne Wirtschaftszweige einen Beitrag zur Kostendeckung der Wasserdienstleistung leisten. Hier findet eine Internalisierung von Umwelt- und Ressourcenkosten unter dem Einsatz wirtschaftlicher Instrumente statt. Hiermit sollen Anreize für einen sparsameren und effizienteren Umgang mit der Ressource Wasser geschaffen werden. Dies stellt eine der wichtigsten Neuerungen im Wasserrecht dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Inhalte der Wasserrahmenrichtlinie
- 2.1. Umsetzungsprozess
- 2.2. Umweltziele
- 2.3. Bestandsaufnahme
- 3. Internalisierung von Umwelt- und Ressourcenkosten
- 4. Ausblick
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die ökonomischen Instrumente im Kontext der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Ziel ist es, die Funktionsweise dieser Instrumente im Hinblick auf die Erreichung der in der Richtlinie festgelegten Umweltziele zu beleuchten. Dabei werden insbesondere die Aspekte der Internalisierung von Umwelt- und Ressourcenkosten sowie die Anreizmechanismen für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung in den Fokus genommen.
- Die WRRL als Ordnungsrahmen für die europäische Wasserpolitik
- Die Internalisierung von Umwelt- und Ressourcenkosten durch ökonomische Instrumente
- Die Rolle der ökonomischen Instrumente bei der Erreichung der Umweltziele der WRRL
- Der Beitrag der WRRL zur nachhaltigen Wasserbewirtschaftung in Europa
- Die Herausforderungen und Chancen der Umsetzung der WRRL in den Mitgliedsstaaten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und skizziert die Problematik der Wasserqualität in Europa. Sie führt die WRRL als wichtigen Meilenstein der europäischen Wasserpolitik ein und hebt die Bedeutung der ökonomischen Instrumente für die Erreichung der Umweltziele hervor.
- Kapitel 2: Inhalte der Wasserrahmenrichtlinie: Dieses Kapitel beleuchtet die zentralen Inhalte der WRRL, einschließlich des Umsetzungsprozesses, der Umweltziele, der Bestandsaufnahme der Wasserkörper und der Entwicklung von Maßnahmenprogrammen.
- Kapitel 2.1: Umsetzungsprozess: Dieser Abschnitt erklärt den Schritt-für-Schritt-Prozess der WRRL-Umsetzung, angefangen von der Bestandsaufnahme der Wasserkörper über die Definition von Umweltzielen bis hin zur Entwicklung von Maßnahmenprogrammen.
- Kapitel 2.2: Umweltziele: Dieser Abschnitt erläutert die in der WRRL festgelegten Umweltziele, die eine Verbesserung der Wasserqualität und die Erreichung eines "guten Zustands" für alle Gewässer zum Ziel haben.
- Kapitel 2.3: Bestandsaufnahme: Dieser Abschnitt beschreibt die Bestandsaufnahme der Wasserkörper, die eine qualitative Klassifizierung der Gewässer in Güteklassen beinhaltet und die Grundlage für die Festlegung von Maßnahmenprogrammen bildet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den ökonomischen Instrumenten im Kontext der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Die zentralen Themenfelder umfassen die Internalisierung von Umwelt- und Ressourcenkosten, die Anreizmechanismen für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung und die Erreichung der in der Richtlinie festgelegten Umweltziele. Die Arbeit analysiert die Funktionsweise der ökonomischen Instrumente und ihre Bedeutung für die Umsetzung der WRRL.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)?
Das Ziel ist die Erreichung eines „guten Zustands“ für alle europäischen Gewässer durch Schutz, Verbesserung und Sanierung.
Was bedeutet die Internalisierung von Umwelt- und Ressourcenkosten?
Es bedeutet, dass die Kosten für ökologische Schäden und die Nutzung der Ressource Wasser in die Preise für Wasserdienstleistungen einbezogen werden (Verursacherprinzip).
Welche Gewässer fallen unter die WRRL?
Die Richtlinie umfasst Binnenoberflächengewässer, Grundwasser sowie Übergangs- und Küstengewässer.
Welche Rolle spielen ökonomische Instrumente in der Wasserpolitik?
Sie sollen Anreize für einen sparsamen und effizienten Umgang mit Wasser schaffen und eine Kostendeckung der Wasserdienstleistungen sicherstellen.
Was ist das „Verursacherprinzip“ im Kontext der WRRL?
Das Prinzip besagt, dass die verschiedenen Wirtschaftszweige (z.B. Landwirtschaft, Industrie) einen angemessenen Beitrag zu den Kosten der Wasserbewirtschaftung leisten müssen.
- Arbeit zitieren
- Lars Matschenz (Autor:in), 2008, Ökonomische Instrumente im Kontext der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90877