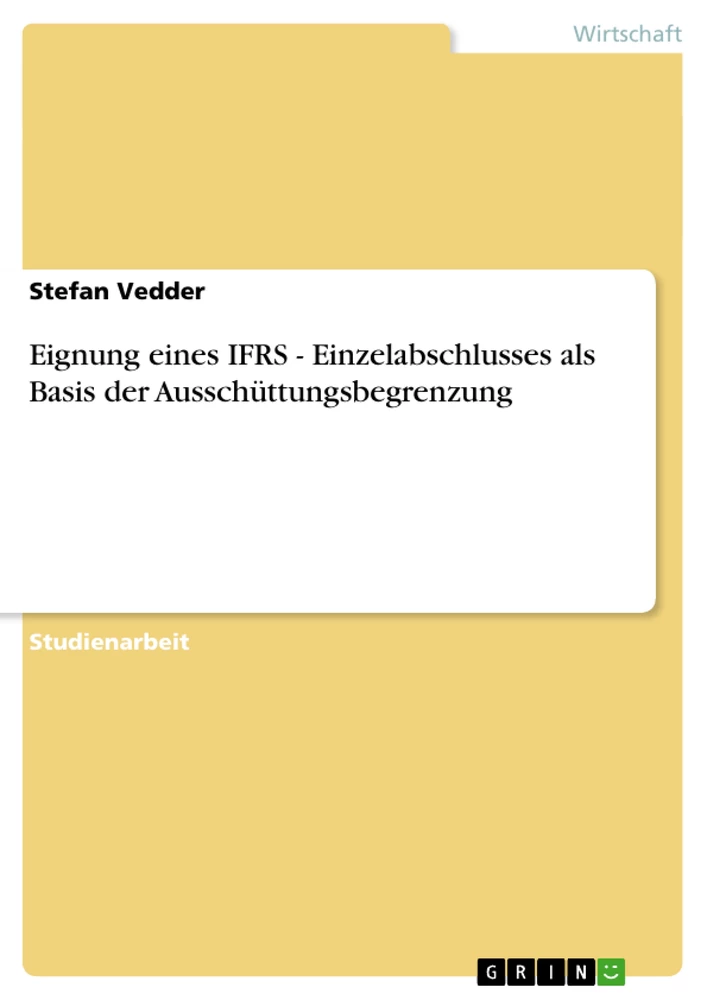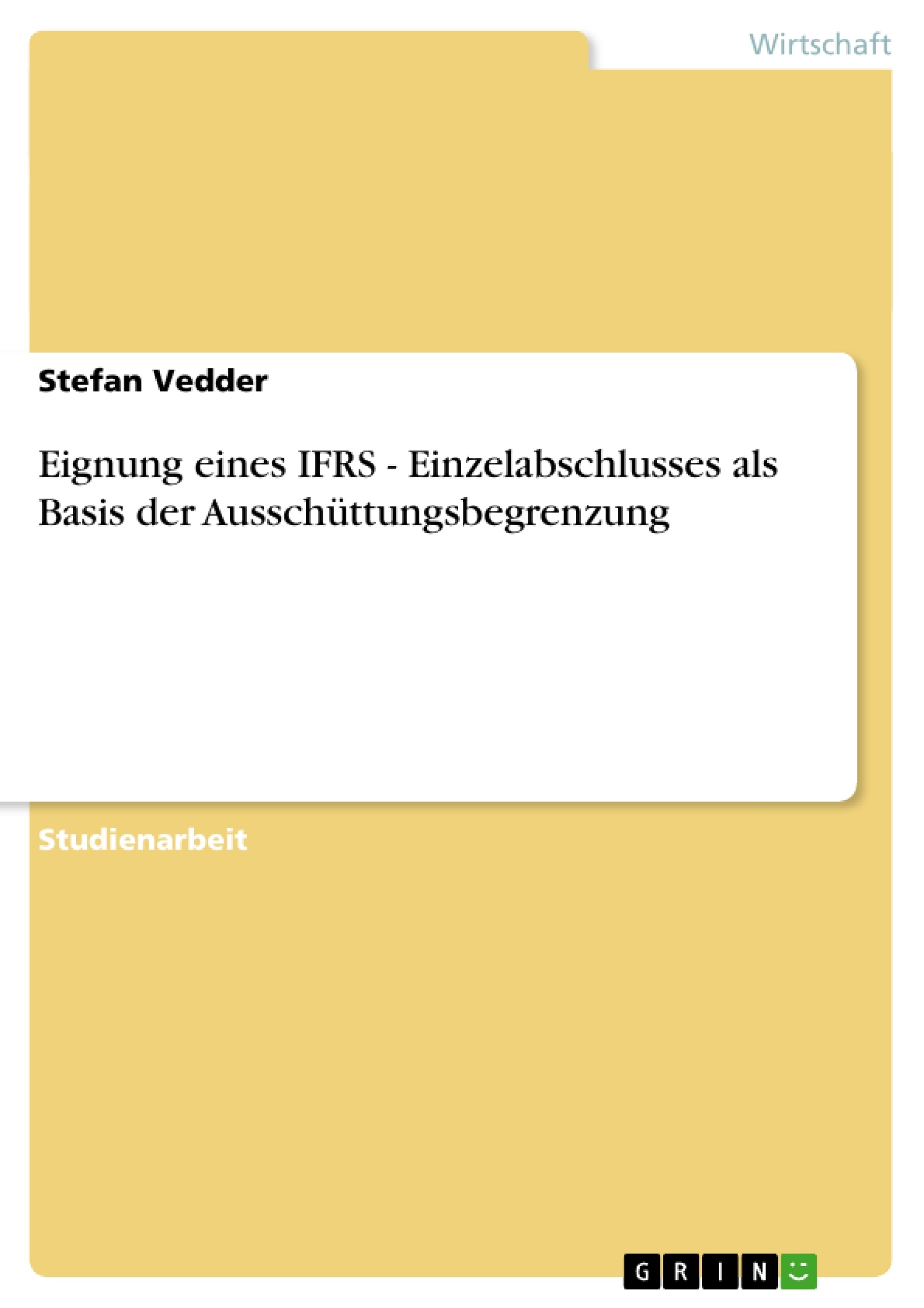Mit der sog. „IAS-Verordnung“ hat die EG den Weg für eine grundsätzliche IFRSBilanzierung
auch deutscher Unternehmen geebnet. Von der darin eröffneten Möglichkeit,
den Unternehmen auch in jeder Hinsicht befreiende Einzelabschlüsse auf Basis der
IFRS zu gestatten oder gar vorzuschreiben, hat der deutsche Gesetzgeber indes keinen
Gebrauch gemacht. Neben verpflichtenden IFRS-Konzernabschlüssen für kapitalmarktorientierte
Muttergesellschaften besteht für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen
ein Wahlrecht, ihren Konzernabschluss ebenfalls nach IFRS aufzustellen. Für Einzelabschlüsse
gibt es zwar auch ein grundsätzliches IFRS-Wahlrecht, jedoch betrifft dieses
lediglich die Offenlegung. Es muss daher weiterhin ein HGB-Einzelabschluss insb. für
Zwecke der Ausschüttung und – wegen des in § 5 Abs. 1 EStG normierten Maßgeblichkeitsprinzips
– der Besteuerung aufgestellt werden.
Eben die Tatsache, dass mit dem Einzelabschluss verschiedene Rechtsfolgen verknüpft
sind, weckt Vorbehalte, ob ein nach IFRS erstellter Jahresabschluss, der in erster Linie
dazu dienen soll, entscheidungsrelevante Informationen insb. für Investoren bereit zu
stellen3, bspw. geeignet ist, als Basis für die Ausschüttung zu dienen.4 So wurde die
Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, keine durchweg befreienden IFRSEinzelabschlüsse
zuzulassen, auch damit begründet, dass sich ein IFRS-Einzelabschluss
gerade nicht als Grundlage für die Ausschüttungsbemessung eigne.5 Aus welchen
Gründen sich ein nach den IFRS aufgestellter Einzelabschluss dafür tatsächlich nicht
eignet und welche Reformvorschläge diesbezüglich existieren, gilt es auf den nächsten
Seiten aufzuzeigen. Bei haftungsbeschränkten Unternehmen ist eine grundsätzliche Ausschüttungsbegrenzung nötig, da den Gläubigern von (haftungsbeschränkten) Kapitalgesellschaften lediglich das Un-ternehmensvermögen als Haftungsmasse zur Verfügung steht und jede Ausschüttung das im Unternehmen vorhandene Vermögen mindert. Da eine Ausschüttungsbegrenzung lediglich für haftungsbeschränkte Unternehmen von Bedeutung ist, finden sich die relevanten Vorschriften entsprechend in den gesellschaftsrechtlichen Normen. So normiert bspw. § 58 AktG, dass lediglich der Bilanzgewinn an die Aktionäre ausgeschüttet werden darf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Die Ausschüttungsbemessungsfunktion des Einzelabschlusses
- 3. Mangelnde Eignung der IFRS für die Ausschüttungsbegrenzung - Darstellung anhand ausgewählter Standards
- 3.1 Teilgewinnrealisierung bei langfristiger Fertigung
- 3.2 Fair Value-Bewertung
- 3.3 Aktivierung von Entwicklungskosten/selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten
- 3.4 Einschränkung der Passivierung von Verbindlichkeiten und Rückstellungen
- 4. Gläubigerschutz und Kapitalerhaltung durch IFRS-Bilanzierung
- 5. Die Zukunft von Gläubigerschutz und Kapitalerhaltung
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung eines nach IFRS erstellten Einzelabschlusses als Basis für die Ausschüttungsbegrenzung deutscher Unternehmen. Sie analysiert die Unterschiede zwischen IFRS und HGB im Hinblick auf den Gläubigerschutz und die Kapitalerhaltung. Die Arbeit hinterfragt die Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, keine vollständig befreienden IFRS-Einzelabschlüsse zuzulassen.
- Die Ausschüttungsbemessungsfunktion des Einzelabschlusses im deutschen Recht
- Unterschiedliche Ansatz- und Bewertungsmethoden nach IFRS und HGB
- Auswirkungen der IFRS-Bilanzierung auf den Gläubigerschutz
- Bewertung des Vorsichtsprinzips im Kontext der IFRS
- Zukünftige Entwicklungen im Bereich Gläubigerschutz und Kapitalerhaltung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Die Arbeit führt in die Thematik ein und beschreibt den Hintergrund der Untersuchung. Sie beleuchtet die Einführung der IAS-Verordnung in der EG und die Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, keine umfassende Zulassung von IFRS-Einzelabschlüssen zu beschließen. Der Fokus liegt auf der Frage, ob ein nach IFRS erstellter Einzelabschluss als Grundlage für Ausschüttungsbemessungen geeignet ist, da verschiedene Rechtsfolgen mit dem Einzelabschluss verbunden sind und Vorbehalte bestehen, ob ein primär für Investoren konzipierter IFRS-Abschluss für Ausschüttungsentscheidungen geeignet ist. Die Arbeit kündigt die detailliertere Untersuchung der Gründe für die Ungeeignetheit und mögliche Reformvorschläge an.
2. Die Ausschüttungsbemessungsfunktion des Einzelabschlusses: Dieses Kapitel erläutert die Bedeutung der Ausschüttungsbegrenzung bei haftungsbeschränkten Unternehmen zum Schutz der Gläubiger. Es beschreibt, wie die Rechnungslegung den maximal ausschüttbaren Betrag festlegt, wobei der Jahresüberschuss und die Gewinnrücklagen entscheidend sind. Das Kapitel hebt die Bedeutung der vorsichtigen Gewinnermittlung im HGB für den Gläubigerschutz hervor und kündigt die nachfolgende Analyse der Abweichungen zwischen IFRS und HGB an, die aufzeigen sollen, dass IFRS-Gewinne eine fragwürdige Grundlage für Ausschüttungsentscheidungen darstellen könnten. Die kontroverse Diskussion über die Vorteilhaftigkeit von kapitalerhaltenden Maßnahmen für Gläubiger wird erwähnt, jedoch aus Gründen des Umfangs nicht weiter vertieft.
Schlüsselwörter
IFRS, HGB, Ausschüttungsbegrenzung, Gläubigerschutz, Kapitalerhaltung, Vorsichtsprinzip, Jahresabschluss, Einzelabschluss, Konzernabschluss, Bilanzgewinn, Gewinnrücklagen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Eignung von IFRS-Einzelabschlüssen für die Ausschüttungsbegrenzung"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob ein nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellter Einzelabschluss als Grundlage für die Ausschüttungsbegrenzung deutscher Unternehmen geeignet ist. Sie vergleicht IFRS mit dem Handelsgesetzbuch (HGB) und analysiert die Auswirkungen auf Gläubigerschutz und Kapitalerhaltung.
Warum ist die Eignung von IFRS-Einzelabschlüssen für die Ausschüttungsbegrenzung fragwürdig?
Die Arbeit argumentiert, dass IFRS, im Gegensatz zum HGB, nicht primär auf den Gläubigerschutz ausgerichtet ist. Verschiedene IFRS-Standards (z.B. Teilgewinnrealisierung, Fair Value-Bewertung, Aktivierung von Entwicklungskosten) können zu einer Überschätzung des Gewinns führen und somit die Ausschüttungsbegrenzung gefährden. Der deutsche Gesetzgeber lässt deshalb keine vollständig befreienden IFRS-Einzelabschlüsse zu.
Welche Aspekte von IFRS werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert detailliert die Auswirkungen folgender IFRS-Standards auf die Ausschüttungsbegrenzung: Teilgewinnrealisierung bei langfristiger Fertigung, Fair Value-Bewertung, Aktivierung von Entwicklungskosten/selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten und die Einschränkung der Passivierung von Verbindlichkeiten und Rückstellungen.
Welche Rolle spielt das Vorsichtsprinzip?
Das HGB betont das Vorsichtsprinzip, um Gläubiger zu schützen. Die Arbeit bewertet die Bedeutung des Vorsichtsprinzips im Kontext von IFRS und untersucht, inwieweit IFRS dieses Prinzip ausreichend berücksichtigt. Die Arbeit stellt die Frage, ob IFRS-Gewinne eine fragwürdige Grundlage für Ausschüttungsentscheidungen darstellen könnten, da sie im Vergleich zum HGB weniger vorsichtig ermittelt werden.
Wie werden IFRS und HGB im Hinblick auf Gläubigerschutz und Kapitalerhaltung verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Ansatz- und Bewertungsmethoden nach IFRS und HGB und analysiert die Auswirkungen der unterschiedlichen Bilanzierung auf den Gläubigerschutz. Sie untersucht, ob IFRS-Bilanzierung die Kapitalerhaltung ausreichend gewährleistet.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass ein nach IFRS erstellter Einzelabschluss aufgrund der Unterschiede zu HGB und der potenziellen Überschätzung des Gewinns nicht uneingeschränkt als Basis für die Ausschüttungsbegrenzung geeignet ist. Die Arbeit beleuchtet die bestehenden Vorbehalte gegen IFRS in diesem Kontext und diskutiert mögliche zukünftige Entwicklungen im Bereich Gläubigerschutz und Kapitalerhaltung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
IFRS, HGB, Ausschüttungsbegrenzung, Gläubigerschutz, Kapitalerhaltung, Vorsichtsprinzip, Jahresabschluss, Einzelabschluss, Konzernabschluss, Bilanzgewinn, Gewinnrücklagen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Problemstellung, Die Ausschüttungsbemessungsfunktion des Einzelabschlusses, Mangelnde Eignung der IFRS für die Ausschüttungsbegrenzung, Gläubigerschutz und Kapitalerhaltung durch IFRS-Bilanzierung, Die Zukunft von Gläubigerschutz und Kapitalerhaltung und Zusammenfassung.
- Arbeit zitieren
- Stefan Vedder (Autor:in), 2007, Eignung eines IFRS - Einzelabschlusses als Basis der Ausschüttungsbegrenzung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90916