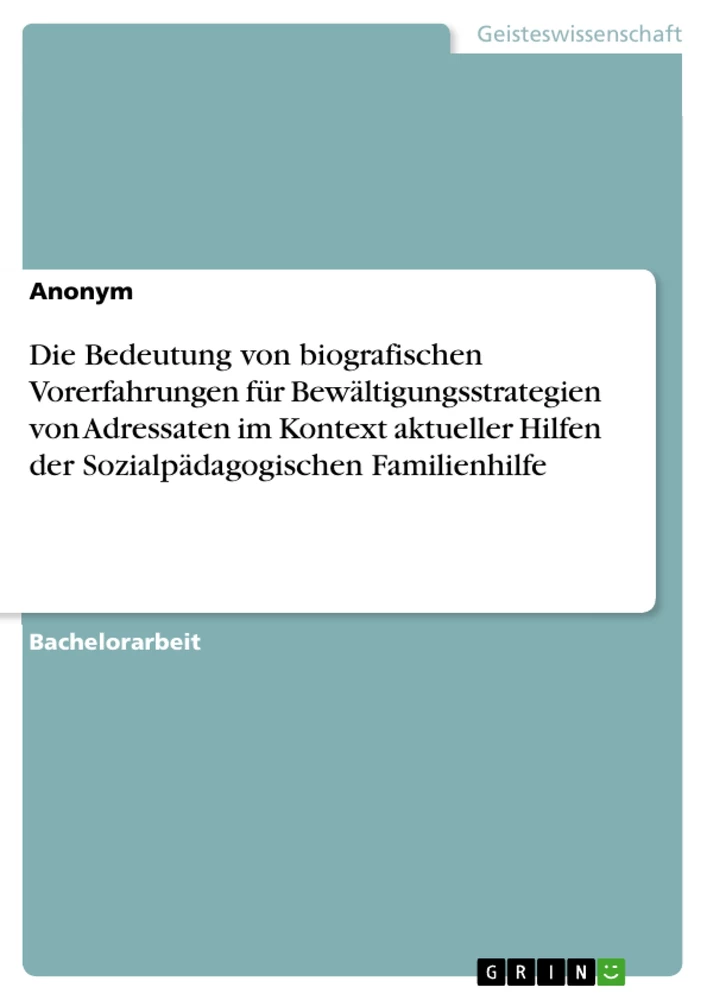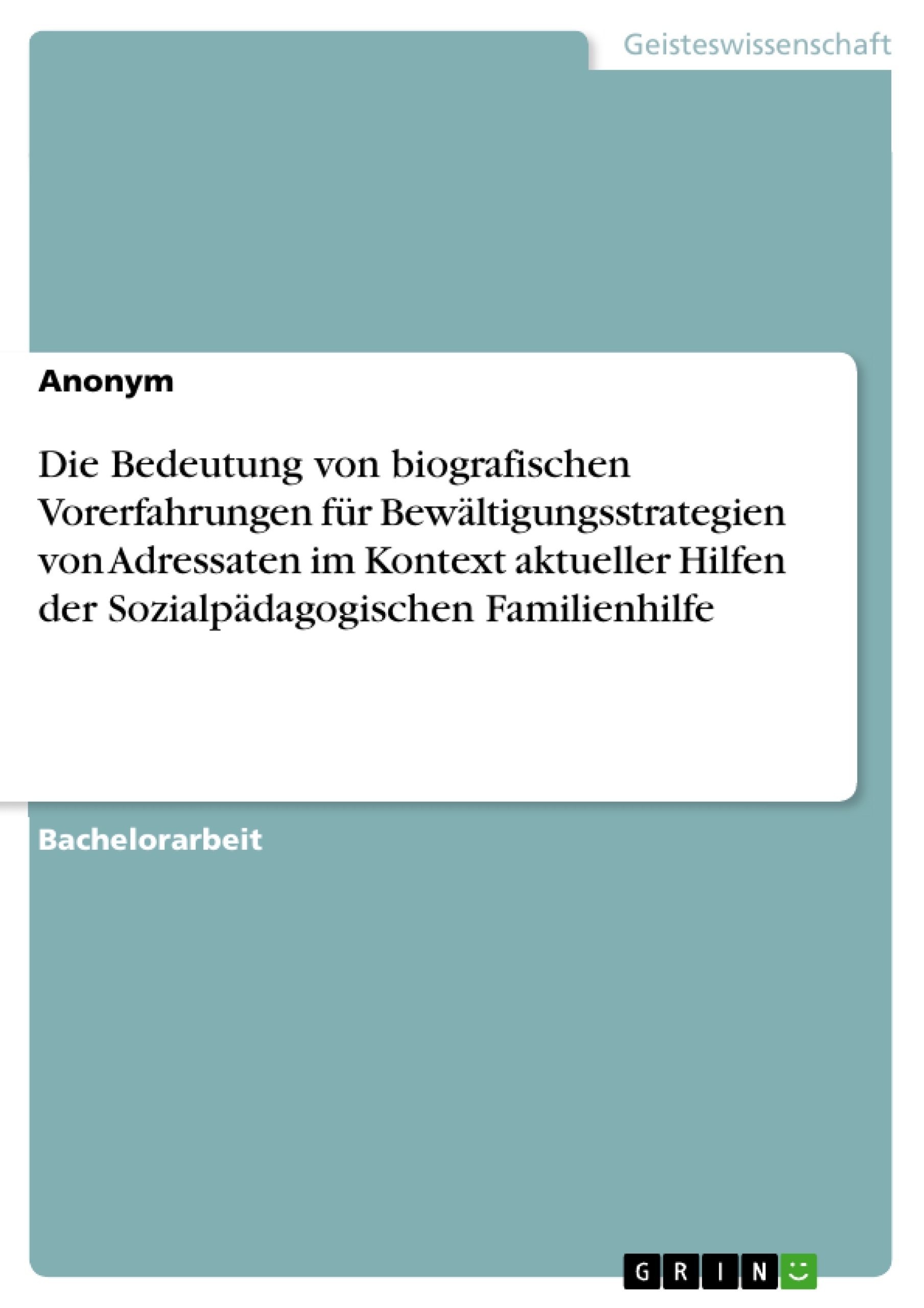Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit folgender Frage: Welche Erfahrungen begünstigen oder vermeiden Abwehrmechanismen der Adressaten in Hilfen der Sozialpädagogischen Familienhilfe?
Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen dieser Untersuchung nicht die Gesamtheit der Thematik aufgezeigt werden kann. Ziel dieser Arbeit soll es sein, eine Form der Auseinandersetzung mit dem Thema der Abwehrhaltung aufzuzeigen, anhand von Erfahrungen von Adressaten, um anschließend einen Ausblick in Bezug auf die Praxis und die weitere Forschung zu ermöglichen.
"Eine Person wird bewältigen, wenn sie kann, abwehren, wenn sie muss, und fragmentieren, wenn sie dazu gezwungen wird."(Haan, Norma 1977, zitiert nach Miethe 2017, S. 40) Im Rahmen des Zitates wird dem Begriff der Abwehr ein schützender Aspekt zugeschrieben. Eine Abwehrhaltung wird in erzieherischen Hilfen häufig eingenommen, dabei ist sie zum einen auf der Seite der Adressaten vorzufinden, aber auch Fachkräfte können sich nicht von inneren Mechanismen und Prozessen der Abwehr freisprechen. Abwehrverhalten kann erzieherische Hilfen in unterschiedlichen Auswirkungen prägen. Es kann sich auf einzelne Themenbereiche beziehen oder bis zur Ablehnung der vollständigen Maßnahme und somit zum Abbruch führen. Abwehr wird daher häufig als Hemmnis für zielführende Prozesse innerhalb der Hilfen gesehen. Hieraus lässt sich die Frage nach den Beweggründen für solche Verhaltensweisen ableiten. Wie das eingangs genannte Zitat aufzeigt, finden sich Adressaten auch innerhalb von Zwangskontexten oder nicht funktionierenden Hilfeprozessen wieder, die sich auf Verhaltensweisen, die Wahrnehmung des Selbst und Sinnzuschreibungen auswirken können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Vorgehensweise
- 2 Theoretischer Rahmen
- 2.1 Die Sozialpädagogische Familienhilfe
- 2.2 Abwehr als Verhaltensweise und Bewältigungsstrategie
- 3 Empirische Teil
- 3.1 Methodisches Vorgehen
- 3.1.1 Das narrative Interview
- 3.1.2 Durchführung der Interviews
- 3.1.3 Auswertung der Interviews
- 3.2 Analyse der Interviews
- 3.2.1 Interview mit Sabrina
- 3.2.2 Interview mit Nadine
- 3.3 Teilergebnisse der Interviews
- 3.3.1 Das Interview als Möglichkeit der Wiedergutmachung
- 3.3.2 Das Interview als Möglichkeit der Selbsterklärung
- 3.3.3 Das Interview als Vertreterin
- 3.4 Interpretation der Ergebnisse
- 4 Abschließende Betrachtung unter Bezug theoretischer Ansätze
- 4.1 Biografie-Begriff in der Sozialen Arbeit
- 4.1.1 Biografische Erfahrungen und Wirkungen
- 4.2 Motivation der Adressaten
- 4.2.1 Die Bedeutung der intrinsischen Motivation
- 4.3 Schlussfolgerungen für Abwehrmechanismen von Adressaten im Kontext der Sozialpädagogischen Familienhilfe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung biografischer Vorerfahrungen für Bewältigungsstrategien und Abwehrmechanismen von Adressaten in der Sozialpädagogischen Familienhilfe. Ziel ist es, Erfahrungen zu identifizieren, die Abwehr begünstigen oder vermeiden. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von narrativen Interviews, um ein tieferes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Biografie, Bewältigung und Abwehrverhalten zu entwickeln. Die Ergebnisse sollen einen Ausblick für die Praxis und die weitere Forschung ermöglichen.
- Der Einfluss biografischer Erfahrungen auf Abwehrmechanismen in der Sozialpädagogischen Familienhilfe.
- Die Rolle von Bewältigungsstrategien im Umgang mit Herausforderungen im Kontext der Familienhilfe.
- Analyse von Abwehrverhalten als Reaktion auf erzieherische Hilfen.
- Die Bedeutung der intrinsischen Motivation der Adressaten.
- Implikationen für die Praxis und zukünftige Forschung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Abwehrmechanismen von Adressaten in der Sozialpädagogischen Familienhilfe ein. Sie beleuchtet die Relevanz des Themas vor dem Hintergrund steigender Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen und formuliert die zentrale Forschungsfrage: Welche Erfahrungen begünstigen oder vermeiden Abwehrmechanismen der Adressaten in Hilfen der Sozialpädagogischen Familienhilfe? Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die gewählte methodische Vorgehensweise.
2 Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Hintergrund der Arbeit. Es beschreibt die Sozialpädagogische Familienhilfe und beleuchtet das Konzept der Abwehr als Verhaltensweise und Bewältigungsstrategie. Es werden theoretische Ansätze zur Lebensbewältigung und die Bedeutung von biografischen Erfahrungen im Kontext sozialer Arbeit diskutiert, um ein Verständnis für die Entstehung und die Auswirkungen von Abwehrmechanismen zu schaffen.
3 Empirische Teil: Das Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung. Es erläutert die Methode des narrativen Interviews, die Durchführung und Auswertung der Interviews mit zwei Adressaten (Sabrina und Nadine). Es werden Teilergebnisse präsentiert, die die Interviews als Möglichkeiten der Wiedergutmachung, Selbsterklärung und Vertretung darstellen. Die Ergebnisse werden interpretiert und für die weitere Analyse aufbereitet.
4 Abschließende Betrachtung unter Bezug theoretischer Ansätze: In diesem Kapitel werden die empirischen Ergebnisse im Lichte der theoretischen Konzepte aus Kapitel 2 diskutiert. Der Fokus liegt auf dem Biografie-Begriff in der Sozialen Arbeit und der Bedeutung biografischer Erfahrungen sowie der Rolle der intrinsischen Motivation der Adressaten. Die Schlussfolgerungen geben einen Ausblick auf Implikationen für die Praxis und zukünftige Forschung im Bereich Abwehrmechanismen innerhalb der Sozialpädagogischen Familienhilfe.
Schlüsselwörter
Sozialpädagogische Familienhilfe, Abwehrmechanismen, Bewältigungsstrategien, biografische Erfahrungen, narrative Interviews, intrinsische Motivation, Lebensbewältigung, Risikogesellschaft, erzieherische Hilfen.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Abwehrmechanismen von Adressaten in der Sozialpädagogischen Familienhilfe
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Einfluss biografischer Vorerfahrungen auf die Bewältigungsstrategien und Abwehrmechanismen von Adressaten in der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH). Das zentrale Forschungsinteresse liegt darin, Erfahrungen zu identifizieren, die Abwehrmechanismen entweder begünstigen oder vermeiden.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse narrativer Interviews mit zwei Adressaten (Sabrina und Nadine). Die Methode des narrativen Interviews wurde gewählt, um ein tiefes Verständnis der Zusammenhänge zwischen Biografie, Bewältigung und Abwehrverhalten zu ermöglichen.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Erfahrungen begünstigen oder vermeiden Abwehrmechanismen der Adressaten in Hilfen der Sozialpädagogischen Familienhilfe? Nebenfragen befassen sich mit dem Einfluss biografischer Erfahrungen auf Abwehrmechanismen in der SPFH, der Rolle von Bewältigungsstrategien, der Analyse von Abwehrverhalten als Reaktion auf erzieherische Hilfen und der Bedeutung der intrinsischen Motivation der Adressaten.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf theoretische Ansätze zur Sozialpädagogischen Familienhilfe, zum Konzept der Abwehr als Verhaltensweise und Bewältigungsstrategie sowie auf Theorien zur Lebensbewältigung und zur Bedeutung biografischer Erfahrungen im Kontext sozialer Arbeit. Der Biografie-Begriff in der Sozialen Arbeit spielt eine zentrale Rolle.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Rahmen, einen empirischen Teil und eine abschließende Betrachtung. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Forschungsfrage und die Methodik. Der theoretische Rahmen liefert den konzeptionellen Hintergrund. Der empirische Teil präsentiert die Ergebnisse der narrativen Interviews, einschließlich der Auswertung und Interpretation. Die abschließende Betrachtung diskutiert die Ergebnisse im Lichte der theoretischen Ansätze und zieht Schlussfolgerungen für die Praxis und die Forschung.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Interviews wurden als Möglichkeiten der Wiedergutmachung, Selbsterklärung und Vertretung interpretiert. Die Ergebnisse zeigen Zusammenhänge zwischen biografischen Erfahrungen, Bewältigungsstrategien und Abwehrmechanismen auf. Die Bedeutung der intrinsischen Motivation der Adressaten wird hervorgehoben. Konkrete Ergebnisse sind im Detail im empirischen Teil der Arbeit dargestellt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen geben einen Ausblick auf Implikationen für die Praxis der Sozialpädagogischen Familienhilfe und für zukünftige Forschung im Bereich Abwehrmechanismen. Die Arbeit betont die Bedeutung der Berücksichtigung biografischer Erfahrungen und der Förderung intrinsischer Motivation bei der Arbeit mit Adressaten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Sozialpädagogische Familienhilfe, Abwehrmechanismen, Bewältigungsstrategien, biografische Erfahrungen, narrative Interviews, intrinsische Motivation, Lebensbewältigung, Risikogesellschaft, erzieherische Hilfen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Die Bedeutung von biografischen Vorerfahrungen für Bewältigungsstrategien von Adressaten im Kontext aktueller Hilfen der Sozialpädagogischen Familienhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/909172