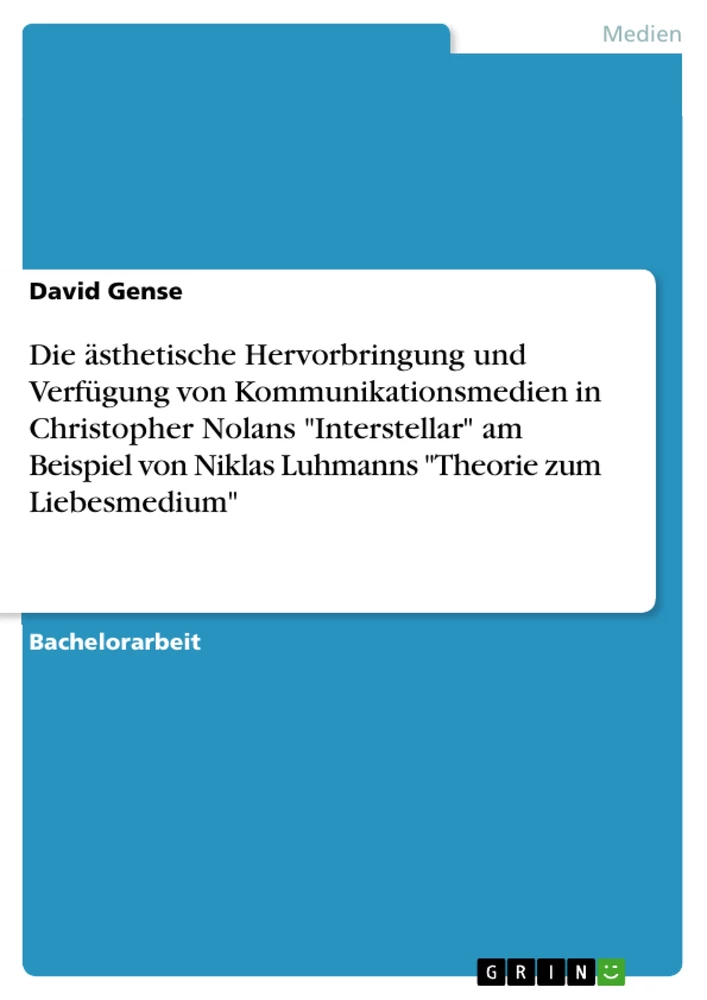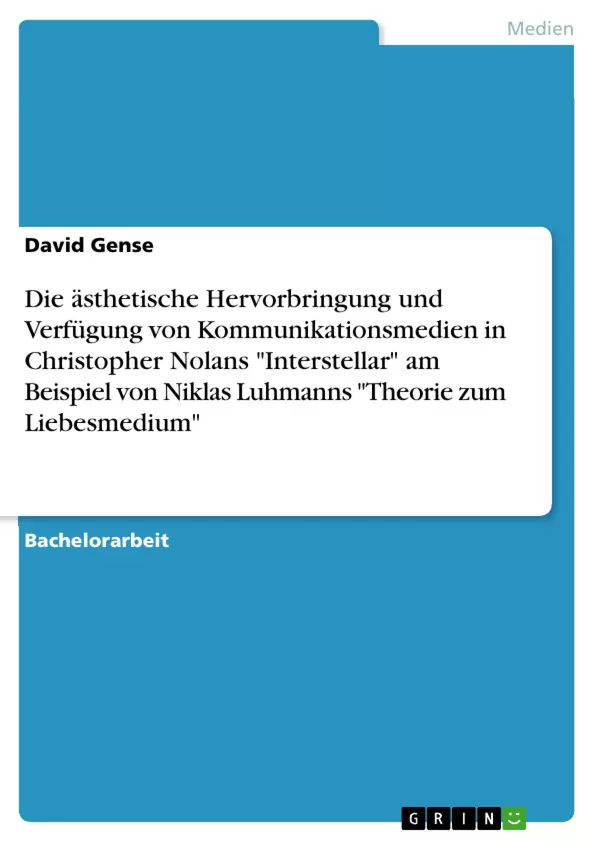Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem grundlegenden Theorem des Bielefelder Soziologen Niklas Luhmann: Kommunikation ist unwahrscheinlich, durch Medien wird sie wahrscheinlicher. Ganz abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit, lebend in einem schwarzen Loch in die Vergangenheit zu kommunizieren, befindet sich Cooper räumlich und zeitlich so weit entfernt von Murph, dass eine erfolgreiche Kommunikation selbst mit technischen Hilfsmitteln aussichtslos erscheint. Doch was Cooper hier als Lösung andeutet, ist nicht allein das Fatum der Liebe, sondern vor allem dessen mediale Bewandtnis, durch die sie seine Botschaft trotz der Hürden erhält. Wie das in "Interstellar" auf ästhetische Weise gelöst wird, lege ich in dieser Arbeit dar.
Als Bezugstheorie dient mir jene der symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien Luhmanns, bei der ich dessen populär gewordene Ausprägung zum Liebesmedium herausgreife. Allerdings lasse ich die kulturell hervorgebrachte Liebessemantik der Passion – jene, die Luhmann in Paarbeziehungen ausmacht – beiseite, dies zum einen.
Zum anderen gehe ich vorwiegend auf die Grundlegung in den sogenannten organischen Letztgarantien, ihrer symbiotischen Bewandtnis wie auch interaktionellen Bezugnahme ein. Unter Zuhilfenahme dieses Instrumentariums zeige ich auf, wie Interstellar Cooper und Murph über weite Strecken auf poetische Weise miteinander verbindet. Dabei wird im gleichen Zuge ein Medium hervorgebracht, das sich dem Selbsterhalt widmet und anschließend jenes der Liebe enthüllt.
Eine Besonderheit dabei ist, dass es hier entgegen der literarischen Untersuchungen Luhmanns nicht um Liebespaare innerhalb einer komplexer werdenden und funktional differenzierten Gesellschaft geht, sondern um eine Eltern-Kind-Beziehung, die sich der Herausforderung einer ungewiss langen Trennung durch eine nahende Existenzbedrohung stellt. Dies stellt die Theorie vor Fragen der angemessenen Adaption, doch darauf gehe ich am Ende der nachfolgenden system- und kommunikationstheoretischen Erklärungen zu Luhmann ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Liebe als quantifizierbare Verbindung
- Die Liebe als Kommunikationscode
- Theoretischer Rahmen
- Wie ist soziale Ordnung möglich?
- Wie ist Kommunikation möglich?
- Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien
- Das Medium der Liebe
- Das Medium der Liebe zwischen Eltern und Kind
- Die Kommunikationsmedien in Interstellar
- Die symbiotische Nähe
- Die erzwungene Referenzebene
- Das Medium des Selbsterhalts wird sichtbar
- Das Liebesmedium
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der ästhetischen Hervorbringung und Verfügung von Kommunikationsmedien in Christopher Nolans Science-Fiction-Film Interstellar. Im Fokus steht dabei die Analyse der Beziehung zwischen dem Protagonisten Cooper und seiner Tochter Murph im Kontext der Theorie des Liebesmediums von Niklas Luhmann. Die Arbeit untersucht, wie die Liebe als Kommunikationscode funktioniert und wie sie trotz räumlicher und zeitlicher Distanz eine Verbindung zwischen den beiden Figuren ermöglicht.
- Die Liebe als quantifizierbares Medium in der Kommunikation
- Luhmanns Theorie der symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien
- Die Darstellung des Liebesmediums in Interstellar
- Die Verbindung von Liebe und Selbsterhalt in Interstellar
- Die Adaption der Theorie von Luhmann auf die Eltern-Kind-Beziehung in Interstellar
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die zentrale These vor, dass die Liebe in Interstellar als quantifizierbares Medium der Kommunikation dargestellt wird. Es werden die Beziehung zwischen Cooper und Murph sowie die Relevanz von Nolans Film im Kontext der menschlichen Zukunftsängste beschrieben.
- Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel erläutert die grundlegenden Elemente der Theorie der symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien von Niklas Luhmann, insbesondere im Hinblick auf das Medium der Liebe. Es wird die Frage nach der sozialen Ordnung und der Möglichkeit von Kommunikation im Kontext der Theorie Luhmanns diskutiert.
- Die Kommunikationsmedien in Interstellar: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von verschiedenen Kommunikationsmedien in Interstellar, darunter die symbiotische Nähe, die erzwungene Referenzebene, das Medium des Selbsterhalts und das Liebesmedium. Es wird gezeigt, wie diese Medien die Beziehung zwischen Cooper und Murph beeinflussen und gestalten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Kommunikation, Liebe, symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien, Niklas Luhmann, Interstellar, Christopher Nolan, Eltern-Kind-Beziehung, Science-Fiction, ästhetische Hervorbringung, mediale Bewandtnis und Selbsterhalt.
Häufig gestellte Fragen
Wie wendet die Arbeit Luhmanns Theorie auf „Interstellar“ an?
Die Arbeit analysiert die Liebe zwischen Cooper und Murph als ein „symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium“, das Kommunikation über Raum und Zeit hinweg erst möglich macht.
Was bedeutet „Liebe als Kommunikationscode“?
Nach Luhmann ist Liebe ein Code, der die Unwahrscheinlichkeit von Kommunikation überwindet, indem er eine tiefe interaktionelle Bezugnahme zwischen zwei Personen sicherstellt.
Warum ist die Eltern-Kind-Beziehung in diesem Kontext besonders?
Luhmann konzentrierte sich meist auf Paarbeziehungen. Der Film zeigt jedoch, wie der Code der Liebe auch in einer existenziell bedrohten Eltern-Kind-Beziehung als „Letztgarantie“ funktioniert.
Was ist das „Medium des Selbsterhalts“ im Film?
Es beschreibt den Drang der Menschheit und der Individuen zum Überleben, der in „Interstellar“ eng mit dem Liebesmedium verknüpft ist, um die Botschaften aus dem schwarzen Loch zu empfangen.
Ist Kommunikation laut Luhmann unwahrscheinlich?
Ja, Luhmann geht davon aus, dass erfolgreiche Kommunikation aufgrund von Differenzen in Bewusstsein und Raum/Zeit unwahrscheinlich ist und erst durch Medien (wie Sprache oder Liebe) wahrscheinlich gemacht wird.
- Citation du texte
- David Gense (Auteur), 2020, Die ästhetische Hervorbringung und Verfügung von Kommunikationsmedien in Christopher Nolans "Interstellar" am Beispiel von Niklas Luhmanns "Theorie zum Liebesmedium", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/909180