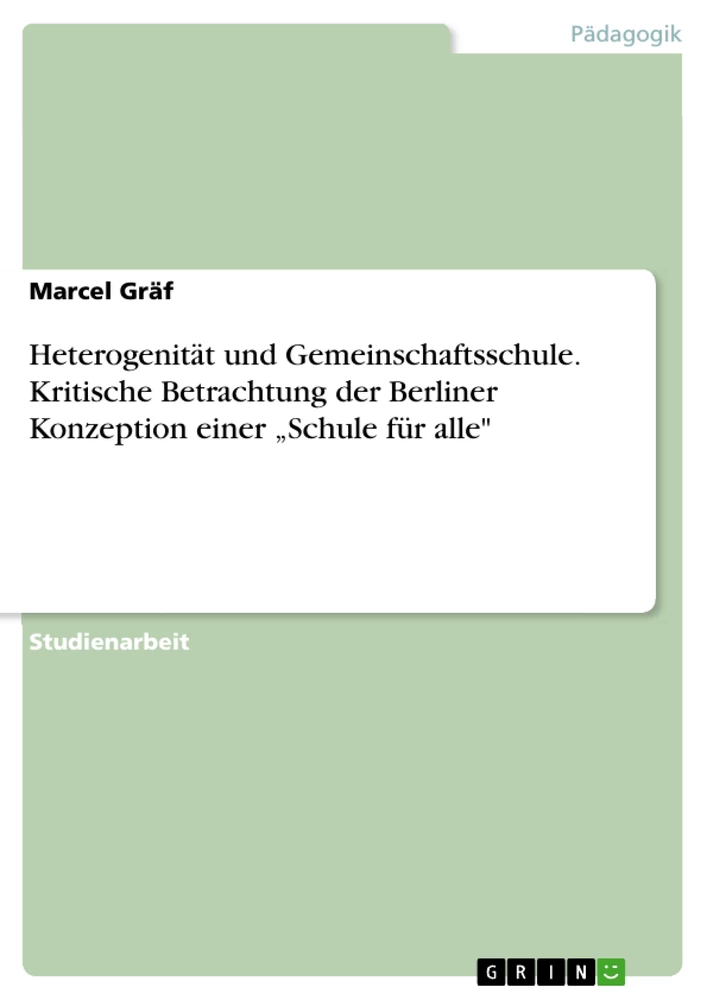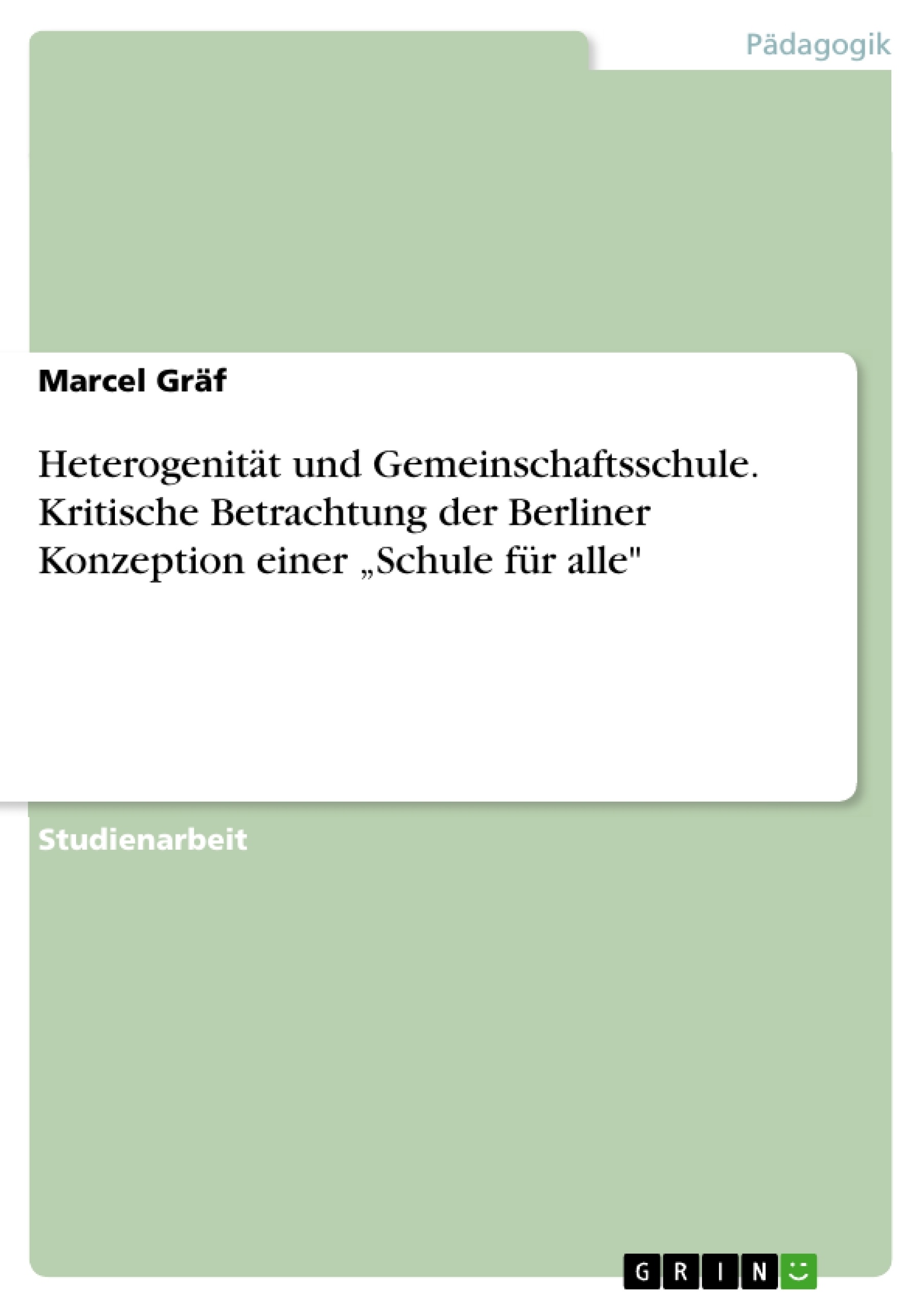Die vorliegende Arbeit stellt entlang verschiedener Dimensionen die heterogene Zusammensetzung der Schülerschaft an den allgemein bildenden Schulen des deutschen Bildungssystems dar und beschreibt Vorstellungen sowie Strategien zur Homogenisierung hinsichtlich der Zusammensetzung von Lerngruppen während der Schulzeit. Die Verwirklichung einer Chancengleichheit in der Bildung durch die Anwendung des Leistungsprinzips sowie die verbreitete Annahme einer Leistungssteigerung einzelner Schülerinnen und Schüler durch eine homogene Organisationsform von Lerngruppen in Schule und Unterricht werden durch den Autor diskutiert und hinterfragt.
Einer historischen Betrachtung der Homogenisierungsbestrebungen im deutschen Bildungswesen schließt sich eine Diskussion über Möglichkeiten an, die mit der Einführung einer Gemeinschaftsschule verbunden sind. Hierbei erfährt schwerpunktmäßig – neben dem schleswig-holsteinischen Modell – die Berliner Konzeption einer Gemeinschaftsschule eine tiefergehende Betrachtung, sowohl hinsichtlich der strukturellen Zwänge im Bildungssystem, die eine derartige Schulform gegenwärtig möglich und nötig werden lassen, sowie bezüglich der Auswirkungen einer „Schule für alle“ auf die Förderung der Bildungschancen unterprivilegierter Schülerinnen und Schüler in einem weiterhin in mehrgliedriger Form fortbestehenden Schulsystem.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärungen
- Heterogenität und Homogenität
- Gemeinschaftsschule
- Dimensionen von Heterogenität im schulischen Kontext
- Soziale Unterschiede
- Geschlechterunterschiede
- Kulturelle und sprachliche Unterschiede
- Unterschiedliche körperliche Voraussetzungen
- Heterogenität und Schule
- Die Konstruktion von Normalität im Kontext von Schule
- Heterogenität und Schule im historischen Abriss
- Heterogenität und Schule in der Gegenwart
- Das Modell der Gemeinschaftsschule
- Hintergründe der Berliner Konzeption einer „Schule für alle“
- Innovation oder Restauration? – Kritische Betrachtung der Berliner Gemeinschaftsschule
- Innere und äußere Grenzen des Modells
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzeption der Gemeinschaftsschule im Berliner Bildungssystem. Sie analysiert die Idee einer „Schule für alle“ im Kontext der Heterogenität der Schülerschaft und den damit verbundenen Herausforderungen und Chancen. Dabei werden sowohl die historischen Wurzeln als auch die aktuelle Debatte um die Gemeinschaftsschule beleuchtet.
- Heterogenität in der Schülerschaft
- Das Konzept der Gemeinschaftsschule
- Kritik an der Berliner Konzeption
- Grenzen des Modells
- Die Rolle von Schule in einer heterogenen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung von Heterogenität und Homogenität im Kontext des deutschen Schulsystems. Es werden die verschiedenen Dimensionen der Heterogenität im schulischen Kontext dargestellt.
Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Beziehung zwischen Heterogenität und Schule. Dabei werden die verschiedenen Phasen der Schulentwicklung und die damit einhergehende Konstruktion von Normalität im schulischen Kontext betrachtet.
Das dritte Kapitel analysiert das Modell der Gemeinschaftsschule, insbesondere die Berliner Konzeption. Es werden die Hintergründe und Ziele der Reform sowie die kritischen Aspekte des Modells diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Heterogenität, Gemeinschaftsschule, Bildungssystem, Berliner Schulreform, Inklusion, Exklusion, Selektion, Normalität, und gesellschaftliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen zu Heterogenität und Gemeinschaftsschule
Was versteht man unter einer "Schule für alle"?
Es beschreibt das Konzept der Gemeinschaftsschule, in der Kinder mit unterschiedlichen Hintergründen und Lernvoraussetzungen länger gemeinsam lernen, um Selektion zu vermeiden.
Welche Dimensionen von Heterogenität gibt es im Schulalltag?
Dazu gehören soziale Unterschiede (Herkunft), Geschlechterunterschiede, kulturelle und sprachliche Vielfalt sowie unterschiedliche körperliche und kognitive Voraussetzungen.
Warum wird die Berliner Gemeinschaftsschule kritisch betrachtet?
Kritiker hinterfragen, ob das Modell innerhalb eines weiterhin mehrgliedrigen Schulsystems tatsächlich Bildungschancen für unterprivilegierte Schüler verbessern kann oder an strukturellen Zwängen scheitert.
Was bedeutet "Homogenisierung" im Bildungswesen?
Es ist das Bestreben, Lerngruppen nach Leistung oder anderen Merkmalen möglichst gleichmäßig zusammenzusetzen, in der Annahme, dass dies die Effektivität des Unterrichts steigert.
Wie hängen Leistungsprinzip und Chancengleichheit zusammen?
Das Leistungsprinzip soll Chancengleichheit sichern, führt aber in der Praxis oft zur Benachteiligung von Kindern aus bildungsfernen Schichten, da Heterogenität oft als Defizit statt als Chance gesehen wird.
- Quote paper
- Marcel Gräf (Author), 2008, Heterogenität und Gemeinschaftsschule. Kritische Betrachtung der Berliner Konzeption einer „Schule für alle", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91104