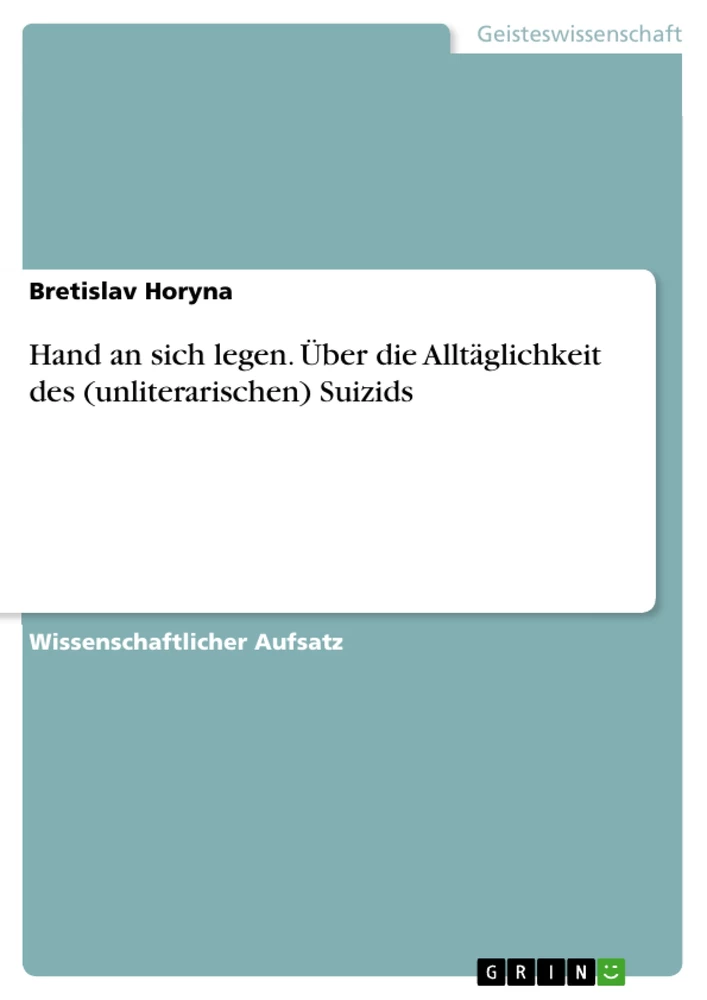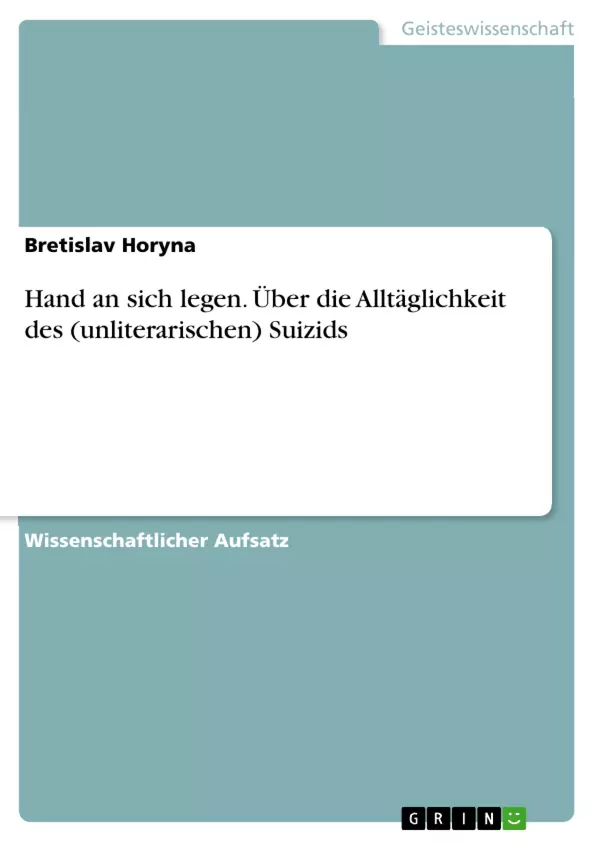Was kann Philosophie zur Selbsttötung sagen und warum sollte sie überhaupt sprechen? Es gibt doch seit langem mehrere wissenschaftliche Disziplinen, die das wissenschaftliche, das heißt objektive Verständnis des Suizids für sich reklamieren: Medizin, Psychologie, Psychiatrie erklären, warum sich Menschen das Leben nehmen; die meist in dem suizidologischen Zusammenhang genannte Soziologie stellt die Suizidraten bei verschiedenen Populationen, Kulturen, Altersgruppen, Geschlechtern und so weiter fest. Die Soziologie kann schon ihrem Wesen nach nicht von Individuen, sondern nur von Kollektiven sprechen; so kann man aus den Aberhunderten von Tabellen und grafischen Darstellungen leicht erfahren, dass sich beispielsweise die verheirateten erheblich seltener als die ledigen Männer entleiben – das sagt die soziologisch-suizidale Vernunft, obwohl es offensichtlich ist, dass es, sollte es umgekehrt sein, viel verständlicher wäre. Es war die Soziologie, die aus dem Selbstmord eine pathologisch kulturelle Erscheinung gemacht hat; der Begründer moderner Suizidologie, Emile Durkheim (Le Suicide, 1897), hat von einer „kollektiven Krankheit der Menschen“ gesprochen, obwohl damals wie heute der Soziologie keine Methodologie zur Verfügung gestanden hat, die es ermöglichen würde, den Selbstmord als krankhaft, pathologisch, verwerflich, gestört oder gar deviant zu deuten.
Inhaltsverzeichnis
- Fragen
- Wie ist rationale Selbstmordbegründung möglich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Artikel liefert eine kritische Auseinandersetzung mit der Art und Weise, wie Suizide behandelt werden. Er untersucht soziologische Positionen und statistische Erkenntnisse sowie die Entwicklung einer noetischen Perspektive auf Selbstmord anhand historisch-philosophischer Erklärungen und aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen, wie z. B. der aufkommenden Debatte über die Euthanasie.
- Rationalisierung von Suizid - Rechtfertigung von Selbstmord
- Handlungsfreiheit - Kompetenz zur Verhandlung
- Suizid als pathologisches Phänomen - Legitimität von Selbstmord
- Eigenes Leben nehmen = Mord?
- Nachahmung von Suizidverhalten - Einfluss von Literatur und Medien, Werther-Effekt, Gleichstellung von Minderheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Fragen
Der Text beginnt mit der Frage, was die Philosophie zur Selbsttötung sagen kann und warum sie überhaupt sprechen sollte. Er stellt fest, dass es bereits mehrere wissenschaftliche Disziplinen gibt, die ein wissenschaftliches Verständnis des Suizids für sich beanspruchen, wie Medizin, Psychologie und Psychiatrie, die erklären, warum Menschen sich das Leben nehmen. Die Soziologie, die im Kontext der Suizidologie häufig erwähnt wird, ermittelt die Suizidraten in verschiedenen Populationen, Kulturen, Altersgruppen und Geschlechtern. Die Soziologie kann aufgrund ihres Wesens jedoch nicht von Individuen, sondern nur von Kollektiven sprechen. Aus den zahlreichen Tabellen und grafischen Darstellungen lässt sich ableiten, dass beispielsweise verheiratete Männer deutlich seltener Selbstmord begehen als unverheiratete - so lautet die soziologische Vernunft, obwohl es viel verständlicher wäre, wenn es umgekehrt wäre. Die Soziologie hat den Selbstmord zu einer pathologisch-kulturellen Erscheinung gemacht. Der Begründer der modernen Suizidologie, Emile Durkheim (Le Suicide, 1897), sprach von einer „kollektiven Krankheit der Menschen“, obwohl der Soziologie damals wie heute keine Methodik zur Verfügung stand, die es erlauben würde, Selbstmord als krankhaft, pathologisch, verwerflich, gestört oder gar deviant zu deuten. Durkheim beschritt jedoch einen schicksalhaften Weg: Er betrachtete den Selbstmord als soziale, nicht wesentlich individuelle Erscheinung, die in allen denkbaren Formen und Typen (Durkheim unterscheidet vier Typen von Selbsttötung) den gemeinsamen Nenner in der sog. Anomie hat. Damit begann, was sich noch heute beobachten lässt: Weil „Anomie“ ein Zustand ohne verbindliche Regeln, Gesetze und Normen ist (griech. a voμoσ), die dem Einzelnen Halt bieten und ihn so vor im Endeffekt absoluter Desorientierung schützen könnten, ist es zur gesellschaftlich-moralischen Pflicht geworden, gegen jede nur noch so potentielle Anomie hart anzugreifen.
Wie ist rationale Selbstmordbegründung möglich
Der Text stellt die Frage, wie eine rationale Selbstmordbegründung möglich ist. Er unterscheidet sich dabei von empirischen Wissenschaften, die sich mit Fragen wie dem Warum von Selbstmorden, der Vereinbarkeit mit moralischen Kriterien und der Prävention von Suizid beschäftigen. Auch Philosophien, die das Sein nur als Sein zum Tode betrachten, tragen nicht zur Beantwortung der Frage nach der Rationalität des Suizids bei. Der Text argumentiert, dass die philosophische Fragestellung den Menschen als Vernunftwesen begreift, das rational handelt, was in diesem Kontext wohlbegründet bedeutet, auch und gerade im Moment der Selbsttötung. Diese Minimalbeschreibung ermöglicht es, Selbstmordwillige als vernünftig handelnde Personen und nicht als kranke oder krankhafte Individuen zu betrachten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen des Textes sind Selbstmord, Rationalisierung von Suizid, Rechtfertigung von Selbstmord, Handlungsfreiheit, Kompetenz zur Verhandlung, Suizid als pathologisches Phänomen, Legitimität von Selbstmord, Eigenes Leben nehmen = Mord, Nachahmung von Suizidverhalten, Einfluss von Literatur und Medien, Werther-Effekt, Gleichstellung von Minderheiten.
Häufig gestellte Fragen
Wie betrachtet die Soziologie das Phänomen Suizid?
Die Soziologie untersucht Suizidraten in Kollektiven und deutet ihn oft als pathologische kulturelle Erscheinung oder soziale Krankheit.
Was bedeutet Durkheims Begriff der „Anomie“?
Anomie beschreibt einen Zustand der Regellosigkeit oder Desorientierung in der Gesellschaft, der laut Durkheim ein Hauptgrund für Selbsttötungen ist.
Kann eine Selbsttötung rational begründet sein?
Die Philosophie diskutiert, ob ein Mensch als Vernunftwesen eine wohlbegründete Entscheidung zum Suizid treffen kann, ohne zwangsläufig als "krank" zu gelten.
Was versteht man unter dem Werther-Effekt?
Es bezeichnet die Zunahme von Suiziden nach der Veröffentlichung von Medienberichten oder literarischen Werken über Selbsttötungen (Nachahmungseffekt).
Was ist die noetische Perspektive auf den Suizid?
Sie betrachtet den Suizid als eine Handlung des Geistes oder der Vernunft und hinterfragt die rein medizinisch-pathologische Deutung.
Warum ist die Suizidrate bei Verheirateten oft niedriger?
Soziologische Studien weisen darauf hin, dass soziale Bindungen und Integration in eine Gemeinschaft (wie die Ehe) eine präventive Wirkung haben können.
- Quote paper
- Bretislav Horyna (Author), 2018, Hand an sich legen. Über die Alltäglichkeit des (unliterarischen) Suizids, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/911355