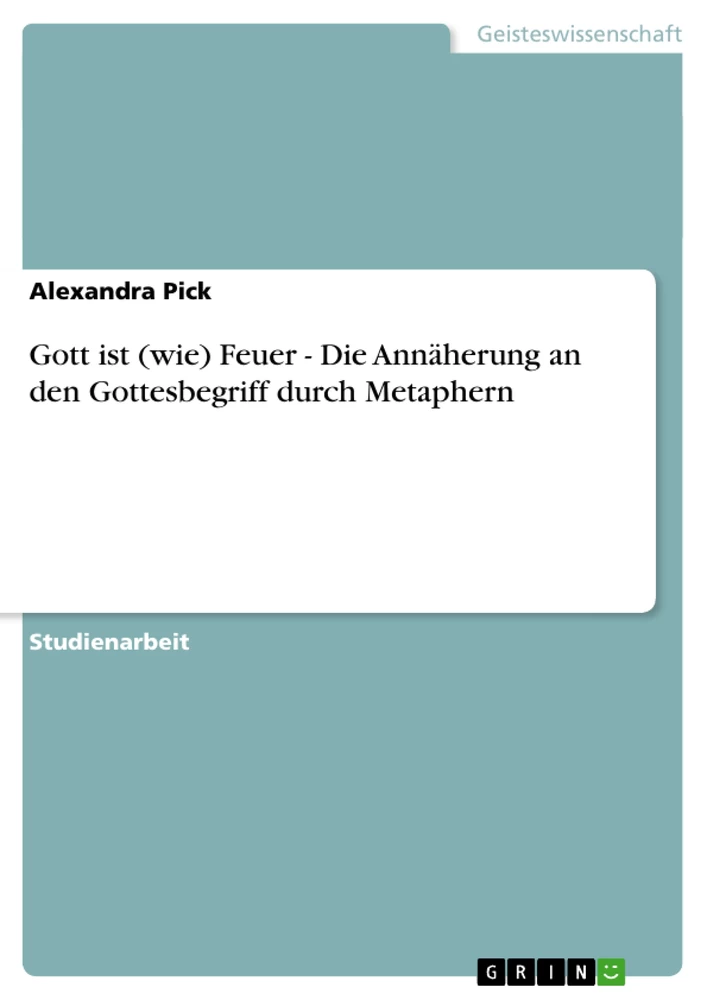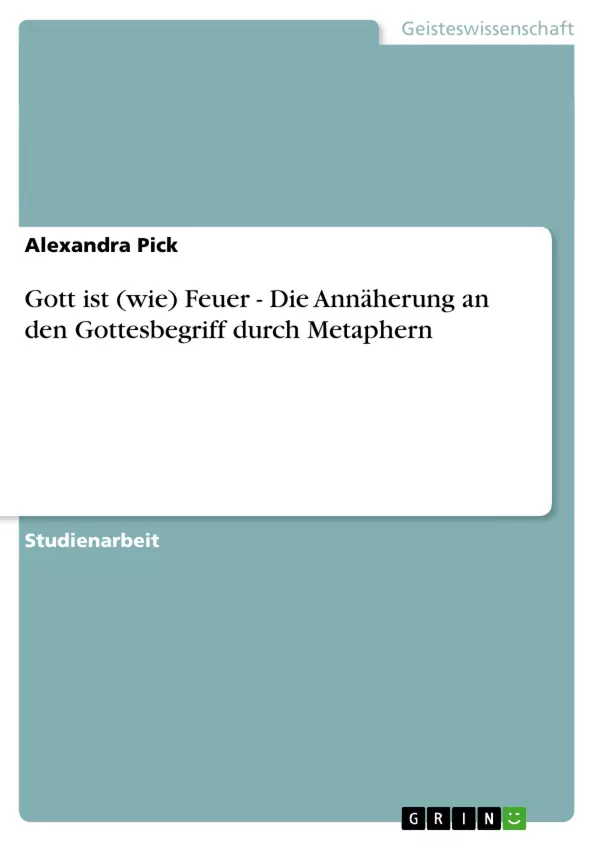Das erste Ziel ist es, den Schülern und Schülerinnen zu ermöglichen eine Beziehung und einen Bezug zu Gott zu finden und herzustellen und ihnen damit einen Weg aufzuzeigen, sich persönlich mit ihrer Religion und ihrem Glauben zu identifizieren. Dazu gehört, dass die SuS ein eigenes Verständnis von Gott aufbauen. Wie aber kann man erklären, was Gott ist? Wie Gott ist? Was er für unser Leben und unseren Alltag bedeutet? Der Gottesbegriff ist abstrakt. Gott ist unfassbar, un“begreiflich“. Unerklärbar. Also muss ein Weg gefunden werden, uns der Bedeutung des Gottesbegriffs anzunähern. Das geht nur über anschauliche Beispiele, über die wir uns dem abstrakten Begriff nähern können. Deshalb brauchen wir Vergleiche und Bilder, um den SuS eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie Gott wirkt.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich Metaphern und Gottesbildern beschäftigen. Vor allem im Hinblick auf den Religionsunterricht möchte ich versuchen zu klären, wozu Metaphern und Gottesbilder notwendig sind und wie sie uns helfen können uns Gott anzunähern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Metapher
- Definitionen
- Gottesbilder
- Warum brauchen wir Bilder von Gott?
- Kann man „Gott“ definieren?
- Was bedeutet „Gott“?
- Verschiedene Gottesbilder in der Bibel
- Metaphern für Gott
- Metaphorische Vergleiche für Gott
- Der semantische Verlust bei Gott-Metaphern nach Jürgen Werbick
- Gott ist (wie) Feuer - ein konkretes Beispiel
- Bibelstellen, in denen von Feuer die Rede ist
- WIE ist Gott, wenn er mit Feuer in Zusammenhang gebracht wird?
- Metaphern im Religionsunterricht
- Wie passen Metaphern in den Bildungsplan?
- Möglichkeiten zur Umsetzung am Beispiel der Feuermetaphern
- Umsetzungsmöglichkeiten nach Andreas Benk
- Unterrichtseinheit „Hl. Geist“ in einer 4. Klasse – ein Unterrichtsbeispiel
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung von Metaphern und Gottesbildern, insbesondere im Kontext des Religionsunterrichts. Das Hauptziel ist es, die Notwendigkeit von Metaphern zur Annäherung an den abstrakten Gottesbegriff zu verdeutlichen und deren praktische Anwendung im Unterricht zu beleuchten. Die Arbeit analysiert verschiedene Definitionen von Metaphern und untersucht deren Funktion im religiösen Diskurs.
- Die Bedeutung von Metaphern für das Verständnis des Gottesbegriffs
- Die Verwendung von Metaphern in der Bibel und deren Interpretation
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten des Einsatzes von Metaphern im Religionsunterricht
- Konkrete Beispiele für die Anwendung von Metaphern im Unterricht (am Beispiel der Feuermetapher)
- Die Bedeutung von Gottesbildern für die religiöse Identität und den Glauben
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel der religiösen Landschaft in Süddeutschland von einer stark geprägten katholischen Kultur hin zu einer multireligiösen und heterogenen Gesellschaft. Sie hebt die Herausforderungen hervor, die sich daraus für die religiöse Erziehung und den Religionsunterricht ergeben, insbesondere die Schwierigkeit, Jugendlichen einen Zugang zu Gott und deren Glauben zu ermöglichen. Die Arbeit fokussiert sich auf die Rolle von Metaphern und Gottesbildern als Werkzeug, um den abstrakten Gottesbegriff greifbarer zu machen.
Die Metapher: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Definitionen der Metapher, sowohl aus lexikalischen Quellen als auch aus der rhetorischen Literatur. Es differenziert zwischen der echten Metapher und dem metaphorischen Vergleich und erläutert die unterschiedlichen Gründe für den Gebrauch von Metaphern, z.B. das Fehlen eines geeigneten Wortes, die Vermeidung anstößiger Ausdrücke oder die Veranschaulichung abstrakter Konzepte. Die Ausführungen betonen die besondere Bedeutung von Metaphern in literarischen und poetischen Kontexten.
Gottesbilder: Dieses Kapitel erörtert die Notwendigkeit von Gottesbildern und deren Rolle im Verständnis von Gott. Es wird die Frage diskutiert, ob Gott definierbar ist und welche Bedeutung verschiedenen Gottesbildern in der Bibel zukommt. Der Fokus liegt auf der Analyse von Metaphern und metaphorischen Vergleichen für Gott in der Bibel sowie auf der Betrachtung des semantischen Verlustes, der bei der Verwendung von Gott-Metaphern auftreten kann. Das Kapitel arbeitet ein konkretes Beispiel mit der Feuermetapher aus.
Metaphern im Religionsunterricht: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Integration von Metaphern in den Religionsunterricht, insbesondere im Hinblick auf den Bildungsplan. Es beleuchtet verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten, u.a. an Hand von Beispielen aus der Praxis, und zeigt auf, wie Metaphern dazu beitragen können, den Schülern einen Zugang zum Glauben zu ermöglichen und ein persönliches Verständnis von Gott zu entwickeln.
Schlüsselwörter
Metapher, Gottesbild, Religionsunterricht, Gottesbegriff, Bibel, Feuermetapher, religiöse Identität, Glaube, Bildungsplan, Jürgen Werbick, Andreas Benk.
Häufig gestellte Fragen zu: Verwendung von Metaphern und Gottesbildern im Religionsunterricht
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verwendung von Metaphern und Gottesbildern, insbesondere im Kontext des Religionsunterrichts. Das Hauptziel ist es, die Notwendigkeit von Metaphern zur Annäherung an den abstrakten Gottesbegriff zu verdeutlichen und deren praktische Anwendung im Unterricht zu beleuchten. Die Arbeit analysiert verschiedene Definitionen von Metaphern und untersucht deren Funktion im religiösen Diskurs.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung von Metaphern für das Verständnis des Gottesbegriffs, die Verwendung von Metaphern in der Bibel und deren Interpretation, die Herausforderungen und Möglichkeiten des Einsatzes von Metaphern im Religionsunterricht, konkrete Beispiele für die Anwendung von Metaphern im Unterricht (am Beispiel der Feuermetapher) und die Bedeutung von Gottesbildern für die religiöse Identität und den Glauben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel über Metaphern, einem Kapitel über Gottesbilder, einem Kapitel über Metaphern im Religionsunterricht und einem Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik, wobei die Kapitel "Gottesbilder" und "Metaphern im Religionsunterricht" besonders ausführlich auf die Verwendung von Metaphern im religiösen Kontext und im Unterricht eingehen.
Welche Definitionen von Metaphern werden verwendet?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Definitionen der Metapher, sowohl aus lexikalischen Quellen als auch aus der rhetorischen Literatur. Es wird zwischen der echten Metapher und dem metaphorischen Vergleich differenziert. Die unterschiedlichen Gründe für den Gebrauch von Metaphern werden erläutert (z.B. das Fehlen eines geeigneten Wortes, die Vermeidung anstößiger Ausdrücke oder die Veranschaulichung abstrakter Konzepte).
Welche Rolle spielen Gottesbilder?
Die Arbeit erörtert die Notwendigkeit von Gottesbildern und deren Rolle im Verständnis von Gott. Es wird die Frage diskutiert, ob Gott definierbar ist und welche Bedeutung verschiedenen Gottesbildern in der Bibel zukommt. Die Analyse von Metaphern und metaphorischen Vergleichen für Gott in der Bibel sowie die Betrachtung des semantischen Verlustes bei der Verwendung von Gott-Metaphern stehen im Fokus.
Wie werden Metaphern im Religionsunterricht eingesetzt?
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Integration von Metaphern in den Religionsunterricht, insbesondere im Hinblick auf den Bildungsplan. Es werden verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten beleuchtet, u.a. an Hand von Beispielen aus der Praxis. Es wird gezeigt, wie Metaphern dazu beitragen können, den Schülern einen Zugang zum Glauben zu ermöglichen und ein persönliches Verständnis von Gott zu entwickeln. Ein konkretes Unterrichtsbeispiel (Hl. Geist in einer 4. Klasse) wird vorgestellt.
Welche konkreten Beispiele werden verwendet?
Die Arbeit verwendet die Feuermetapher als konkretes Beispiel, um die Anwendung von Metaphern im Kontext von Gottesbildern und im Religionsunterricht zu veranschaulichen. Es werden Bibelstellen analysiert, in denen von Feuer die Rede ist, und es wird untersucht, welche Bedeutung diesem Bild im Zusammenhang mit Gott zukommt.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Arbeit zitiert u.a. Jürgen Werbick (im Zusammenhang mit dem semantischen Verlust bei Gott-Metaphern) und Andreas Benk (bezüglich der Umsetzungsmöglichkeiten von Metaphern im Religionsunterricht).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Metapher, Gottesbild, Religionsunterricht, Gottesbegriff, Bibel, Feuermetapher, religiöse Identität, Glaube, Bildungsplan, Jürgen Werbick, Andreas Benk.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich mit der religiösen Bildung, dem Religionsunterricht und der Verwendung von Metaphern im religiösen Kontext auseinandersetzen. Sie ist insbesondere relevant für Lehrerinnen und Lehrer des Religionsunterrichts, Theologiestudentinnen und -studenten sowie alle, die sich für die didaktische Umsetzung von religiösen Inhalten interessieren.
- Quote paper
- Alexandra Pick (Author), 2008, Gott ist (wie) Feuer - Die Annäherung an den Gottesbegriff durch Metaphern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91140