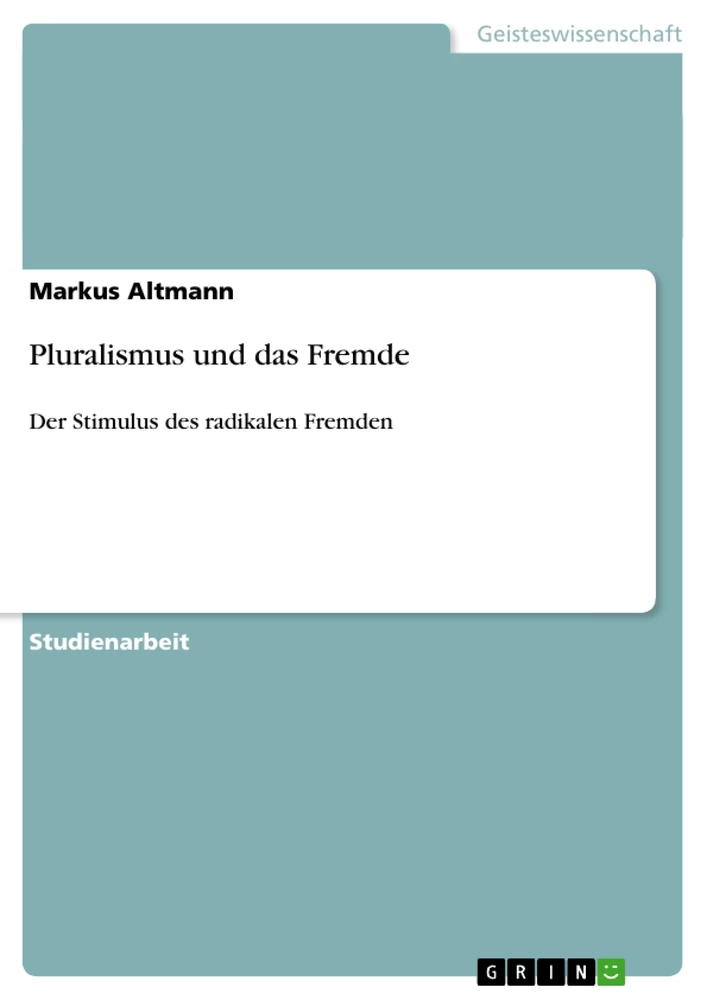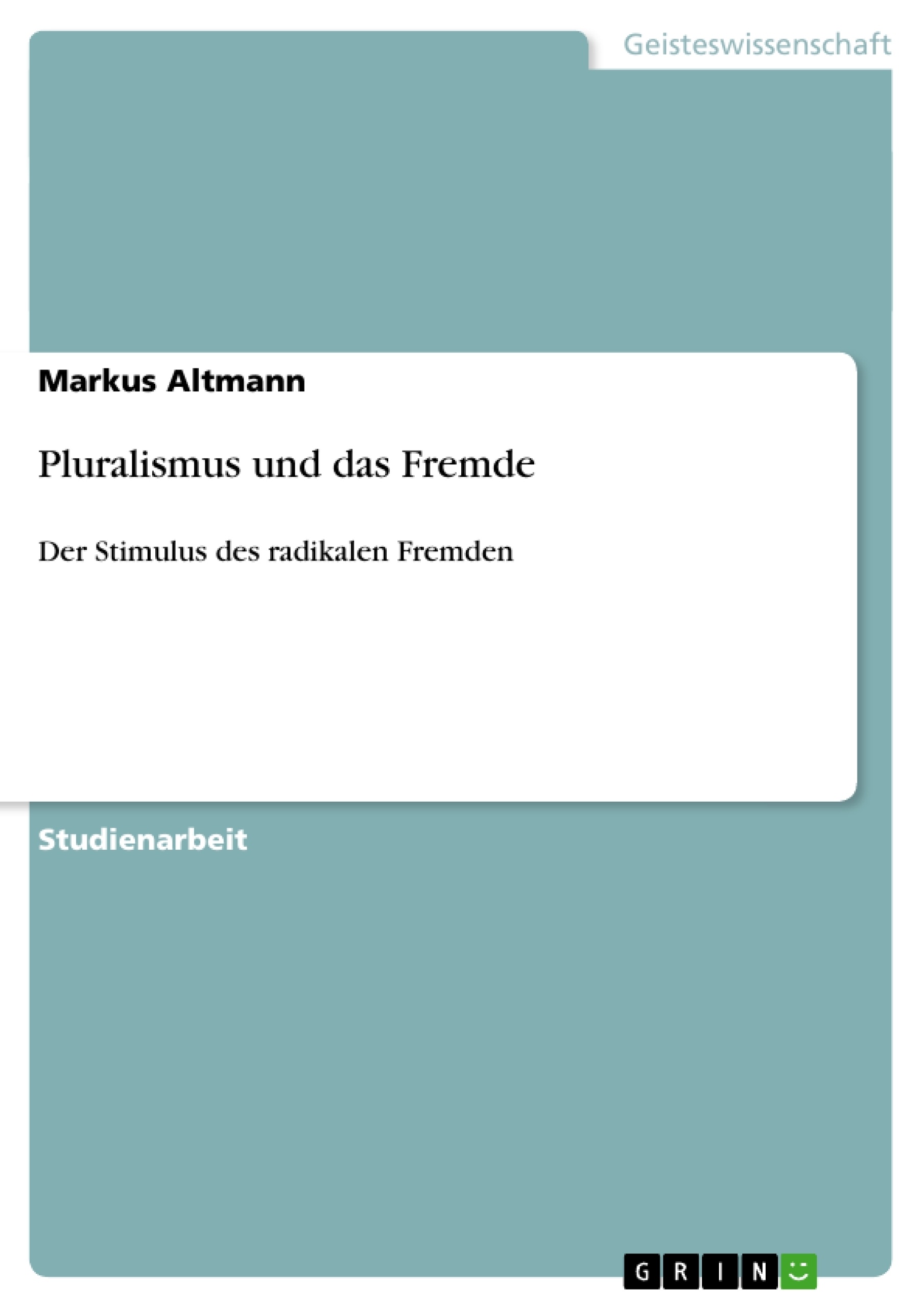Durch den kürzlich entfachten Streit, um die Mohammed-Karikaturen wurde der westlichen, von der Aufklärung geprägten Gesellschaft erneut vor Augen geführt, mit welcher Brisanz das Thema Religion in das 21. Jahrhundert hineindrängt. In einer Zeit, in der nicht gerade wenige Menschen Gott bereits für tot erklärt haben1, sollte der von Papst Johannes Paul II. in Assisi begonnene interreligiöse Dialog mit derselbigen Intensität weitergeführt werden, mit der er seinerzeit begonnen hat. Denn auch nach dem Ableben des Papstes besteht der innige Wunsch der Menschheit immer noch darin, in Frieden miteinander leben zu können. Insoweit sollte es das Bestreben aller Religionen sein, den interreligiösen Dialog zur höchsten Priorität avancieren zu lassen, denn wie Jonathan Sacks treffend formulierte: Wenn die Religionen nicht Teil der Lösung unserer Probleme werden, dann werden sie zweifellos ein Teil dieser Probleme sein.
Um der Forderung nach Frieden gerecht zu werden und in der religiösen Vielfalt kein zu überwindendes Übel, „sondern eine Chance zur wechselseitigen Bereicherung und zum gemeinsamen spirituellen Wachstum“ zu sehen, bedarf es schlussendlich einer pluralistischen Sichtweise.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Fremde und das Eigene
- In der Historie
- In der Moderne
- Der Anspruch des Fremden
- Das Antworten auf den Anspruch des Fremden
- Der Glaube an eine transzendente Wirklichkeit
- Der Begriff der transzendenten Wirklichkeit
- Die höchste Wirklichkeit und das Heil des Menschen
- Die Unbegreiflichkeit der transzendenten Wirklichkeit
- Die Konsequenzen
- Die Offenbarung und religiöse Erfahrung
- Die religiöse Rede über Gott
- Die Erfahrung der Offenbarung
- Jesus als Heilsmittler
- Inkarnation als Grundzug göttlicher Immanenz
- Die Möglichkeit zur wechselseitigen Bereicherung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Rolle der pluralistischen Religionstheologie im interreligiösen Diskurs. Sie argumentiert, dass die pluralistische Religionstheologie aufgrund ihrer Fähigkeit, die verschiedenen Religionen zu verstehen und zu würdigen, eine wichtige Vermittlerrolle im interreligiösen Diskurs einnehmen kann. Darüber hinaus wird die These vom "radikalen Fremden" in die Überlegungen einbezogen, um das Potential der pluralistischen Religionstheologie weiter auszuschöpfen.
- Der Begriff der Fremdheit und seine philosophische Analyse
- Die Suche nach einer theologischen Hermeneutik, die mit verschiedenen Religionen vereinbar ist
- Die Rolle der Inkarnation im interreligiösen Kontext
- Das Potential des Pluralismus für die wechselseitige Bereicherung und das gemeinsame spirituelle Wachstum
- Die Bedeutung des interreligiösen Dialogs in einer Welt religiöser Vielfalt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des interreligiösen Dialogs im 21. Jahrhundert, insbesondere angesichts des wachsenden religiösen Pluralismus und des Streits um die Mohammed-Karikaturen. Sie betont die Bedeutung einer pluralistischen Sichtweise, um die religiöse Vielfalt als Chance zur wechselseitigen Bereicherung zu begreifen.
Das Fremde und das Eigene
Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Begriffs der Fremdheit in der Geschichte und in der Moderne. Es wird deutlich, dass das Fremde im Laufe der Zeit eine zunehmend problematische Stellung im westlichen Denken einnimmt und die etablierten Ordnungen in Frage stellt. Das Fremde als "radikal Fremdes" kann nicht assimiliert werden und stellt das Selbst in seiner Eigenheit in Frage.
Der Glaube an eine transzendente Wirklichkeit
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der transzendenten Wirklichkeit und ihrer Bedeutung für den Menschen. Es analysiert die höchste Wirklichkeit und das Heil des Menschen, die Unbegreiflichkeit der transzendenten Wirklichkeit und die daraus resultierenden Konsequenzen.
Die Offenbarung und religiöse Erfahrung
Dieses Kapitel analysiert die religiöse Rede über Gott, die Erfahrung der Offenbarung und die Rolle von Jesus als Heilsmittler. Es behandelt die Inkarnation als Grundzug göttlicher Immanenz und die Möglichkeit einer wechselseitigen Bereicherung zwischen verschiedenen Religionen.
Schlüsselwörter
Interreligiöser Dialog, Pluralismus, Fremdheit, Eigenheit, radikales Fremdes, transzendente Wirklichkeit, Offenbarung, Inkarnation, religiöse Erfahrung, wechselseitige Bereicherung, Religionstheologie, Hermeneutik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der pluralistischen Religionstheologie?
Das Ziel ist es, religiöse Vielfalt als Chance zur wechselseitigen Bereicherung zu begreifen und einen friedlichen interreligiösen Dialog zu fördern.
Was versteht man unter dem "radikalen Fremden"?
Das radikal Fremde bezeichnet Aspekte anderer Kulturen oder Religionen, die nicht einfach assimiliert werden können und das eigene Selbstbild in Frage stellen.
Welche Rolle spielt die Inkarnation im interreligiösen Diskurs?
Die Arbeit untersucht die Inkarnation als Grundzug göttlicher Immanenz und wie dieses Konzept in einer pluralistischen Sichtweise eingeordnet werden kann.
Warum ist der interreligiöse Dialog im 21. Jahrhundert so brisant?
Ereignisse wie der Streit um die Mohammed-Karikaturen zeigen, dass Religionen Teil der Lösung oder Teil des Problems globaler Konflikte sein können.
Was bedeutet "transzendente Wirklichkeit" in diesem Kontext?
Es beschreibt eine höchste, unbegreifliche Wirklichkeit (Gott), auf die sich verschiedene Religionen beziehen, ohne sie vollkommen erfassen zu können.
- Quote paper
- Markus Altmann (Author), 2006, Pluralismus und das Fremde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91187