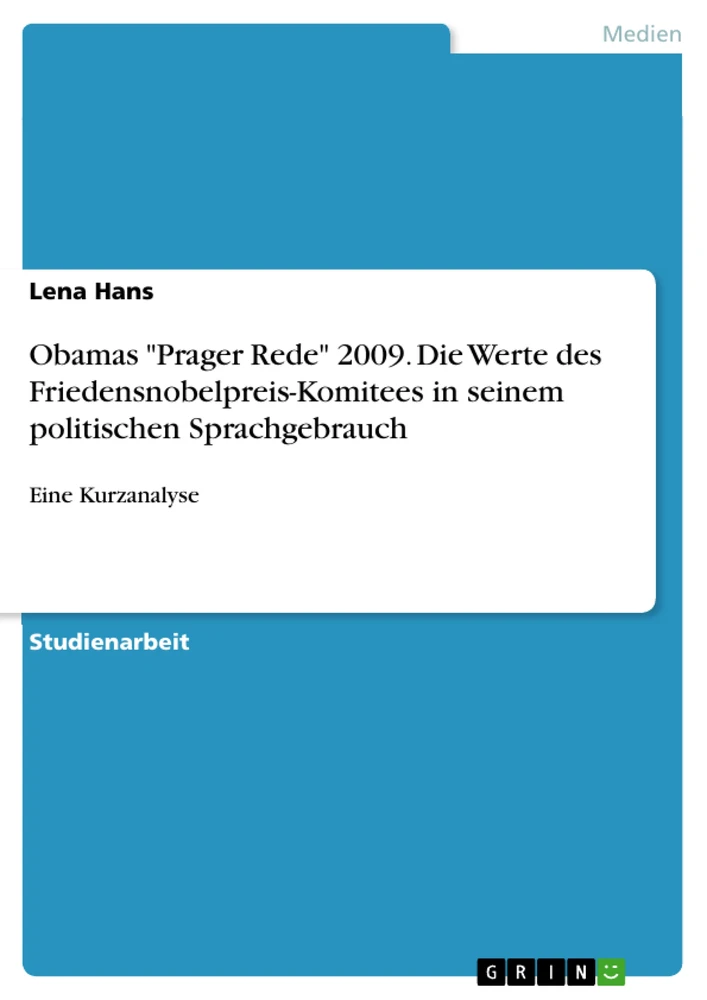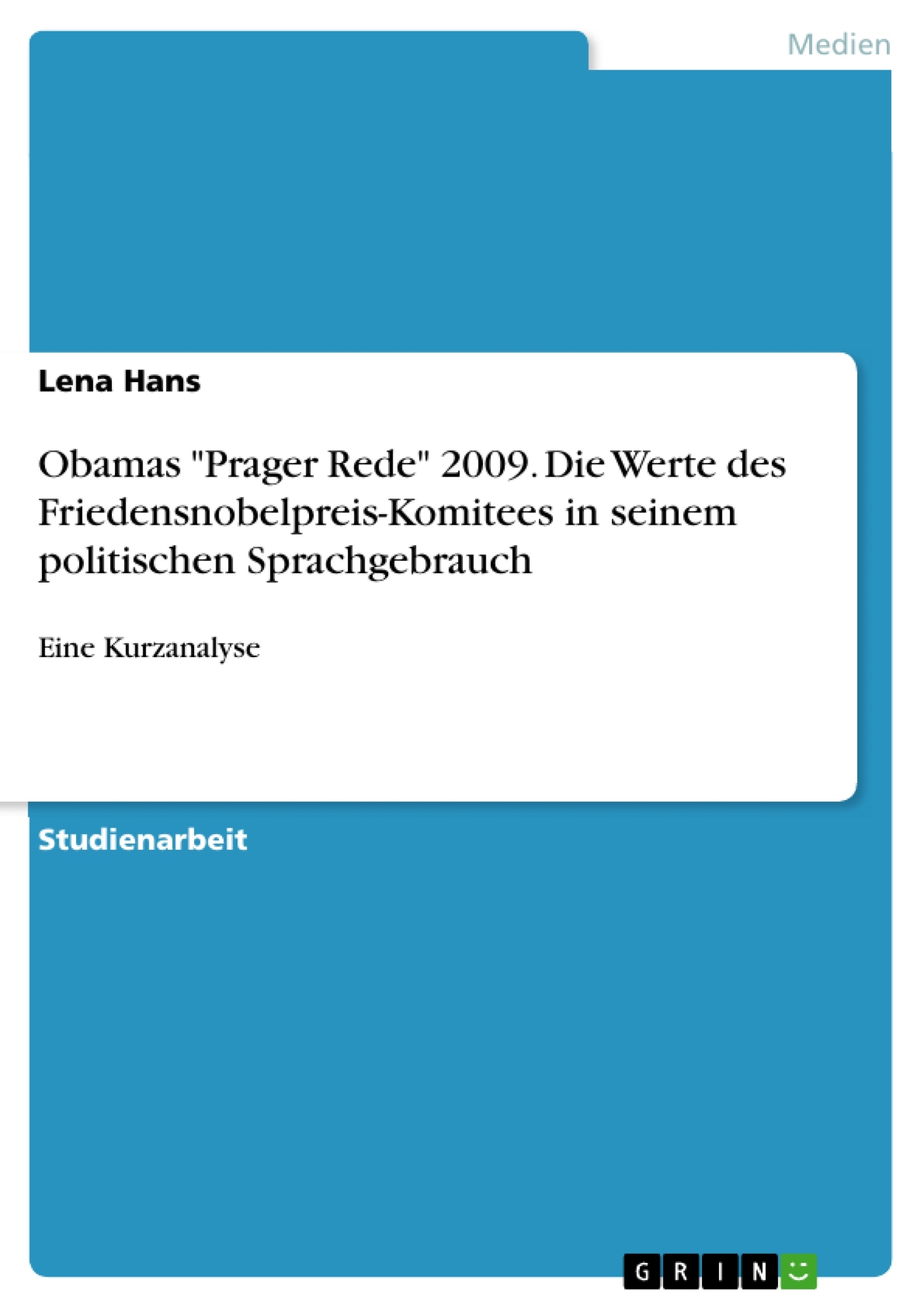In dieser Arbeit wird geprüft, inwiefern sich die Werte des Friedensnobelpreis Komitees im politischen Sprachgebrauch Obamas zeigen. Dazu dient Obamas Rede, die er 2009 in Prag hielt, da diese eine der wichtigsten Reden ist, die er vor seiner Auszeichnung hielt. Anhand dieser wird untersucht, mit welchen rhetorischen Mitteln Obama Werte des Friedensnobelpreis Komitees hervorhebt.
Dazu soll zunächst kurz anhand der Theorie von Klein die Textsorte politische Rede darstellt werden. Danach wird auf die Rhetorik anhand von Klein, Grieswelle und Zimmermann eingegangen und anschließend wird eine eigene Methodik vorstellt, nach der die Rede in dieser Arbeit analysiert werden soll. Hierbei wird sich zusätzlich noch auf die Theorie von Plett gestützt, um einige rhetorische Figuren zu definieren.
Da die Rede von Obama auf Werte des Friedensnobelpreis Komitees untersucht werden soll, geht diese Arbeit noch kurz auf die Geschichte des Nobelpreises ein und darauf, für was die Preisträger in den vergangenen Jahren ausgezeichnet wurden, um daraus zu schließen, welche Werte wichtig sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Textsorte: politische Rede
- Rhetorik
- Politische Rhetorik
- Methodik
- Der Friedensnobelpreis
- Werte des Friedensnobelpreis Komitees
- Gründe für Obamas Nominierung
- Analyse der Rede
- Gefahr von Nuklearwaffen
- Brüderlichkeit und Zusammenarbeit
- Hoffnung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit sich die Werte des Friedensnobelpreiskomitees im politischen Sprachgebrauch Barack Obamas in seiner Prag-Rede von 2009 widerspiegeln. Die Analyse konzentriert sich auf die rhetorischen Mittel, mit denen Obama diese Werte hervorhebt.
- Analyse der rhetorischen Mittel in Obamas Prag-Rede
- Identifikation der Werte des Friedensnobelpreiskomitees
- Zusammenhang zwischen Obamas Rhetorik und den Komitee-Werten
- Die Prag-Rede als Beispiel für Obamas politische Kommunikation
- Bewertung der Wirkung von Obamas Rhetorik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert den Forschungsgegenstand: die Analyse der Prag-Rede Obamas im Hinblick auf die Werte des Friedensnobelpreiskomitees. Sie begründet die Wahl der Prag-Rede als zentrale Quelle und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Die kontroversen Reaktionen auf die Verleihung des Friedensnobelpreises an Obama werden angesprochen, um den Kontext der Untersuchung zu verdeutlichen. Die Einleitung legt den Fokus auf die Untersuchung der rhetorischen Mittel, die Obama zur Hervorhebung der relevanten Werte einsetzt.
Textsorte: politische Rede: Dieses Kapitel beschreibt die Textsorte "politische Rede" anhand der Theorie von Klein. Es werden die institutionellen Bedingungen, die Funktionen (persönliche Profilierung, Beratung, epideiktische Reden) und die zwei Hauptklassen politischer Reden (Beratungsrede und epideiktische Rede) erläutert. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen den beiden Hauptklassen und deren jeweiliger Funktion im politischen Kontext.
Rhetorik: Dieses Kapitel diskutiert den Begriff der Rhetorik im Kontext des geschichtlich-gesellschaftlichen Hintergrunds und der wechselseitigen Abhängigkeit von Kommunikator, Aussage und Rezipient. Es wird auf die Definition von Rhetorik als „Lehre von der Anwendung der richtigen Mittel zu Erreichung von Zwecken“ eingegangen und der Zusammenhang mit der Politik herausgestellt. Die Kapitel beschreibt die klassischen Bestandteile der Rhetorik (inventio, dispositio, elocutio, actio, memoria), wobei der Schwerpunkt auf dispositio (Gliederung der Gedankenführung) und elocutio (angemessene Darstellungsform) liegt.
Politische Rhetorik: Dieses Kapitel verbindet die Handlungslehre von Kenneth Burke mit der politischen Rede. Es wird der zentrale Gedanke Burkes erläutert, dass ein Redner seine Absichten mit dem Wissen, den Interessen und Motiven seines Publikums assoziieren muss. Die Bedeutung des Begriffs "Identifikation" als Schlüssel der neuen Rhetorik im Gegensatz zu "Persuasion" der alten Rhetorik wird hervorgehoben. Zusätzlich werden die Ansichten von Josef Klein zu den konstitutiven Charakteristika politischer Reden im Kontext der Adressatenpluralität und der notwendigen sprachlichen Sensibilität behandelt. Schließlich wird der Ansatz Zimmermanns zur Zweckmäßigkeit politischer Reden im Hinblick auf deren rhetorischen Aufbau und deren Funktion (Aufwertung, Abwertung, Beschwichtigung) besprochen.
Schlüsselwörter
Friedensnobelpreis, Barack Obama, Prag-Rede, Politische Rhetorik, Rhetorische Mittel, Soft Power, Weltfrieden, Diplomatie, Verständigung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Analyse der Prag-Rede Barack Obamas
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Prag-Rede Barack Obamas von 2009. Der Fokus liegt darauf, inwieweit sich die Werte des Friedensnobelpreiskomitees im politischen Sprachgebrauch Obamas widerspiegeln. Die Analyse konzentriert sich auf die rhetorischen Mittel, die Obama einsetzt, um diese Werte zu betonen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Prag-Rede und ihrer Kontextualisierung. Dazu gehören die Textsorte "politische Rede", die allgemeine und politische Rhetorik, die Methodik der Analyse, die Werte des Friedensnobelpreiskomitees, die Gründe für Obamas Nominierung, eine detaillierte Analyse der Rede selbst (u.a. die Themen Nuklearwaffen, Brüderlichkeit, Zusammenarbeit und Hoffnung), und schließlich ein Fazit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr jeweiliger Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel. Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert den Forschungsgegenstand und die Methodik. Das Kapitel "Textsorte: politische Rede" beschreibt diese Textsorte anhand theoretischer Ansätze. Die Kapitel "Rhetorik" und "Politische Rhetorik" behandeln die theoretischen Grundlagen der Rhetorik, inklusive der klassischen Bestandteile und moderner Ansätze wie der Rhetorik von Kenneth Burke und Josef Klein. Die Analyse der Prag-Rede selbst untersucht die rhetorischen Mittel im Detail und deren Bezug zu den Werten des Friedensnobelpreiskomitees.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit untersucht die rhetorischen Mittel in Obamas Prag-Rede, um den Zusammenhang zwischen seiner Rhetorik und den Werten des Friedensnobelpreiskomitees aufzuzeigen. Die Methodik basiert auf der Analyse rhetorischer Figuren und Stilmittel, um die Wirkung von Obamas Rede zu bewerten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Friedensnobelpreis, Barack Obama, Prag-Rede, Politische Rhetorik, Rhetorische Mittel, Soft Power, Weltfrieden, Diplomatie, Verständigung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen Obamas Rhetorik in seiner Prag-Rede und den Werten des Friedensnobelpreiskomitees aufzuzeigen. Sie analysiert die rhetorischen Mittel, identifiziert die relevanten Werte und bewertet die Wirkung von Obamas Rhetorik.
Warum wurde die Prag-Rede ausgewählt?
Die Prag-Rede wurde als zentrale Quelle ausgewählt, da sie eine bedeutende Rede Obamas ist, die im Kontext seiner Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis steht und somit besonders relevant für die Untersuchung der in der Arbeit untersuchten Fragestellung ist.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf theoretische Ansätze aus der Rhetorikforschung, insbesondere auf die Arbeiten von Josef Klein und Kenneth Burke. Diese Ansätze helfen, die politische Rede und die rhetorischen Mittel in Obamas Rede zu analysieren und zu interpretieren.
- Quote paper
- Lena Hans (Author), 2017, Obamas "Prager Rede" 2009. Die Werte des Friedensnobelpreis-Komitees in seinem politischen Sprachgebrauch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/912333