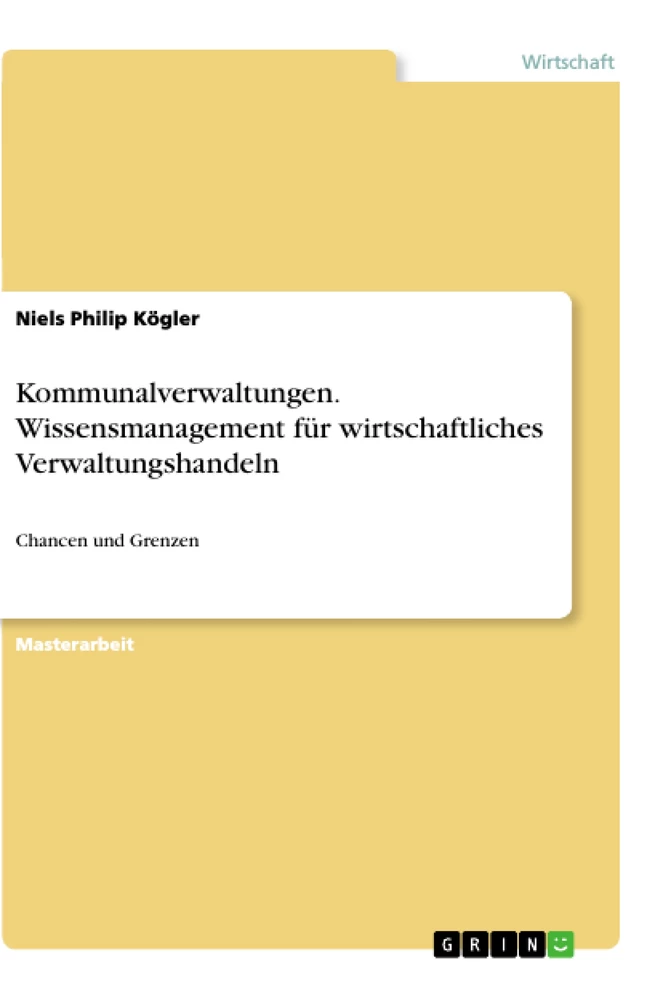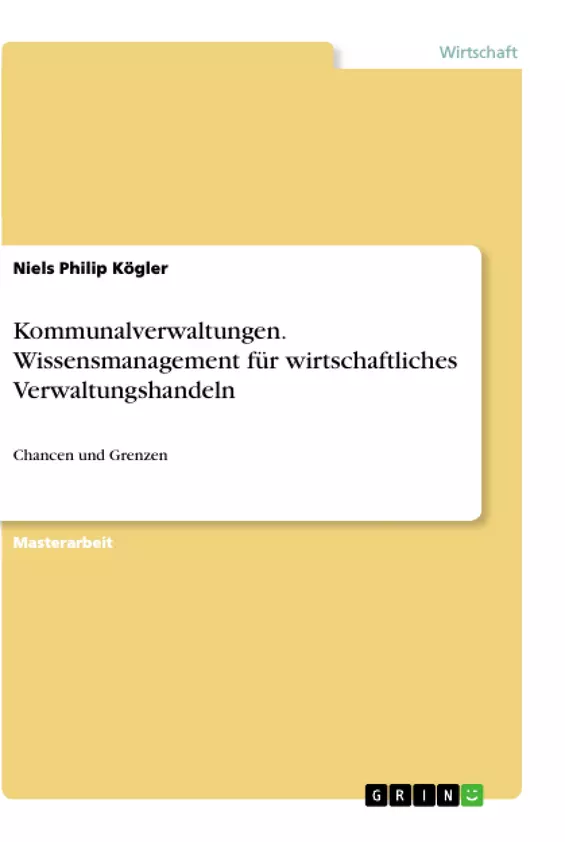Diese Arbeit soll aufzeigen, wie durch Wissensmanagement besser mit der Ressource Wissen umgegangen werden kann und deren Verluste minimiert werden können. Insbesondere vor dem Hintergrund des „Neuen Steuerungsmodells“ der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) stehen dabei die Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns im Fokus. Der Bereich der Kommunalverwaltungen ist dabei nicht ausschließlich auf Grund der persönlichen Erfahrungen des Verfassers Betrachtungsgegenstand. Bedingt durch Föderalismus und die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung, stellt sich dieser Bereich so heterogen wie kein anderer dar und der Bedarf an Wissensmanagmentmaßnahmen scheint hier bei den einzelnen Verwaltungen am größten zu sein.
Herausgearbeitet werden in diesem Zusammenhang, zum einen, Rahmenbedingungen und Entwicklungen, bei denen sich die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch mangelndes Wissen zu verschlechtern droht. Zum anderen werden Chancen aufgezeigt, wie Wissensmanagement zu wirtschaftlichem Verwaltungshandeln beitragen kann und, wo es dabei an Grenzen stößt. Betrachtet wird bei der Darstellung insbesondere der Bereich der Kommunalverwaltungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erkenntnisinteresse und (persönlicher) Hintergrund
- Struktur der Arbeit
- Grundlagen und Hintergründe von Wissensmanagement
- Wissen
- Abgrenzung des Wissensbegriffs
- Arten bzw. Kategorien von Wissen
- Wissensträger und die organisationale Wissensbasis
- Management
- Wissensmanagement
- Organisationales Lernen, Lernformen und Lernebenen
- Wissensmanagement-Generationen
- Der ganzheitliche Wissensmanagementansatz
- Baustein- bzw. Kreislaufmodell des Wissensmanagements
- Wissensumwandlung nach Nonaka und Takeuchi
- Wirtschaftliches Verwaltungshandeln
- Der öffentliche Dienst und seine Kommunalverwaltungen
- Herausfordernde Rahmenbedingungen und Entwicklungen
- Die Notwendigkeit der Ressource Wissen als Erfolgsfaktor
- Fehlender Überblick über vorhandenes Wissen
- Lokale Wissensbasen bzw. Kompetenzinseln
- Speicherprobleme bei implizitem Wissen und Kontext
- Informations- und Kommunikationsflut
- Veränderte Anforderungen an Organisationsmitglieder
- Persönliche und organisationale Wissensflusshemmnisse
- Herrschaftswissen
- Ängste und Unsicherheiten der Organisationsmitglieder
- Fehlende Motivation der Organisationsmitglieder
- Organisationskultur und Hierarchie
- Personalwirtschaftlich bedeutsame Entwicklungen
- Die demografische Entwicklung
- Ansteigender Altersdurchschnitt
- Ausscheiden von Mitarbeitern
- Veränderungen der Arbeitsbiografien
- Neue Vielfalt der Arbeitsformen
- Erfordernisse von Vertretung
- Besonderheiten des Bereichs der Kommunalverwaltungen
- Eine Vielzahl an Einzelorganisationen
- Diverse individuelle Erscheinungsformen
- Stetiger Wandel und Reformen
- Finanzielle Restriktionen
- Chancen und Grenzen des Wissensmanagementeinsatzes
- Praxisnahe Darstellung eines ganzheitlichen Ansatzes
- Berücksichtigung (theoretischer) Grundlagen
- Einbeziehung der Politik und Einigung auf Messkriterien
- Umsetzung im Innenverhältnis
- Erfüllung elementarer Voraussetzungen sicherstellen
- Sicherung von implizitem Wissen
- Einsatz technologiebasierter Wissensmanagementtools
- Technikunterstützung durch Menschen und Organisation
- Wissensflussoptimierung
- Förderung der Wissensnutzung
- Benchmarking und Wissensnetzwerke
- Handlungsempfehlung für kommunales Wissensmanagement
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Wissensmanagement in kommunalen Verwaltungen. Sie untersucht die Chancen und Grenzen des Wissensmanagements als Beitrag zu wirtschaftlichem Verwaltungshandeln. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten des Wissenstransfers und der Wissensnutzung in diesem Bereich. Darüber hinaus werden konkrete Handlungsempfehlungen für die Implementierung von Wissensmanagement in Kommunalverwaltungen entwickelt.
- Analyse der Herausforderungen und Chancen des Wissensmanagements im öffentlichen Sektor
- Untersuchung der Besonderheiten von Wissensmanagement in Kommunalverwaltungen
- Entwicklung eines ganzheitlichen Wissensmanagementansatzes für Kommunalverwaltungen
- Bewertung des Beitrags von Wissensmanagement zur Steigerung der Effizienz und Effektivität von kommunalen Verwaltungen
- Formulierung von Handlungsempfehlungen für die praktische Umsetzung von Wissensmanagement in Kommunalverwaltungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert das Erkenntnisinteresse und den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel beleuchtet die Grundlagen und Hintergründe von Wissensmanagement. Es behandelt den Wissensbegriff, die Arten von Wissen sowie das Management von Wissen. Das dritte Kapitel widmet sich den Herausforderungen und Rahmenbedingungen von Wissensmanagement im öffentlichen Dienst und insbesondere in Kommunalverwaltungen. Hierbei werden die besonderen Herausforderungen und Entwicklungen in diesem Bereich sowie die Notwendigkeit der Ressource Wissen als Erfolgsfaktor dargestellt. Die Chancen und Grenzen des Wissensmanagementeinsatzes werden im vierten Kapitel untersucht. Es wird ein ganzheitlicher Ansatz vorgestellt und die Berücksichtigung theoretischer Grundlagen, die Einbeziehung der Politik, die Umsetzung im Innenverhältnis und die Förderung der Wissensnutzung beleuchtet. Das fünfte Kapitel enthält eine Handlungsempfehlung für kommunales Wissensmanagement.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenbereichen Wissensmanagement, Kommunalverwaltungen, öffentlicher Dienst, wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Herausforderungen und Chancen, ganzheitlicher Ansatz, Handlungsempfehlungen, Personalwirtschaftliche Entwicklungen, Informationsflut, Wissensnutzung, Wissensflussoptimierung, Benchmarking, Wissensnetzwerke.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Wissensmanagement für Kommunalverwaltungen wichtig?
Es hilft, den Verlust von Wissen durch Fluktuation oder demografischen Wandel zu minimieren und die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch effizientere Prozesse zu steigern.
Was ist das „Neue Steuerungsmodell“ (NSM) der KGSt?
Es ist ein Reformkonzept für die öffentliche Verwaltung, das auf mehr Wirtschaftlichkeit, Output-Orientierung und moderne Managementmethoden setzt.
Was sind typische Wissensflusshemmnisse in der Verwaltung?
Hemmnisse sind unter anderem „Herrschaftswissen“ (Wissen als Machtfaktor), starre Hierarchien, Ängste der Mitarbeiter und eine fehlende Motivationskultur zum Teilen von Informationen.
Welche Rolle spielt die demografische Entwicklung beim Wissensmanagement?
Durch das Ausscheiden erfahrener Mitarbeiter droht ein massiver Verlust an implizitem Wissen (Erfahrungswissen), der durch gezielte Transfermaßnahmen abgefangen werden muss.
Welche technologischen Tools unterstützen das Wissensmanagement?
Eingesetzt werden können Intranets, Datenbanken, Wissensnetzwerke und Benchmarking-Systeme, wobei diese immer durch organisatorische Maßnahmen flankiert werden müssen.
Was ist der Unterschied zwischen implizitem und explizitem Wissen?
Explizites Wissen ist dokumentiert und leicht teilbar, während implizites Wissen an Personen gebundenes Erfahrungswissen ist, das schwerer zu übertragen ist.
- Quote paper
- Niels Philip Kögler (Author), 2019, Kommunalverwaltungen. Wissensmanagement für wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/913067