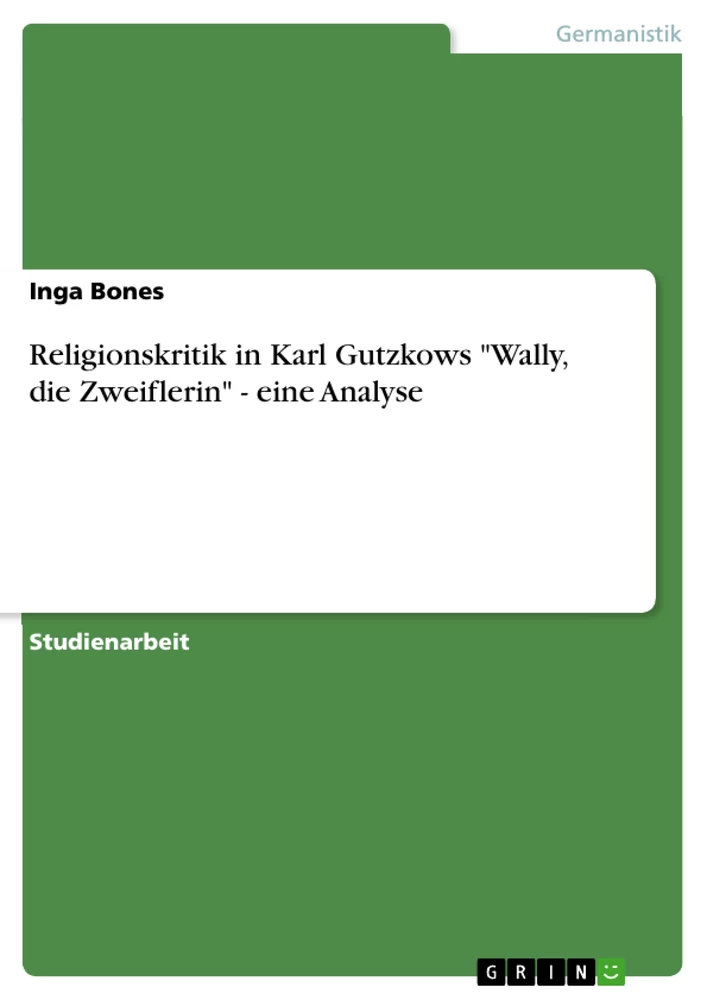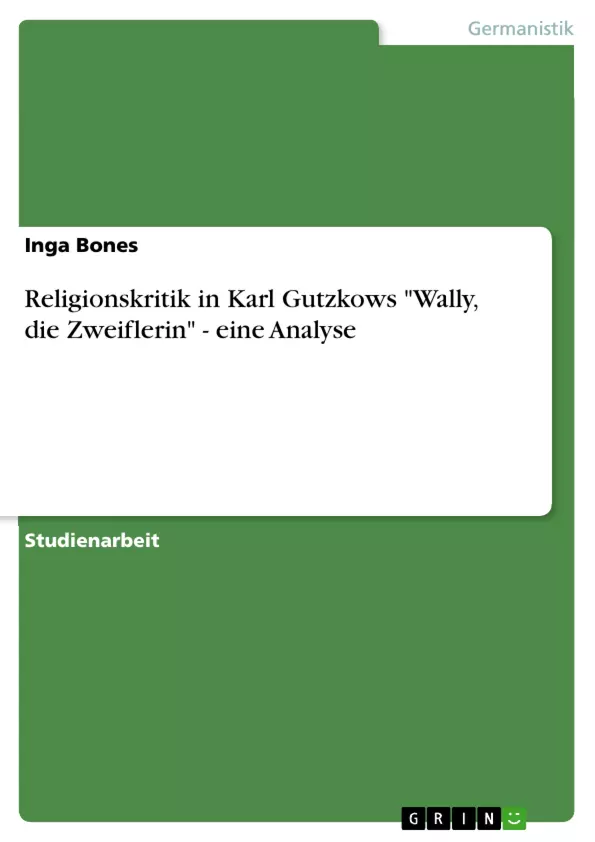Karl Gutzkows im August des Jahres 1835 erschienener Roman Wally, die Zweiflerin bildete nicht nur den Anlass scharfer Kritiken, sondern war zugleich Auslöser des Verbots der unter dem schlagwortartigen Ausdruck Junges Deutschland gefassten Autorengruppe. Im Bundesbeschluss vom 10. Dezember 1835 wurde „der unter der Bezeichnung >das junge Deutschland< […] bekannten literarischen Schule, zu welcher namentlich Heinr. Heine, Carl Gutzkow, Heinr. Laube, Ludolph Wienbarg und Theodor Mundt gehören“ vorgeworfen, „die christliche Religion auf die frechste Weise anzugreifen, die bestehenden socialen Verhältnisse herabzuwürdigen und alle Zucht und Sittlichkeit zu zerstören“.
Der Roman Wally, die Zweiflerin spiegelt die politischen, sozialen und philosophischen Strömungen seiner Zeit – des Vormärz – wieder; zum Zeitpunkt seines Erscheinens spielt er in der Gegenwart und kann somit als Zeitroman typisiert werden. Er handelt von der jungen Adligen Wally, die ein unbeschwertes, aber „fades“ Leben zwischen geselligem Geplauder, gesellschaftlichen Verpflichtungen und Kuraufenthalten führt. Die Begegnung mit dem „Skeptiker“ Cäsar und die eingehende Beschäftigung mit seinen unorthodoxen, oft provokanten Thesen zu Religions- und Glaubensfragen erschüttern die „an einem religiösen Tick“ leidende Wally und münden in ihren Selbstmord.
Die öffentliche Aufregung um Gutzkows Wally war zwar zu einem nicht unbeträchtlichen Teil den harschen und ausfallenden Kritiken Wolfgang Menzels geschuldet, dennoch berührte der Roman gesellschaftliche Tabus: Religionskritische Fragestellungen und Reflexionen – über den Wert der Ehe, die Möglichkeit der Selbsttötung etc. – ziehen sich wie ein roter Faden durch das Buch, kulminieren jedoch in den Geständnissen Cäsars, die sich kritisch mit drei Epochen der Religionsgeschichte auseinandersetzen: Antike (Entstehung des Christentums), Mittelalter (Reformation) und Neuzeit (Aufklärung).
Der erste Teil dieser Arbeit gibt einen Überblick über die Handlung des Romans und untersucht auf der Grundlage der Einführung in die Erzähltheorie von Matias Martinez und Michael Scheffel exemplarisch drei Aspekte der Darstellung: Zeit, Modus und Stimme. Die darstellerischen Besonderheiten der Wally – Erzählerwechsel, Analepsen, Binnenerzählungen – sollen auch im Hinblick auf ihre beabsichtigte Wirkung betrachtet werden.
Im zweiten Teil soll zunächst die Essenz der Religionskritik Cäsars herausgearbeitet werden; anschließend soll die religiöse Haltung der Protagonistin Wally vor der Lektüre der Geständnisse untersucht werden. Den fatalen Folgen der Rezeption der Geständnisse durch Wally ist ein dritter Abschnitt gewidmet.
Die verwendete Literatur beschränkt sich auf einführende Texte zur Erzähltheorie, Romananalyse und zu der Literatur des Vormärz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Handlung und Darstellung
- Erstes Buch
- Zweites Buch
- Drittes Buch
- Religionskritik
- Cäsars Geständnisse über Religion und Christentum
- Der Ursprung der Religion: Heidentum vs. Christentum
- Martin Luther und die Reformation: Katholizismus vs. Protestantismus.
- Rationalismus und Aufklärung: Deismus vs. Theismus
- Kirchenkritik und Naturreligion
- Die religiöse Haltung der Protagonistin vor der Lektüre der Geständnisse.
- Die Rezeption der Geständnisse durch Wally und die existenziellen Folgen
- Cäsars Geständnisse über Religion und Christentum
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Karl Gutzkows Roman „Wally, die Zweiflerin“ und beleuchtet die Kritik an der Religion, die im Werk zum Ausdruck kommt. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Religionskritik in den „Geständnissen“ der Figur Cäsar und den Auswirkungen der Lektüre dieser Geständnisse auf die Protagonistin Wally.
- Religionskritik in der Literatur des Vormärz
- Die Rolle der Religion im Leben der Protagonistin
- Die Auswirkungen der Religionskritik auf die Protagonistin
- Die Rolle der Darstellung in der Vermittlung der Kritik
- Die Bedeutung der Erzählform im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die den historischen und literarischen Kontext von Gutzkows Roman beleuchtet. Anschließend wird die Handlung des Romans in drei Kapiteln anhand von exemplarischen Szenen und Motiven analysiert.
Das erste Kapitel befasst sich mit der Handlung und Darstellung des Romans. Dabei wird der Fokus auf die erzählerischen Besonderheiten gelegt, insbesondere auf den Wechsel zwischen auktorialem Erzähler und der Perspektive der Protagonistin.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Religionskritik Cäsars und der religiösen Haltung der Protagonistin Wally vor der Lektüre der Geständnisse.
Das dritte Kapitel analysiert die Rezeption der Geständnisse durch Wally und die existenziellen Folgen, die diese für sie haben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen des Vormärz, darunter die Religionskritik, die Auseinandersetzung mit traditionellen Werten und die Bedeutung der individuellen Freiheit. Die Analyse fokussiert sich auf die Romanfiguren Wally und Cäsar sowie auf die literarischen Mittel der Darstellung und Erzählform.
- Citar trabajo
- Inga Bones (Autor), 2008, Religionskritik in Karl Gutzkows "Wally, die Zweiflerin" - eine Analyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91327