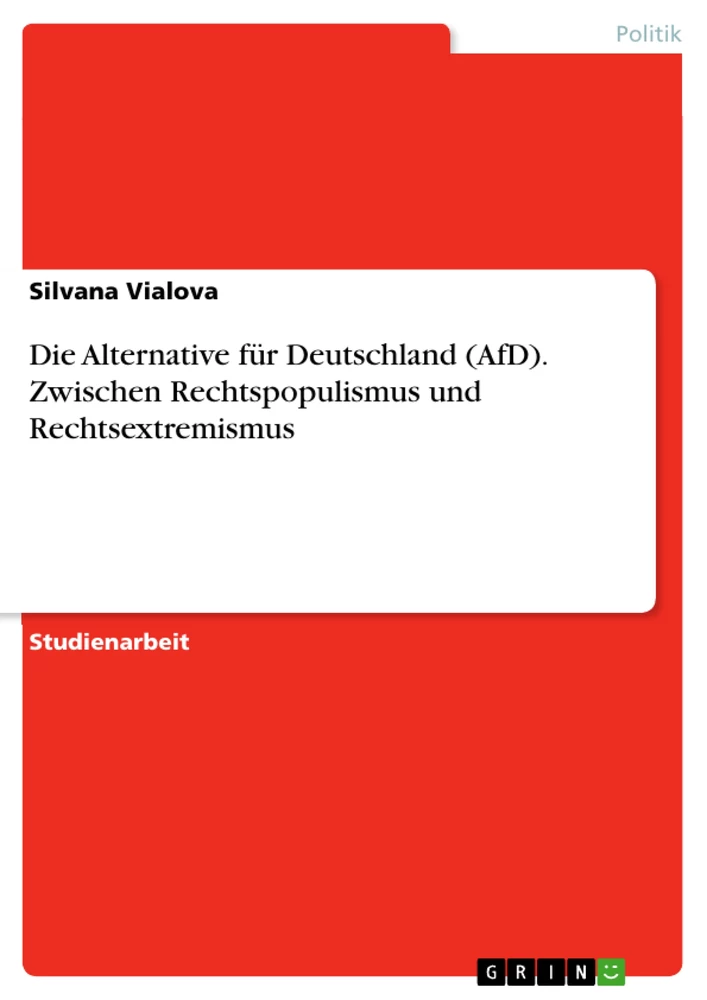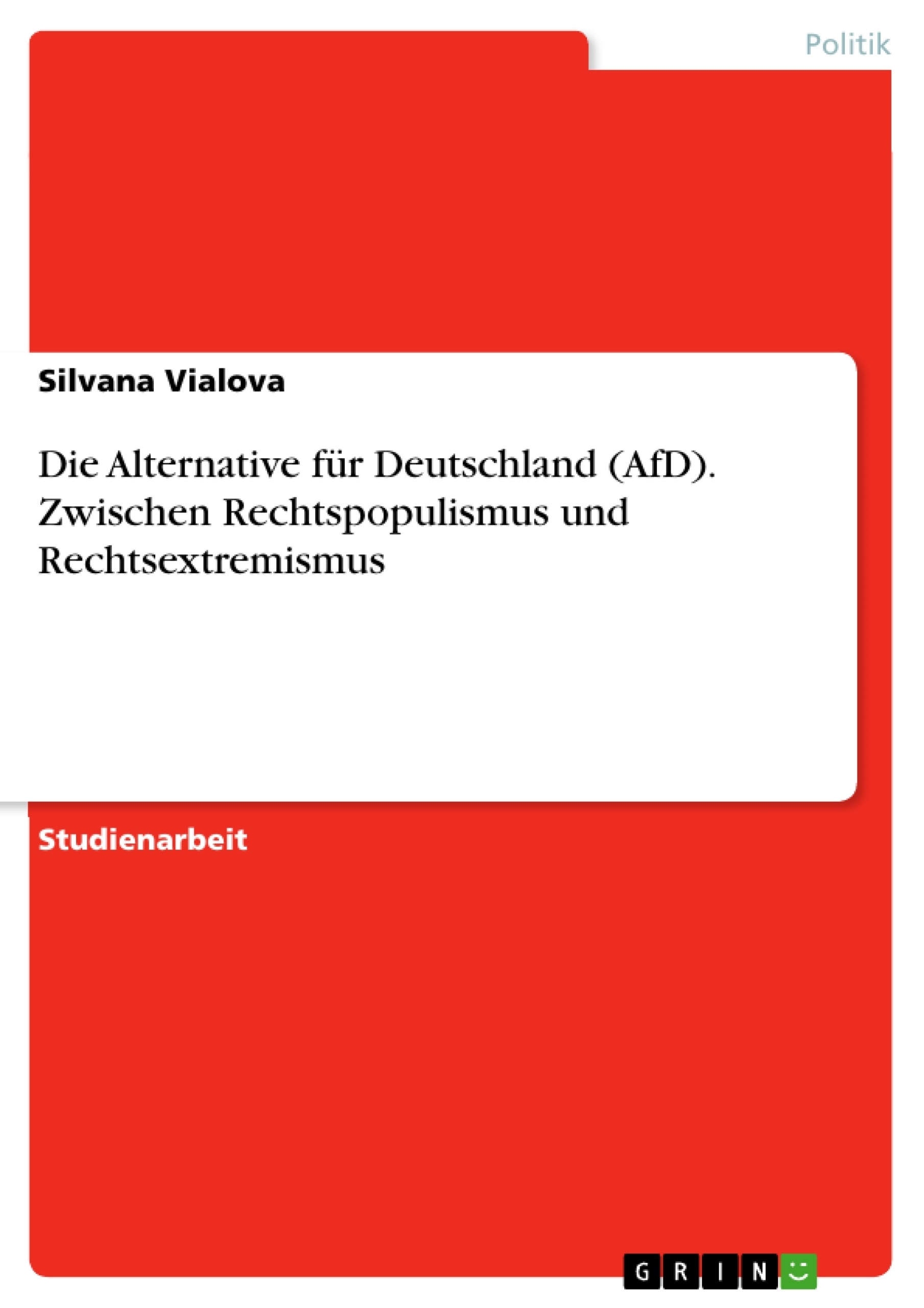In der Arbeit soll der Versuch unternommen werden, die "Alternative für Deutschland" (AfD) innerhalb der beiden Pole rechtspopulistisch und rechtsextrem zu verorten. Zunächst findet ein kurzer Abriss über die Entstehung und Entwicklung der Partei "Alternative für Deutschland" statt, der die spätere Einordnung ihrer aktuellen Ausrichtung erleichtert. Um die AfD als rechtspopulistisch oder rechtsextrem klassifizieren zu können, folgt anschließend ein theoretischer Überblick über Definitionen und Charakteristika der beiden Phänomene. In der Analyse selbst fokussiert sich der Autor auf schriftliches Material, das die inhaltliche Ausrichtung der Partei widerspiegelt.
Die Fragestellung, ob die Partei bereits als rechtsextrem eingestuft werden kann/muss, ergibt sich aus der Beobachtung vermehrt auftretender skandalträchtiger Äußerungen wichtiger Parteimitglieder. Da sich solche Ansichten kaum in dieser Intensität im Grundsatzprogramm finden lassen, wird außerdem eine Analyse einiger öffentlicher Äußerungen hinzugefügt. Bislang gelingt es der Partei besonders durch provokante Tabubrüche immer wieder in die Schlagzeilen zu kommen und es drängt sich die Frage auf, ob nicht das Radikale anstelle des Gemäßigten das wahre Gesicht der AfD ist. Eine mögliche Antwort wird in der Analyse herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die AfD – Entstehung und Entwicklung einer Rechtsaußen-Partei
- Theoretische Grundlagen
- Rechtspopulismus - Definitionen und zentrale Merkmale
- Rechtsextremismus - Definitionen und zentrale Merkmale
- Analyse
- Das Grundsatzprogramm der AfD
- Öffentliche Äußerungen von AfD Politiker*innen
- Fazit der Analyse
- Abschließende Bemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) als rechtspopulistisch oder rechtsextrem eingestuft werden kann. Die Analyse des Grundsatzprogramms und öffentlicher Äußerungen von AfD-Politiker*innen soll Aufschluss über die ideologische Ausrichtung der Partei geben.
- Entstehung und Entwicklung der AfD
- Theoretische Einordnung von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus
- Analyse des Grundsatzprogramms der AfD
- Analyse öffentlicher Äußerungen von AfD-Politiker*innen
- Diskussion der Positionierung der AfD im Spannungsfeld zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Relevanz der Untersuchung. Die AfD ist eine junge Partei, die in kürzester Zeit einen bedeutenden Einfluss auf die deutsche politische Landschaft erlangt hat. Ihre Positionierung im Spektrum zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus ist umstritten. Die Arbeit nimmt sich dieser Frage an und verfolgt dabei einen systematischen Ansatz, der auf der Analyse des Grundsatzprogramms und öffentlicher Äußerungen von AfD-Politiker*innen beruht.
Im zweiten Kapitel wird die Entstehung und Entwicklung der AfD dargestellt. Die Partei wurde 2013 von Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke gegründet und verfolgte zunächst eine europa- und euroskeptische Politik. Nach dem Scheitern an der 5%-Hürde bei der Bundestagswahl 2013 konnte die Partei bei der Europawahl 2014 und nachfolgenden Landtagswahlen erste Erfolge verzeichnen. Die politischen Umstände der Euro-Rettungspolitik rund um die Finanz- und Eurokrise verschaffte der „One-Issue-Partei“ in ihrer Anfangsphase Rückenwind. Die AfD forderte einen Austritt aus dem Euro, die Abschaffung der Schulden- und Haftungsgemeinschaft und eine Rückverlagerung von Entscheidungskompetenzen auf die Nationalstaaten.
Im dritten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die Einordnung der AfD erörtert. Es werden Definitionen und zentrale Merkmale des Rechtspopulismus und des Rechtsextremismus vorgestellt. Dies bildet die Grundlage für die spätere Analyse des Grundsatzprogramms der AfD.
Schlüsselwörter
AfD, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Grundsatzprogramm, öffentliche Äußerungen, politische Positionierung, Deutschland, Europa, Eurokrise, nationalkonservativ, völkisch, Einwanderung, Islamkritik, innere Sicherheit, traditionelle Familie, deutsche Kultur
Häufig gestellte Fragen
Wann und von wem wurde die AfD gegründet?
Die AfD wurde 2013 unter der Führung des Wirtschaftsprofessors Bernd Lucke gegründet.
Was war das ursprüngliche Hauptthema der AfD?
In ihrer Anfangsphase war die AfD eine "One-Issue-Partei", die sich primär auf die Kritik an der Euro-Rettungspolitik und die Forderung nach Rückkehr zu nationalen Kompetenzen konzentrierte.
Wie wird die AfD in dieser Arbeit eingeordnet?
Die Arbeit untersucht die Verortung der Partei im Spannungsfeld zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus anhand ihres Programms und öffentlicher Äußerungen.
Welche Rolle spielen Tabubrüche für die Partei?
Die AfD nutzt provokante Tabubrüche und skandalträchtige Äußerungen, um mediale Aufmerksamkeit zu generieren und ihre politische Agenda zu verbreiten.
Welche ideologischen Strömungen werden in der AfD analysiert?
Die Analyse umfasst Themen wie Islamkritik, nationale Identität, Einwanderungspolitik und völkisch-nationalistische Tendenzen innerhalb der Partei.
- Arbeit zitieren
- Silvana Vialova (Autor:in), 2018, Die Alternative für Deutschland (AfD). Zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/913354