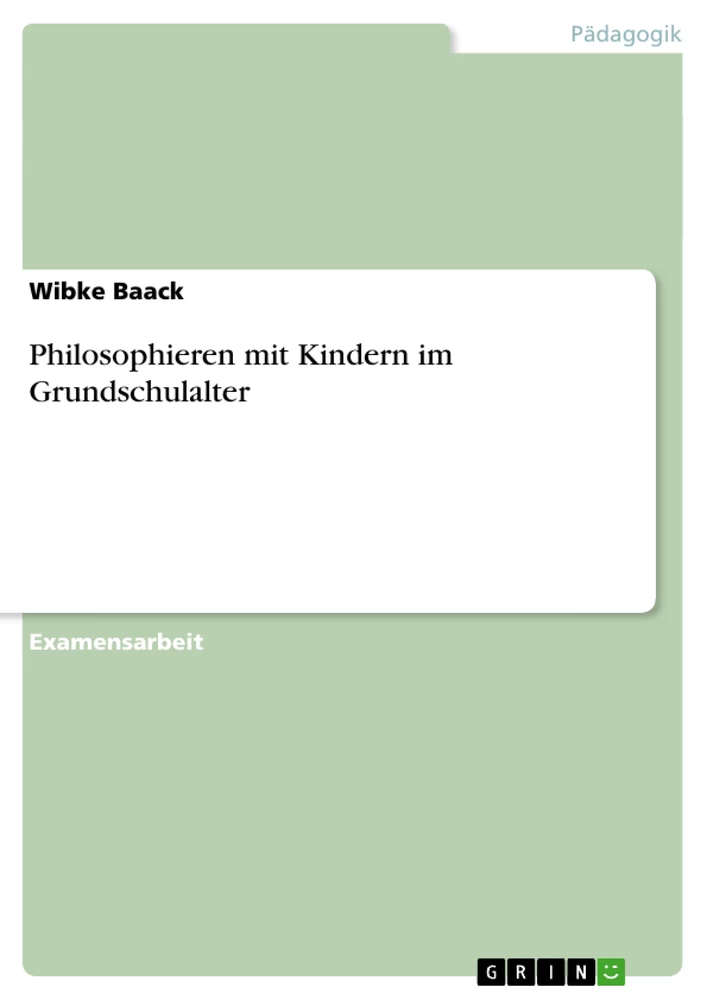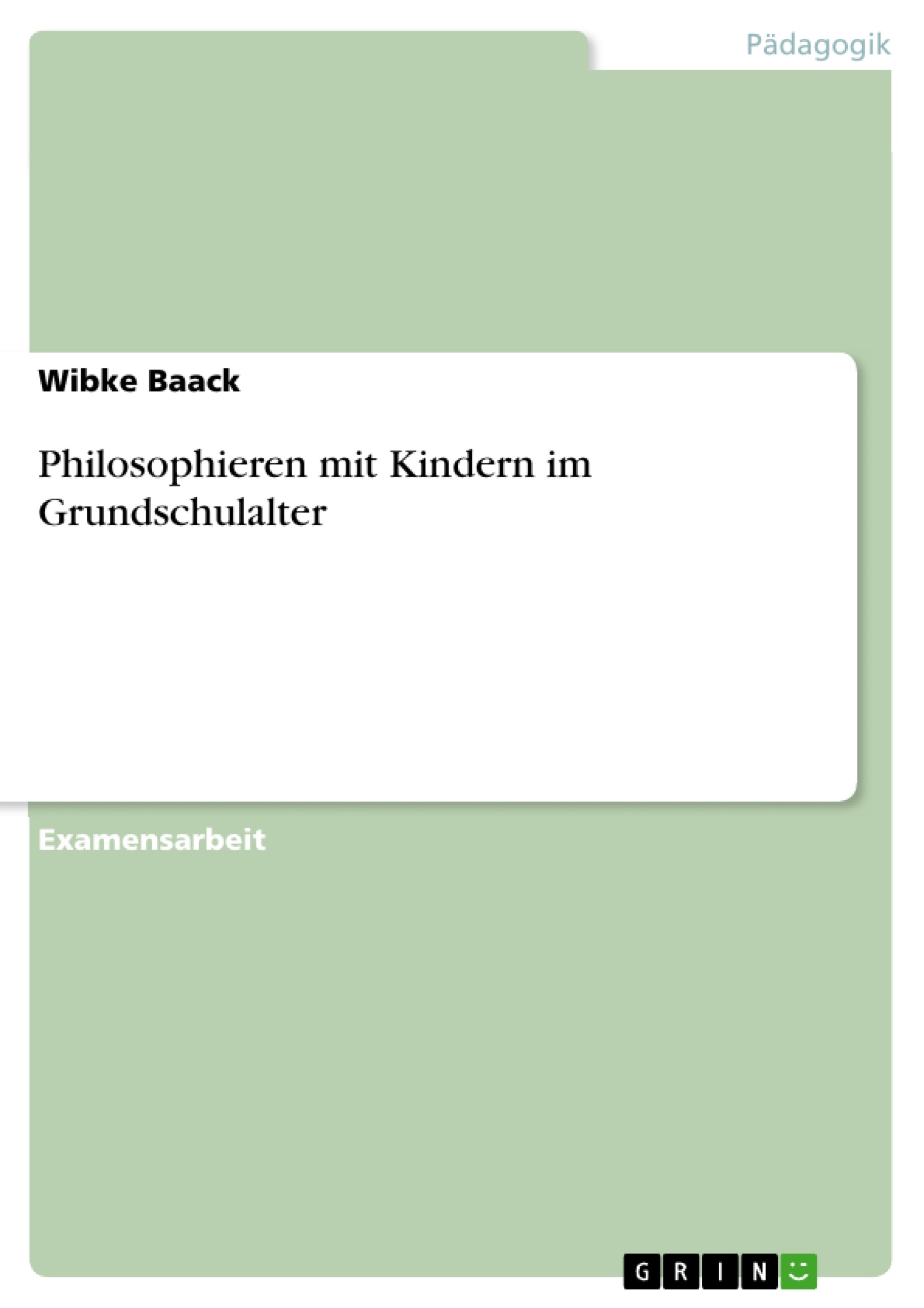Das Philosophieren mit Kindern wurde bereits nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland praktiziert, wobei es pädagogische Kontroversen in der Durchführung gab. Unter den Nationalsozialisten wurde dann das Philosophieren mit Kindern unterbunden und gewinnt derzeitig wieder an Aktualität .
Hermann Nohl, der in den Zwanzigerjahren im Landschulheim Holzminden mit Kinder philosophierte, schrieb über die philosophischen Potentiale des Kindes:
„Langsam gehen dem kleinen Menschen, der viel metaphysischer denkt, als der Erwachsene meist ahnt, Dinge auf wie der Sternencharakter der Erde, daß es im Weltraum kein Oben und kein Unten gibt, das Geheimnis der Unendlichkeit, das Wunder des Lebens, die merkwürdige Tatsache des Gesetzes, die Macht der Zahl, dann aber auch Fragen wie das Theodiceeproblem, das schon Vierjährige lange beschäftigen kann, die sittliche Frage der Freiheit usw. ...“
Die Frage „Können Kinder philosophieren?“ gilt es, u.a. in dieser Arbeit zu behandeln. Dazu muss zunächst verdeutlicht werden, was unter dem Philosophieren mit Kindern zu verstehen ist und welche Anforderungen an das Philosophieren der Kinder gestellt werden. Die hierzu notwendigen Kompetenzen sprechen Skeptiker den Kindern unter dem Vorwand entwicklungspsychologischer Bedenken ab. Daher ist zu überprüfen, inwieweit die Einwände berechtigt sind.
Im Anschluss werden von mir Ziele, die durch das Philosophieren mit Kindern verfolgt werden, sowie eine mögliche Durchführung des Philosophierens mit Kindern in der Grundschule thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Klärung des Begriffs „Philosophieren mit Kindern“ und Anforderungen an das Philosophieren der Kinder
- 1.1 Der Begriff „Philosophieren mit Kindern“
- 1.2 Anforderungen an das Philosophieren der Kinder im Vergleich zum Philosophieren von Fachleuten
- 2 Entwicklungspsychologische Aspekte zum Philosophieren mit Kindern
- 2.1 Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung
- 2.1.1 Merkmale und Auswirkungen des kindlichen Egozentrismus nach Piaget
- 2.2 Evaluation von Piagets Theorie
- 2.2.1 Wygotskis Kritik an Piagets Theorie und Methoden
- 2.2.2 Weitere Kritikpunkte an Piagets Theorie
- 2.3 Der Ansatz der Informationsverarbeitung aus entwicklungspsychologischer Perspektive
- 2.3.1 Die Wissensbasis
- 2.3.2 Das aktivierte Gedächtnis
- 2.3.3 Mechanismen der kognitiven Entwicklung
- 3 Themen und Fragen der Philosophie sowie philosophische Fragen und Thematiken von Kindern
- 3.1 Vorteile philosophischer Grundkenntnisse für die/den LehrerIn
- 3.2 Themenbereiche der Philosophie
- 3.2.1 Die Metaphysik
- 3.2.1.1 Bedeutende Fragen der Metaphysik
- 3.2.1.1.1 Die Frage nach Gott
- 3.2.1.1.2 Die Frage nach einer Seele
- 3.2.2 Die Erkenntnistheorie
- 3.2.2.1 Bedeutende Fragen der Erkenntnistheorie
- 3.2.3 Die Logik
- 3.2.4 Die Ethik
- 3.2.5 Die philosophische Anthropologie
- 3.2.5.1 Die Hauptfrage der philosophischen Anthropologie - Was ist der Mensch?
- 3.2.6 Die Ästhetik
- 3.2.6.1 Ein Thema der Ästhetik - Das ästhetische Urteil
- 3.3 Philosophische Themen und Fragen von Kindern
- 4 Ziele des Philosophierens mit Kindern
- 4.1 Die therapeutische Funktion – Das Aneignen von Fähigkeiten zur Bewältigung persönlicher Problemsituationen
- 4.2 Die Förderung des eigenständigen und kritischen Denkens
- 4.3 Die Möglichkeit zur Bewältigung metaphysischer Ängste und philosophischen Fragen
- 4.4 Die Förderung logischen Denkens
- 4.5 Philosophieren mit Kindern als Umsetzung von Aufgaben und Zielen des Deutsch-, Mathematik- und Sachkundeunterrichts in der Grundschule
- 5 Zur Methode des Philosophierens mit Kindern
- 5.1 Begriffsklärungen
- 5.1.1 Die philosophische Frage
- 5.1.2 Das philosophische Gespräch
- 5.2 Zum Ablauf einer Einheit des Philosophierens mit Kindern
- 5.2.1 Der erste Schritt: Einstiege in das Philosophieren mit Kindern
- 5.2.1.1 Der Zettelkasten – Fragen der Kinder mit philosophischem Hintergrund
- 5.2.1.2 Philosophische Texte für Kinder
- 5.2.1.3 Kinderbücher
- 5.2.1.4 Weitere Einstiege in das Philosophieren mit Kindern
- 5.2.2 Der zweite Schritt: Formulierung der Frage durch die Kinder und die anschließende Auswahl einer Frage für das philosophische Gespräch
- 5.2.3 Der dritte Schritt: Durchführung eines philosophischen Gesprächs mit Kindern
- 5.2.3.1 Das Klären des Fragecharakters
- 5.2.3.2 Regeln des philosophischen Gesprächs
- 5.2.3.3 Anforderungen an die/den GesprächsleiterIn und ihre/seine Aufgaben im philosophischen Gespräch
- 5.2.3.4 Die „Werkzeugkiste für schlaue Denker“ aus Daurers Methode
- 5.2.4 Der vierte Schritt: Abschluss - Reflexion über das philosophische Gespräch
- 5.2.4.1 Zusammenfassen des Gesprächsinhalts
- 5.2.4.2 Bewertung des Gesprächsverlaufs durch die Kinder
- 5.2.5 Weitere methodische Elemente
- 6 Schlussbemerkungen
- 7 Verzeichnis der verwendeten Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Philosophieren mit Kindern im Grundschulalter. Ziel ist es, den Begriff "Philosophieren mit Kindern" zu klären, entwicklungspsychologische Aspekte zu beleuchten und methodische Ansätze für die praktische Umsetzung im Unterricht zu präsentieren. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, ob und wie Kinder philosophieren können und welche Ziele mit dieser Methode erreicht werden können.
- Klärung des Begriffs "Philosophieren mit Kindern"
- Entwicklungspsychologische Grundlagen des kindlichen Denkens und Lernens
- Philosophische Themen und Fragen von Kindern
- Ziele und Funktionen des Philosophierens mit Kindern im Unterricht
- Methodische Ansätze für das Philosophieren mit Kindern in der Grundschule
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung skizziert die Geschichte des Philosophierens mit Kindern in Deutschland, verweist auf frühere Praxis und Unterbrechungen, und führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: Können Kinder philosophieren? Sie benennt die zentralen Aspekte, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden, darunter die Klärung des Begriffs, entwicklungspsychologische Überlegungen und methodische Ansätze.
1 Klärung des Begriffs „Philosophieren mit Kindern“ und Anforderungen an das Philosophieren der Kinder: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Philosophieren mit Kindern" und vergleicht die Anforderungen an das kindliche Philosophieren mit denen an das Philosophieren von Erwachsenen. Es wird die Frage nach den Kompetenzen von Kindern im philosophischen Diskurs diskutiert und eventuelle Skepsis seitens der Pädagogik adressiert.
2 Entwicklungspsychologische Aspekte zum Philosophieren mit Kindern: Dieses Kapitel befasst sich mit der Relevanz entwicklungspsychologischer Theorien, insbesondere Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung, für das Verständnis des kindlichen Philosophierens. Es werden Piagets Theorie, die Kritik von Wygotski und weitere Kritikpunkte an Piaget diskutiert. Der Ansatz der Informationsverarbeitung wird ebenfalls beleuchtet, um das Verständnis der kognitiven Entwicklung und des Denkens von Kindern zu erweitern. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit die kognitiven Fähigkeiten von Kindern das Philosophieren ermöglichen oder einschränken.
3 Themen und Fragen der Philosophie sowie philosophische Fragen und Thematiken von Kindern: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Bereiche der Philosophie (Metaphysik, Erkenntnistheorie, Logik, Ethik, philosophische Anthropologie und Ästhetik) und beleuchtet, welche Fragen und Themen innerhalb dieser Bereiche auch für Kinder relevant sein könnten. Es wird der Wert philosophischer Grundkenntnisse für Lehrkräfte hervorgehoben und die Verbindung zu den philosophischen Interessen und Fragen von Kindern hergestellt.
4 Ziele des Philosophierens mit Kindern: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Ziele, die mit dem Philosophieren mit Kindern verfolgt werden können. Es werden therapeutische Funktionen, die Förderung des kritischen Denkens, die Bewältigung metaphysischer Ängste und die Förderung des logischen Denkens als wesentliche Ziele herausgestellt. Die Einbettung des Philosophierens in den bestehenden Unterricht (Deutsch, Mathematik, Sachunterricht) wird ebenfalls diskutiert.
5 Zur Methode des Philosophierens mit Kindern: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methode des Philosophierens mit Kindern. Es beinhaltet Begriffsklärungen (philosophische Frage, philosophische Gespräch), den Ablauf einer Unterrichtseinheit (Einstieg, Fragenformulierung, Gesprächsführung, Abschlussreflexion) und weitere methodische Elemente. Es werden verschiedene Einstiege in das philosophische Gespräch präsentiert, die Regeln des Gesprächs erläutert, und die Rolle der Lehrkraft als Gesprächsleiterin/Gesprächsleiter beschrieben.
Schlüsselwörter
Philosophieren mit Kindern, Grundschule, Entwicklungspsychologie, Piaget, Wygotski, kognitive Entwicklung, philosophische Fragen, methodische Ansätze, kritisches Denken, Unterrichtsgestaltung.
Häufig gestellte Fragen zu: Philosophieren mit Kindern in der Grundschule
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit dem Philosophieren mit Kindern im Grundschulalter. Sie untersucht den Begriff "Philosophieren mit Kindern", beleuchtet entwicklungspsychologische Aspekte und präsentiert methodische Ansätze für die praktische Umsetzung im Unterricht.
Was ist das zentrale Forschungsziel?
Das Hauptziel ist es zu klären, ob und wie Kinder philosophieren können und welche Ziele mit dieser Methode erreicht werden können. Die Arbeit fokussiert auf die Klärung des Begriffs, entwicklungspsychologische Grundlagen, philosophische Themen von Kindern, die Ziele und Funktionen sowie methodische Ansätze im Unterricht.
Welche entwicklungspsychologischen Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt vor allem Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung, einschließlich der Kritik von Wygotski und weiterer Kritikpunkte an Piaget. Zusätzlich wird der Ansatz der Informationsverarbeitung aus entwicklungspsychologischer Perspektive beleuchtet.
Welche philosophischen Bereiche werden angesprochen?
Die Arbeit untersucht verschiedene Bereiche der Philosophie, darunter Metaphysik (inkl. Fragen nach Gott und der Seele), Erkenntnistheorie, Logik, Ethik, philosophische Anthropologie (inkl. der Frage „Was ist der Mensch?“) und Ästhetik (inkl. des ästhetischen Urteils).
Welche Ziele werden durch Philosophieren mit Kindern verfolgt?
Die Arbeit nennt verschiedene Ziele: therapeutische Funktionen (Bewältigung persönlicher Probleme), Förderung des eigenständigen und kritischen Denkens, Bewältigung metaphysischer Ängste, Förderung logischen Denkens und die Einbettung in den bestehenden Unterricht (Deutsch, Mathematik, Sachunterricht).
Wie wird die Methode des Philosophierens mit Kindern beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Methode, inklusive Begriffsklärungen (philosophische Frage, philosophische Gespräch), dem Ablauf einer Unterrichtseinheit (Einstieg, Fragenformulierung, Gesprächsführung, Abschlussreflexion) und weiteren methodischen Elementen. Verschiedene Einstiege, Regeln des Gesprächs und die Rolle der Lehrkraft werden erläutert.
Welche methodischen Ansätze werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene methodische Ansätze, wie z.B. den Einsatz eines Zettelkastens mit Fragen der Kinder, philosophische Texte für Kinder, Kinderbücher und weitere Einstiege. Es werden Regeln für das philosophische Gespräch detailliert beschrieben, sowie die Rolle und Aufgaben der Lehrkraft als Gesprächsleiterin/Gesprächsleiter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Philosophieren mit Kindern, Grundschule, Entwicklungspsychologie, Piaget, Wygotski, kognitive Entwicklung, philosophische Fragen, methodische Ansätze, kritisches Denken, Unterrichtsgestaltung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Klärung des Begriffs "Philosophieren mit Kindern", entwicklungspsychologische Aspekte, philosophische Themen und Fragen von Kindern, Ziele des Philosophierens mit Kindern, die Methode des Philosophierens mit Kindern, Schlussbemerkungen und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung detailliert beschrieben.
- Citation du texte
- Wibke Baack (Auteur), 2003, Philosophieren mit Kindern im Grundschulalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91375