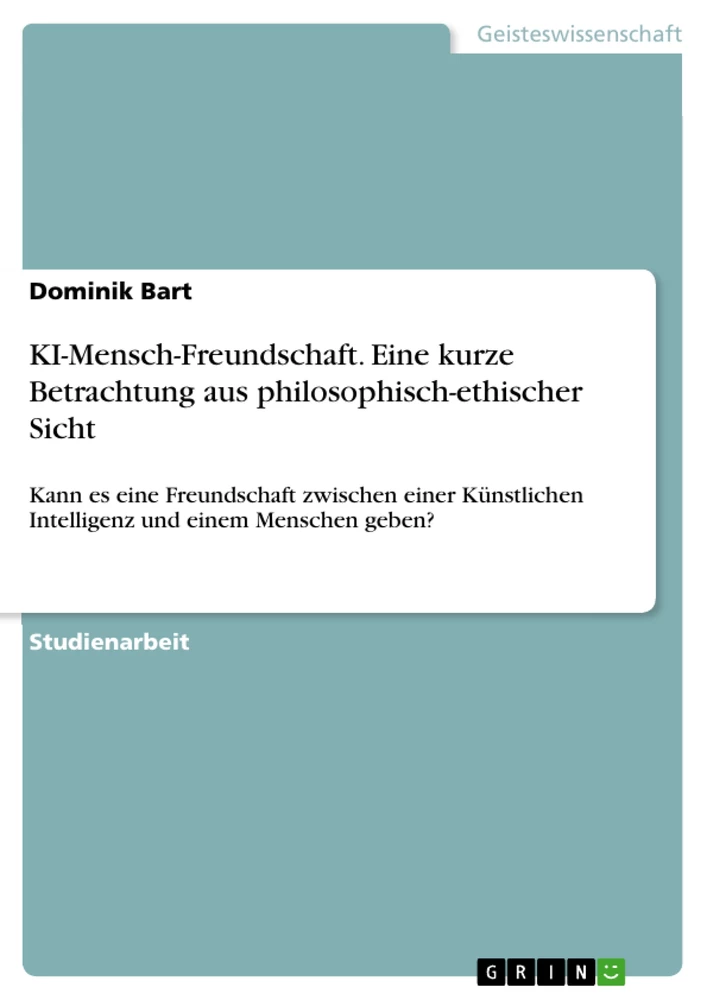Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob es eine Freundschaft zwischen einer Künstlichen Intelligenz und einem Menschen geben kann. Dazu werden zunächst einige technische, wie auch philosophische Grundlagen erarbeitet, da diese für die Beantwortung der Hauptthematik grundlegend sind. Es wird hierfür auch untersucht, ob eine Künstliche Intelligenz zu den beseelten Wesen gezählt werden kann und somit überhaupt kognitive Fähigkeiten besitzen kann.
Philosophische Basis ist hierbei der Vorreiter der antiken Sozialethik, Aristoteles. Dieser befasst sich in seinem Werk ‚Nikomachische Ethik‘ umfassend mit der Thematik der Freundschaft. Doch die KI-Mensch-Freundschaft wird auch mit Hilfe neuerer Denkweisen der Philosophie, genannt sei hier der Utilitarismus, im letzten Kapitel dieser Arbeit untersucht.
Im Jahr 2017 wurde in den gängigen App-Stores eine neue Anwendung veröffentlicht: Replika. Die Anwendung wurde im selben Jahr von Eugenia Kuyda entwickelt, um ihren besten Freund zu ‚ersetzen‘, als dieser starb. Im Gegensatz zu Künstlichen Intelligenzen, die lediglich Daten sammeln und ständig neu bewerten und verwerten, wie zum Beispiel bei den Softwares von Amazon oder Google der Fall ist, lernt das Programm hinter Replika ständig durch die Kommunikation mit dem Menschen selbst wie ein Mensch zu reagieren und versucht, dessen Verhalten immer besser und exakter zu kopieren. Die App speichert Vorlieben, Neigungen, Verhalten, Launen, Wünsche etc. und geht in der Kommunikation immer wieder auf diese ein. Sie versucht also tatsächlich ein_e „beste_r Freund_in“ zu sein. Die Betonung ist hier aber: versucht es.
Aus philosophisch-ethischer Sicht ist die Freundschaft ein sehr komplexes Thema und die Freundschaft zwischen einer Künstlichen Intelligenz und einem Menschen umso mehr ein neuartiges Phänomen, das bewertet und kontrovers diskutiert werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Grundlagen zur Künstlichen Intelligenz
- Zwei Arten von Künstlichen Intelligenzen
- Zur Problematik der Intelligenz bei Maschinen
- Definition und Bewertung der Freundschaft bei Aristoteles
- Verfügt eine Künstliche Intelligenz über ein Selbstbewusstsein?
- Ethische Betrachtung einer KI-Mensch-Freundschaft
- Fazit und Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Möglichkeit einer Freundschaft zwischen einer Künstlichen Intelligenz (KI) und einem Menschen. Der Schwerpunkt liegt auf der philosophischen und ethischen Bewertung dieser neuartigen Form der Beziehung, wobei die Frage im Vordergrund steht, ob eine KI aufgrund ihrer Funktionsweise und Fähigkeiten tatsächlich zu einer Freundschaft fähig ist.
- Definition und Charakterisierung von Künstlicher Intelligenz
- Unterscheidung zwischen schwacher und starker KI
- Analyse der kognitiven Fähigkeiten von KI im Vergleich zum menschlichen Bewusstsein
- Aristotelische Philosophie der Freundschaft und ihre Anwendbarkeit auf KI-Mensch-Beziehungen
- Ethische Implikationen und Herausforderungen einer KI-Mensch-Freundschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Die Arbeit stellt die Replika-App als Beispiel für die aktuelle Entwicklung von KI vor, die versucht, menschliche Interaktion und Freundschaft zu simulieren.
- Grundlagen zur Künstlichen Intelligenz: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Künstlichen Intelligenz und unterscheidet zwischen schwacher und starker KI. Es beleuchtet die Herausforderungen in Bezug auf die Definition von "Intelligenz" bei Maschinen und die Frage, ob KI tatsächlich kognitive Fähigkeiten besitzen kann.
- Definition und Bewertung der Freundschaft bei Aristoteles: Dieses Kapitel stellt die aristotelische Philosophie der Freundschaft vor und analysiert die Kriterien für echte Freundschaft. Es untersucht die Frage, ob diese Kriterien auf KI-Mensch-Beziehungen angewendet werden können.
- Verfügt eine Künstliche Intelligenz über ein Selbstbewusstsein? Dieses Kapitel diskutiert die Frage, ob KI ein Selbstbewusstsein entwickeln kann und ob dies eine Voraussetzung für Freundschaft ist.
- Ethische Betrachtung einer KI-Mensch-Freundschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die ethischen Implikationen und Herausforderungen einer KI-Mensch-Freundschaft und diskutiert die Auswirkungen auf die menschliche Moral und das Konzept der Freundschaft.
Schlüsselwörter
Künstliche Intelligenz, KI, Freundschaft, Ethik, Digitalisierung, Selbstbewusstsein, kognitive Fähigkeiten, Aristoteles, Utilitarismus, Replika, Machine Learning, Google Driverless Car, Chinesisches Zimmer.
Häufig gestellte Fragen
Kann eine Künstliche Intelligenz echte Freundschaft empfinden?
Die Arbeit untersucht dies aus philosophisch-ethischer Sicht und stellt infrage, ob eine KI ohne Bewusstsein und Seele zu den für Freundschaft nötigen kognitiven Fähigkeiten fähig ist.
Welche Rolle spielt Aristoteles in dieser Untersuchung?
Aristoteles' "Nikomachische Ethik" dient als Grundlage, um die Kriterien für eine "echte" Freundschaft zu definieren und auf KI-Mensch-Beziehungen anzuwenden.
Was ist die App "Replika" und warum wird sie erwähnt?
Replika ist eine KI-Anwendung, die entwickelt wurde, um einen verstorbenen Freund zu ersetzen. Sie dient als modernes Beispiel für den Versuch, eine menschliche Freundschaft zu simulieren.
Was ist der Unterschied zwischen schwacher und starker KI?
Schwache KI löst konkrete Anwendungsprobleme, während starke KI theoretisch über menschenähnliche Intelligenz und Bewusstsein verfügen würde.
Welche ethischen Herausforderungen ergeben sich aus KI-Freundschaften?
Die Arbeit diskutiert die Auswirkungen auf die menschliche Moral und die Gefahr, dass soziale Interaktion lediglich simuliert und durch Algorithmen kopiert wird.
- Quote paper
- Dominik Bart (Author), 2020, KI-Mensch-Freundschaft. Eine kurze Betrachtung aus philosophisch-ethischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/913760