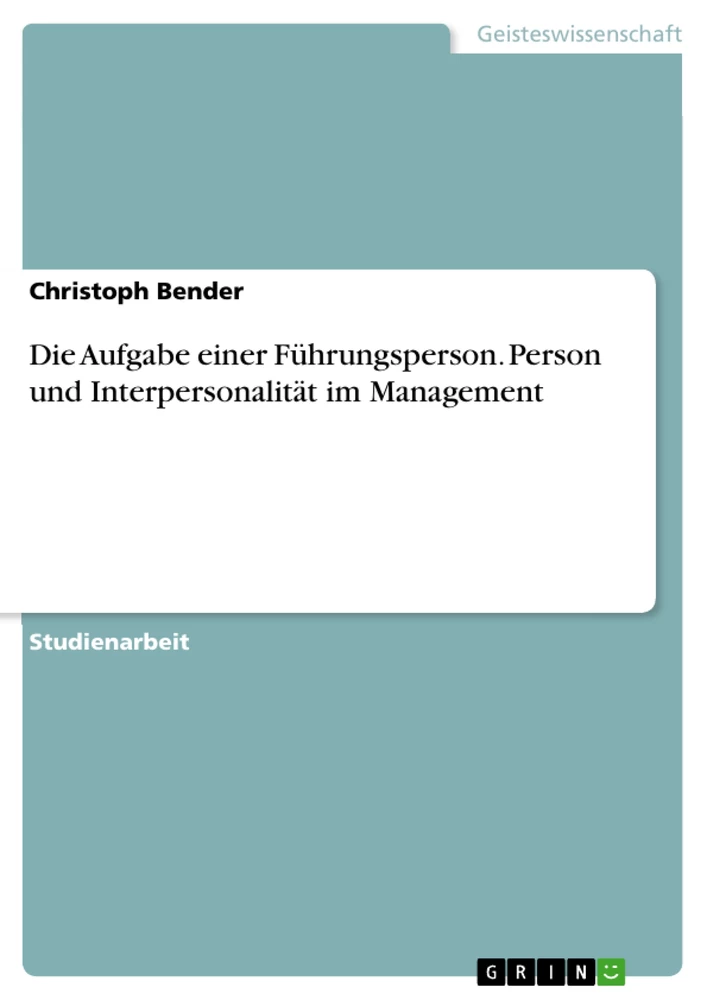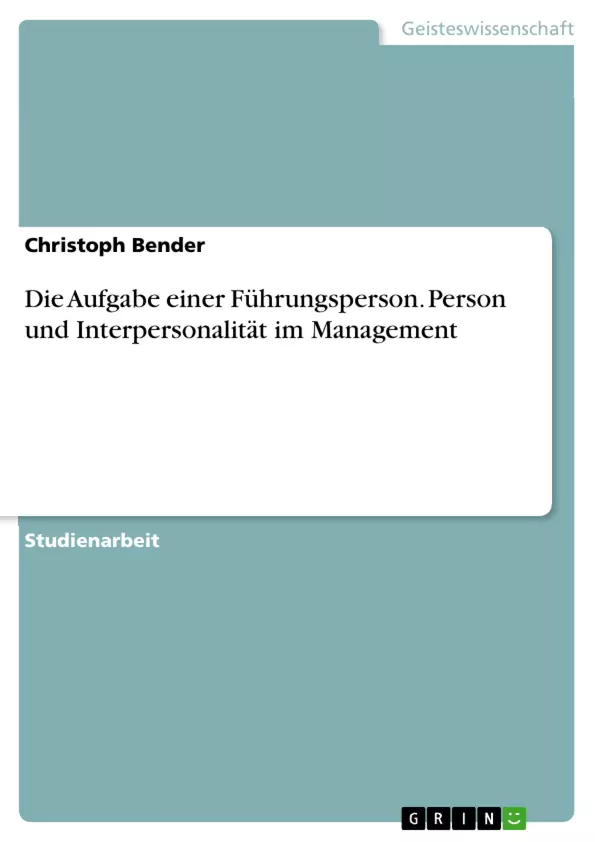Die Hausarbeit "Die Aufgabe einer Führungsperson – Person und Interpersonalität im Management" bietet einen umfassenden Überblick über die Rolle einer Führungskraft im modernen Unternehmenskontext. Sie beginnt mit der Erläuterung der grundlegenden Rolle einer Führungsperson und vertieft sich dann in die Grundbegrifflichkeiten der Person und Interpersonalität, einschließlich der Unterscheidung zwischen Mensch und Tier und der Bedeutung von interpersonellen Verhältnissen. Besonders bemerkenswert ist die Diskussion über die Wirkfreiheit einer Person zwischen Moral und Recht. Im weiteren Verlauf konzentriert sich der Text auf die Führungsethik in Unternehmen und die spezifischen Konfliktpotenziale, die sich aus der Doppelrolle einer Person als Führungskraft und Arbeitnehmer ergeben. Abschließend werden Schlussfolgerungen für den Führungsstil gezogen, die auf den vorangegangenen Diskussionen basieren.
Inhaltsverzeichnis
- Die Rolle der Führungsperson
- Grundbegrifflichkeiten der Person und Interpersonalität
- Abgrenzung von Tier und Mensch.
- Die Person und interpersonelle Verhältnisse.
- Wirkfreiheit einer Person zwischen Moral und Recht….......
- Führungsethik in Unternehmen.......
- Konfliktpotenziale einer Person in der Rolle als Arbeitnehmer..
- Die Führungskraft als Person......
- Schlussfolgerungen für den Führungsstil.……………………..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle der Führungskraft gegenüber dem Mitarbeiter als Person. Sie untersucht die Erwartungen, die in der heutigen Zeit an einen Vorgesetzten im Rahmen der Erfüllung seiner Führungsaufgaben gestellt werden. Dabei steht die Würde einer Person im Mittelpunkt und die Aufgaben der Führungsperson werden herausgearbeitet.
- Entwicklung eines Personenbegriffs
- Darstellung der interpersonellen Verhältnisse in einem Unternehmen
- Thematisierung der Würde des Mitarbeiters in einem Arbeitsverhältnis
- Untersuchung der Erwartungen an eine Führungsperson in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Rolle der Führungsperson
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Mitarbeiterzufriedenheit für den Unternehmenserfolg. Es werden verschiedene Strategien zur Steigerung der Zufriedenheit vorgestellt und der Fokus auf das Verhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeiter gelegt. Der Artikel „Ermutigung für Führungskräfte in der Wirtschaft“ des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden wird vorgestellt, der die Einbindung moralischer Prinzipien in die Unternehmensführung fordert.
2. Grundbegrifflichkeiten der Person und Interpersonalität
2.1. Abgrenzung von Tier und Mensch
In diesem Abschnitt wird der Mensch von Dingen und Tieren abgegrenzt. Es wird erläutert, dass der Mensch als Freiheitswesen über ein Bewusstsein verfügt, das ihm ermöglicht, zwischen sinnlichen und rationalen Empfindungen zu wählen. Im Gegensatz dazu folgen Tiere ihrem Instinkt und sind lustmotiviert.
2.2. Die Person und interpersonelle Verhältnisse
Hier wird Fichtes Theorie der Wechselwirkung von Freiheit und Intelligenz in der Beziehung zwischen Menschen vorgestellt. Der Mensch entwickelt sich durch gegenseitige Anerkennung von einem bloßen Subjekt zu einer Person. Das Konzept der Maxime als persönlicher Grundsatz zur Maximierung der Lusterzeugung wird erläutert.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit fokussiert auf die Themen Person, Interpersonalität, Führungsethik, Mitarbeiterzufriedenheit, Würde, Freiheit, Vernunft, interpersonelle Verhältnisse, Unternehmensethik, moralisches Verhalten und Maxime. Die Analyse basiert auf den Erkenntnissen von Fichte und Gerten sowie auf dem Artikel „Ermutigung für Führungskräfte in der Wirtschaft“ des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden.
Häufig gestellte Fragen
Was macht eine verantwortungsvolle Führungsperson aus?
Eine gute Führungskraft achtet die Würde des Mitarbeiters als Person und verbindet wirtschaftliche Ziele mit moralischen Prinzipien.
Wie unterscheidet sich der Mensch vom Tier im Management-Kontext?
Der Mensch wird als Freiheitswesen mit rationaler Wahlmöglichkeit gesehen, während Tiere instinktgesteuert und lustmotiviert handeln.
Was bedeutet Interpersonalität in einem Unternehmen?
Es beschreibt die wechselseitige Anerkennung und Beziehung zwischen Individuen, die sich gegenseitig als freie und intelligente Wesen wahrnehmen.
Welche ethischen Konflikte haben Führungskräfte?
Oft entsteht ein Spannungsfeld zwischen der Rolle als Arbeitnehmer (Loyalität zum Unternehmen) und der Verantwortung gegenüber den unterstellten Mitarbeitern.
Was ist das Konzept der "Maxime" nach Fichte?
Eine Maxime ist ein persönlicher Grundsatz des Handelns, der das eigene Verhalten leitet und im Idealfall moralischen Ansprüchen genügt.
- Citar trabajo
- Christoph Bender (Autor), 2020, Die Aufgabe einer Führungsperson. Person und Interpersonalität im Management, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/914310