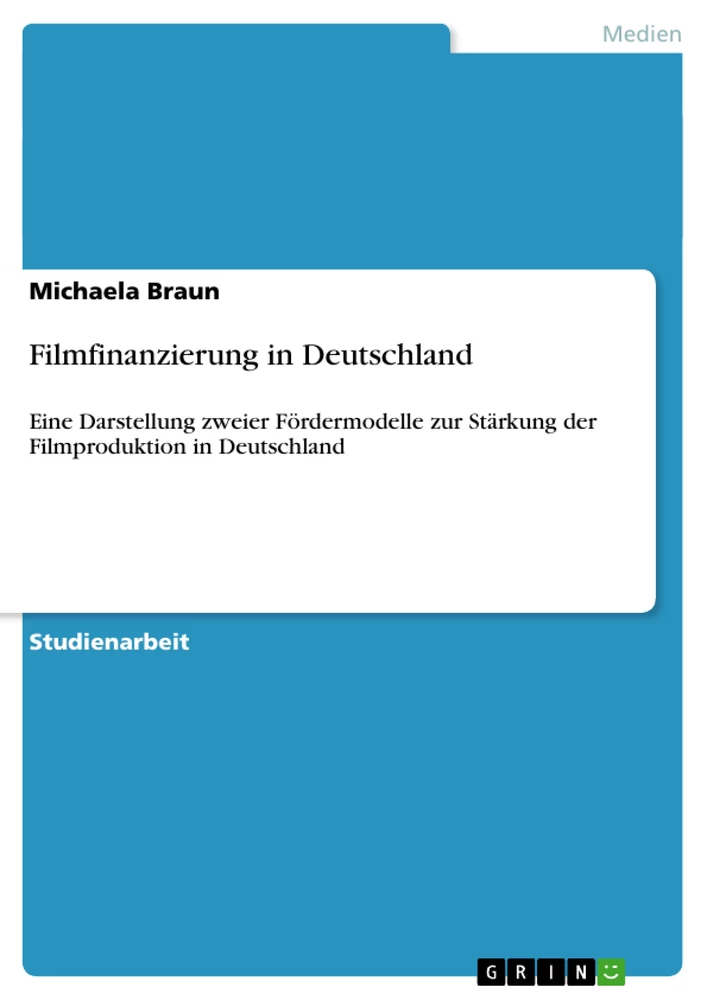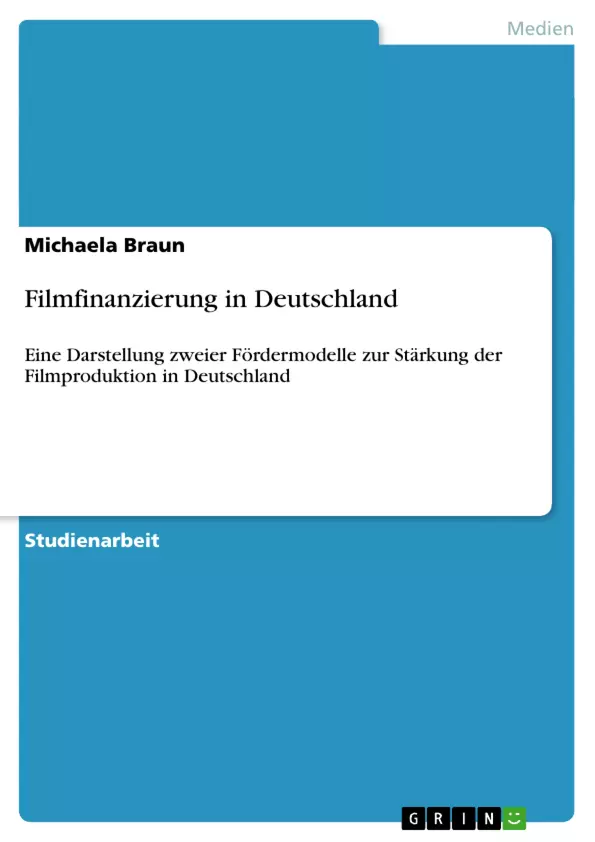Die Arbeit beschäftigt sich mit den aktuellen Entwicklungen der Filmfinanzierung in Deutschland. Untersucht werden das am 1. Januar 2007 in Kraft getretene Produktionskostenerstattungsmodell der Bundesregierung sowie das so genannte Sale-and-Leaseback-Verfahren. Dabei stehen im Mittelpunkt der Arbeit die Ansatzpunkte beider Modelle sowie deren ökonomischen Potentiale. Es werden die aktuellen politischen, wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen der deutschen Filmwirtschaft betrachtet, die zur Entscheidung für das Produktionskostenerstattungsmodell führten. Dabei ist das Ziel der Arbeit, die Beantwortung der Frage, ob das Modell die geforderten Rahmenbedingungen für die deutsche Filmwirtschaft erfüllen kann. Jüngste Erfolge deutscher Kinoproduktionen belegen, dass das Interesse am
deutschen Film national und international stetig steigt. Dennoch ist eine langfristige
internationale Etablierung des Standortes Deutschland noch nicht gelungen. So
können die Erfolge nicht darüber hinwegtäuschen, dass es den einheimischen
Produzenten nach wie vor an finanziellen Mitteln fehlt und dass Deutschland im
internationalen Standortwettbewerb um Produktionstätigkeiten eher auf den hinteren
Plätzen rangiert. In den vergangenen Jahren haben verschiedene Staaten
steuerliche Förderungen oder Zuschuss-Systeme eingeführt, die beispielsweise in
Kanada, Australien, Ungarn, Irland, England und Luxemburg die Zahl der dort
realisierten Produktionen vervielfacht haben. Das wirkte sich doppelt positiv auf die
Wirtschaft dieser Länder aus: Zum einen wurde verhindert, dass Produktionen, die
nicht von Dreharbeiten im Inland abhängen, ins günstigere Ausland abwandern und
zum anderen wurden vermehrt ausländische Produktionen in die Länder „gelockt“.
Das Fehlen solcher Anreize für die nationale und internationale Filmwirtschaft, oder
aber das Versiegen der Medienfondsgelder im Jahre 2005, führte auch in
Deutschland verstärkt zu Forderungen nach adäquaten Rahmenbedingungen durch
die Politik. Um diesen Forderungen Rechnung zu tragen, nahmen CDU, CSU und
SPD Selbstverpflichtungen in ihre Koalitionsvereinbarung auf, die die Thematik
sowohl im kulturellen Bereich, als auch im Finanz- und Steuerteil berücksichtigt: „Wir
wollen die Rahmenbedingungen für die deutsche Filmwirtschaft verbessern, um ihre
internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsbestimmung und Analyserahmen
2.1. Film
2.2. Filmpolitik
2.2.1. Film als Kulturgut
2.2.2. Film als Wirtschaftsgut
3. Filmwirtschaft und Filmfinanzierung
3.1. Geschichtliche Vorbetrachtungen
3.2. Medienfonds
3.2.1. Steuerrechtliche Behandlung der Medienfonds
4. Modelle
4.1. Sale-and-Leaseback-Verfahren
4.1.1. Leasing
4.1.2. Das Verfahren
4.1.3. Sale-and-Leaseback in Großbritannien
4.1.4. Sale-and-Leaseback für die deutsche Filmwirtschaft
4.2. Produktionskostenerstattungsmodell
4.2.1. Vergabekritierien
5. Fazit
1. Einleitung
Jüngste Erfolge deutscher Kinoproduktionen[1] belegen, dass das Interesse am deutschen Film national und international stetig steigt. Dennoch ist eine langfristige internationale Etablierung des Standortes Deutschland noch nicht gelungen. So können die Erfolge nicht darüber hinwegtäuschen, dass es den einheimischen Produzenten nach wie vor an finanziellen Mitteln fehlt und dass Deutschland im internationalen Standortwettbewerb um Produktionstätigkeiten eher auf den hinteren Plätzen rangiert. In den vergangenen Jahren haben verschiedene Staaten steuerliche Förderungen oder Zuschuss-Systeme eingeführt, die beispielsweise in Kanada, Australien, Ungarn, Irland, England und Luxemburg die Zahl der dort realisierten Produktionen vervielfacht haben. Das wirkte sich doppelt positiv auf die Wirtschaft dieser Länder aus: Zum einen wurde verhindert, dass Produktionen, die nicht von Dreharbeiten im Inland abhängen, ins günstigere Ausland abwandern und zum anderen wurden vermehrt ausländische Produktionen in die Länder „gelockt“.
Das Fehlen solcher Anreize für die nationale und internationale Filmwirtschaft, oder aber das Versiegen der Medienfondsgelder im Jahre 2005, führte auch in Deutschland verstärkt zu Forderungen nach adäquaten Rahmenbedingungen durch die Politik. Um diesen Forderungen Rechnung zu tragen, nahmen CDU, CSU und SPD Selbstverpflichtungen in ihre Koalitionsvereinbarung auf, die die Thematik sowohl im kulturellen Bereich, als auch im Finanz- und Steuerteil berücksichtigt: „Wir wollen die Rahmenbedingungen für die deutsche Filmwirtschaft verbessern, um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Wir schaffen spätestens zum 1. Juli 2006 international wettbewerbsfähige, mit anderen EU-Ländern vergleichbare Bedingungen und Anreize, um privates Kapital für Filmproduktionen in Deutschland zu verbessern.“[2]
Nach seiner Amtsübernahme 2005 knüpfte der neue Kulturstaatsminister, Bernd Neumann (CDU), an die bereits geführte Debatte über mögliche Modelle zur Unterstützung der deutschen Filmwirtschaft an und stellte Mitte 2006 sein so genanntes Produktionskostenerstattungsmodell vor. Dieses soll „zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produzenten und zum Anreiz für Produktionen in Deutschland“ führen. Am 21. Dezember 2006 wurde das Modell von der EU-Kommission ohne weitere Auflagen genehmigt und trat am 01.01.2007 in Kraft.
Im Blickpunkt der vorliegenden Arbeit sollen sowohl das, von der Bundesregierung verabschiedete Produktionskostenerstattungsmodell, als auch das von ihr verworfene „Sale-and-Leaseback-Verfahren“ nach englischem Vorbild stehen[3]. Zunächst wird die Ware „Film“ und ihr Stellenwert in das politische Umfeld eingeordnet. Danach werden die Ansatzpunkte der Modelle dargelegt und deren ökonomische Entwicklungspotentiale untersucht. Im Rahmen der Untersuchung soll folgende Fragestellung im Mittelpunkt der Arbeit stehen: Erfüllt das Produktionskostenerstattungsmodell die geforderten Rahmenbedingungen der Filmbranche sowie die Selbstverpflichtungen aus der Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und SPD?
2. Begriffsbestimmung und Analyserahmen
2.1. Film
Während beispielsweise Hollywood das Gut „Film“ als Ware begreift, besitzt es in Deutschland einen Doppelcharakter. Die amerikanische Filmwirtschaft analysiert kontinuierlich und intensiv ihren heimischen Markt und produziert von diesen Untersuchungen ausgehend weitestgehend marktorientiert. In Deutschland hingegen ist Film sowohl Kulturträger, als auch Ware. Dadurch ist er eingebettet in ein komplexes System von kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Verflechtungen sowie Wechselbeziehungen, die es zu beachten gilt.
2.2. Filmpolitik
Ausgehend von der Forderung nach politischen Rahmenbedingungen, muss zunächst die Frage der Zuständigkeit geklärt werden. Filmpolitik wird in Deutschland keinem bestimmten Regierungsressort zugeordnet und ist mit verschiedenen Politikfeldern mehr oder weniger eng verknüpft. Daher gehen filmpolitische Fragestellungen häufig weit über die klassischen Zuständigkeitsregelungen anderer Politikfelder hinaus und erfordern zu ihrer Lösung oft ein ganzes Bündel von Maßnahmen, deren Realisierung in der Verantwortung fast aller Ressorts und Politikebenen liegen.[4]
2.2.1. Film als Kulturgut
Wie bereits beschrieben, wird Film in Deutschland unter anderem als Kulturfaktor gesehen, der dazu beiträgt, dass nationale Kultur gestiftet und verbreitet wird. Dementsprechend ist Filmpolitik aus kultureller Sicht nach dem Grundgesetz in erster Linie eine Aufgabe der Länder und Gemeinden. Zusätzlich gibt es verschiedene kultur- und medienpolitischen Aktivitäten auf Bundesebene, die die Regierung 1998 in einer Regierungsbehörde – dem Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) – gebündelt hat. Sein Aufgabengebiet umfasst unter anderem die Förderung national bedeutender kultureller Einrichtungen, die Verbesserung der Rahmenbedingungen von Kunst und Kultur sowie die Vertretung nationaler kulturpolitischer Interessen auf europäischer Ebene. In Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium soll der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien zudem ein Umfeld schaffen, in dem die deutsche Filmwirtschaft gedeihen kann. Dabei kann er einerseits direkt ordnungspolitisch tätig werden, wie im Bereich des Urheberrechts oder bei der Künstlersozialversicherung, andererseits prüft er beispielsweise Gesetzes-vorhaben darauf, dass sie keine negativen Auswirkungen für den Kultursektor zur Folge haben.[5]
2.2.2. Film als Wirtschaftsgut
Während Cineasten den Film als Gesamtkunstwerk feiern, sehen Filmwirtschaftler in ihm eine der letzten Wachstumsbranchen der Gegenwart. Film wird mit einem hohen finanziellen Aufwand hergestellt und gegen ein Entgelt beispielsweise im Kino vorgeführt. So ist Film nicht nur Kulturfaktor, sondern auch ein ökonomisches Gut: Die Ware Film ist eine Leistungserstellung, mit dem Ziel, deren Ergebnis zu verwerten.[6] In dieser Funktion gehört die deutsche Filmindustrie wiederum in den Zuständigkeitsbereich der Wirtschaftspolitik von Bund und Ländern.
Im Vergleich zu anderen Wirtschaftsgütern weißt die Ware Film, neben den politischen Verflechtungen, weitere Besonderheiten auf und lässt sich von diesen beispielsweise auch steuerrechtlich unterscheiden. So beinhaltet er sowohl geistige, als auch materielle Komponenten. Die geistigen Komponenten, also der ästhetische Wert, der Einfluss auf die Rezipienten sowie die Wissensvermittlung durch einen Film, machen ihn zu einem immateriellen Gut. Durch das Filmmaterial, das Negativ oder die Kopie wiederum ist der materielle Wert von Film gegeben. Im Hinblick auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit soll hier jedoch nur der immaterielle Wert von Interesse sein.
2.2.2.1. Film als immaterielles Wirtschaftsgut
Nach dem deutschen Steuerrecht wird für immaterielle Vermögensgegenstände nach § 248, Abs. 2 HGB und § 5, Abs. 2 EStG kein Aktivposten in der Bilanz angesetzt. Da Film als selbst erstellter oder unentgeltlich erworbener immaterieller Vermögensgegenstand gewertet wird herrscht ein so genanntes Aktivierungsverbot. Während andere Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in der Regel nur über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden können, bilden immaterielle Wirtschaftsgüter durch ihre Nichtaktivierbarkeit eine Ausnahme. Sämtliche Aufwendungen für die Produktion von Filmen sind als Betriebsausgaben im Jahr der Herstellung anzusehen und mindern so den Gewinn des Herstellers in voller Höhe. Dieser Sachverhalt war vor allem für die Film- und Medienfonds interessant, worauf in Kapitel 3.1.2. näher eingegangen wird.
Die kulturellen und wirtschaftlichen Dimensionen verleihen dem Film einen hohen politischen Stellenwert. Im Kontext der vorliegenden Arbeit ist vor allem der wirtschaftliche Aspekt von Interesse, da es im Rahmen der Debatte um Unterstützungsmodelle in erster Linie um ökonomische Prozesse in Deutschland ging und geht.
3. Filmwirtschaft und Filmfinanzierung
3.1. Geschichtliche Vorbetrachtungen
Die deutsche Filmwirtschaft konnte nach dem 2. Weltkrieg nicht mehr an die Erfolge der 20er Jahre anknüpfen und entwickelte sich in Abhängigkeit von der staatlichen Förderungspolitik. Vor allem das von den amerikanischen Alliierten verhängte Verbot der wirtschaftlichen Konzentration und die zögerliche Lizensierungspolitik im Hinblick auf Produzenten und Verleiher sowie die Einflussnahme auf Themen und Stoffe bewirkten eine Zersplitterung der Filmwirtschaft in zahlreiche, zum großen Teil nicht überlebensfähige Einzelfirmen. Um eine vertikale Konzentration zu verhindern wurden Produktion, Verleih und Filmtheater per Gesetz getrennt.[7] Zudem waren die alten Exportmärkte verloren und der deutsche Film im Ausland verpönt. Noch heute ist Deutschland geprägt durch zahllose Produktionsfirmen, von denen kaum eine mehr als einen Film pro Jahr produziert.
[...]
[1] Der Marktanteil deutscher Filme lag 2006 bei 25,8 Prozent. Das ist der höchste Prozentsatz seit Beginn der Auswertung durch die Filmförderungsanstalt (FFA) im Jahr 1991. vgl. www.film20.de/news/index.html?c=News&ID=12146, Zugriff am 14.02.2007
[2] vgl. www.wortfeld.de/2005/11/der_koalitionsvertrag/, Zugriff am 08.01.2007
[3] Im Rahmen der Diskussion wurden weitere Modelle, wie beispielsweise das Kanadische Modell besprochen. Die Betrachtung weiterer Modelle würde aber weit über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinausgehen und wurden somit nicht mit einbezogen.
[4] vgl. www.soz.uni-frankfurt.de/Medien-Kommunikationssoziologie/MaiFilmpolitik.PDF , S. 5ff, Zugriff am 08.01.2007
[5] vgl. www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragterfuerKulturundMedien/ beauftragter-fuer-kultur-und-medien.html, Zugriff am 08.01.2006
[6] vgl. Eggers 2003, S. 8
[7] vgl. Jarothe 1998, S.76
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Produktionskostenerstattungsmodell?
Es ist ein 2007 in Deutschland eingeführtes Fördermodell (DFFF), das Produzenten einen Teil der in Deutschland ausgegebenen Produktionskosten zurückerstattet.
Was versteht man unter dem Sale-and-Leaseback-Verfahren?
Ein Finanzierungsmodell, bei dem ein Investor einen Film kauft und ihn an den Produzenten zurückleast, um steuerliche Vorteile zu generieren (bekannt aus Großbritannien).
Warum hat Film in Deutschland einen "Doppelcharakter"?
Film wird in Deutschland sowohl als schützenswertes Kulturgut als auch als ökonomisches Wirtschaftsgut betrachtet.
Wer ist für die Filmpolitik in Deutschland zuständig?
Zuständig sind primär die Länder und Gemeinden sowie auf Bundesebene der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).
Warum sind Medienfonds für die Filmfinanzierung wichtig gewesen?
Medienfonds ermöglichten privatem Kapital durch steuerliche Abschreibungsmodelle den Einstieg in die Filmfinanzierung, bevor die Gesetze 2005 verschärft wurden.
Wie wird Film steuerrechtlich behandelt?
Film gilt als immaterielles Wirtschaftsgut, für das in der Bilanz ein Aktivierungsverbot herrscht, was direkte Auswirkungen auf die steuerliche Absetzbarkeit von Produktionskosten hat.
- Citar trabajo
- Michaela Braun (Autor), 2007, Filmfinanzierung in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91447