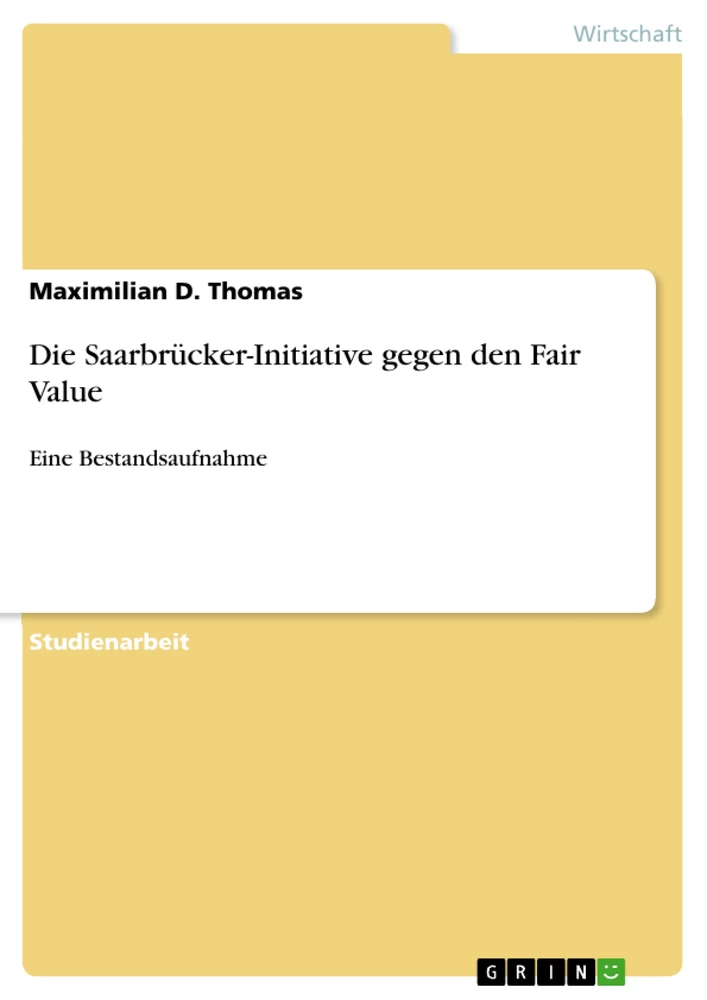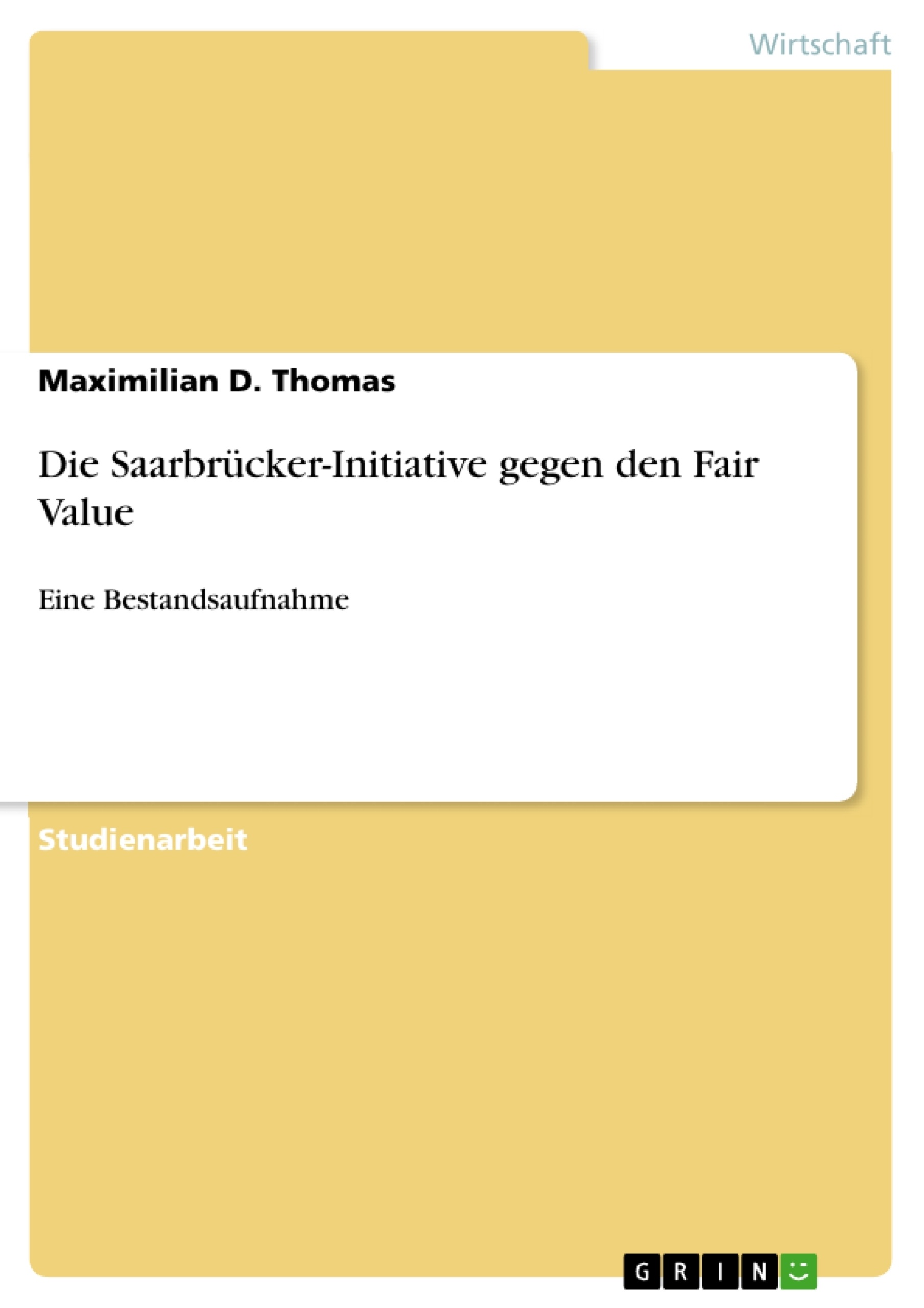Diese Arbeit geht auf die theoretischen und institutionellen Hintergründe der Fair Value-Diskussion in Deutschland ein. Auf dieser Grundlage kann eine Vereinbarkeit der Fair Value-Bewertung mit der handelsrechtlichen Rechnungslegung untersucht wer-den. Anschließend werden die wesentlichen Argumente der Fair Value-Debatte vorgestellt und anhand kurzer Beispiele erläutert. Es gilt im vierten Abschnitt die etwaigen Vor- und Nachteile der Fair Value-Bewertung kritisch zu würdigen. Aus der Würdigung ergibt sich, inwiefern die Fair Value-Bewertung als zweckgerecht bezeichnet werden kann. Es lassen sich Implikationen für die deutsche Gesetzgebung ableiten, unter welchen Bedingungen eine Implementierung der Fair Value-Bewertung in die handelsrechtliche Rechnungslegung zu rechtfertigen ist.
In den International Financial Reporting Standards (IFRS) hat die Bewertung zum Fair Value in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Eine zukünftige Ausweitung des Anwendungsbereichs erscheint als wahrscheinlich. Aufgrund der Internationalisierung der deutschen Rechnungslegung spielt die Fair Value-Bewertung bzw. die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert auch für den deutschen Gesetzgeber eine immer größer werdende Rolle. Es stellt sich die Frage, ob der Anwendungsbereich auch im deutschen Handelsrecht ausgeweitet werden sollte, um die Informationsfunktion der Rechnungslegung zu stärken. Das für den Gläubigerschutz relevante Anschaffungskostenprinzip würde entsprechend an Bedeutung verlieren.
In der Folge wurde die deutsche Fair Value-Diskussion neu entfacht. Insbesondere im Zuge der Verabschiedung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), das die Ausweitung der Fair Value-Bewertung über das Niederstwertprinzip hinaus vorsah, wurden Kritiker und Befürworter des Bewertungskonzepts aktiv. Der Schritt verdeutlicht das Interesse des Gesetzgebers, die handelsrechtlichen Bewertungsprinzipien modernisieren zu wollen. Es gilt zu diskutieren, ob dieser Weg als sinnvoll erachtet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer und institutioneller Hintergrund
- Gegenüberstellung der Rechnungslegungszwecke von HGB und IFRS
- Bewertungsreform im Zuge des BilMoG - Fair Value als Bewertungskonzept
- Die Saarbrücker Initiative gegen den Fair Value
- Die Fair Value-Debatte in Deutschland
- Argumente für eine Bewertung zum beizulegenden Zeitwert
- Darstellung der tatsächlichen unternehmerischen Lage
- Stärkung der Informationsfunktion
- Argumente gegen eine Bewertung zum beizulegenden Zeitwert
- Subjektivierung der Rechnungslegung und damit einhergehende Problematiken
- Schwächung der Ausschüttungsbemessungsfunktion
- Argumente für eine Bewertung zum beizulegenden Zeitwert
- Kritische Würdigung der Fair Value-Konzeption
- Beurteilung der Fair Value-Debatte in Deutschland
- Implikationen für die Gesetzgebung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Fair Value-Debatte in Deutschland und untersucht die Vereinbarkeit der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert mit dem deutschen Handelsrecht. Ziel ist es, die Argumente für und gegen die Implementierung der Fair Value-Bewertung im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zu analysieren und die Auswirkungen auf die deutsche Gesetzgebung zu bewerten.
- Die Fair Value-Bewertung im Kontext des deutschen Handelsrechts
- Die Argumente für und gegen die Fair Value-Bewertung
- Die Saarbrücker Initiative gegen den Fair Value
- Implikationen für die deutsche Gesetzgebung
- Bewertung der Fair Value-Konzeption
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die theoretischen und institutionellen Hintergründe der Fair Value-Debatte in Deutschland. Es werden die Rechnungslegungszwecke von HGB und IFRS gegenübergestellt und die Reform des Bilanzrechts im Zuge des BilMoG erläutert. Kapitel zwei präsentiert die wesentlichen Argumente für und gegen eine Bewertung zum beizulegenden Zeitwert. Dabei werden die Auswirkungen auf die Informationsfunktion, die Subjektivierung der Rechnungslegung und die Ausschüttungsbemessungsfunktion betrachtet. Im dritten Kapitel wird die Saarbrücker Initiative gegen den Fair Value analysiert und die Implikationen für die deutsche Gesetzgebung untersucht. Abschließend werden die Vor- und Nachteile der Fair Value-Bewertung kritisch gewürdigt und die Bedingungen für eine Implementierung im deutschen Handelsrecht diskutiert.
Schlüsselwörter
Fair Value-Bewertung, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), Handelsgesetzbuch (HGB), International Financial Reporting Standards (IFRS), Anschaffungskostenprinzip, Gläubigerschutz, Informationsfunktion, Subjektivierung der Rechnungslegung, Ausschüttungsbemessungsfunktion, Saarbrücker Initiative.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der Fair Value-Bewertung?
Fair Value bezeichnet den beizulegenden Zeitwert eines Vermögenswertes. In der Rechnungslegung wird diskutiert, ob dieser anstelle der historischen Anschaffungskosten treten sollte.
Was ist die „Saarbrücker Initiative gegen den Fair Value“?
Es handelt sich um eine Gruppe von Kritikern, die gegen die Ausweitung der Zeitwertbewertung im deutschen Handelsrecht argumentieren, da sie den Gläubigerschutz gefährdet sehen.
Wie unterscheidet sich das HGB von den IFRS bei der Bewertung?
Das HGB ist traditionell dem Vorsichtsprinzip und dem Anschaffungskostenprinzip verpflichtet, während die IFRS stärker auf die Informationsfunktion für Investoren und aktuelle Marktwerte setzen.
Welche Rolle spielt das BilMoG in dieser Debatte?
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) sah eine moderate Ausweitung der Fair Value-Bewertung vor, was die Diskussion über die Modernisierung der deutschen Rechnungslegung neu entfachte.
Was sind die Hauptargumente gegen den Fair Value?
Kritiker bemängeln die zunehmende Subjektivierung der Bilanz, die Volatilität der Ergebnisse und eine Schwächung der Funktion der Rechnungslegung als Basis für die Gewinnverteilung.
- Arbeit zitieren
- Maximilian D. Thomas (Autor:in), 2019, Die Saarbrücker-Initiative gegen den Fair Value, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/914792